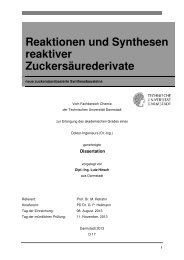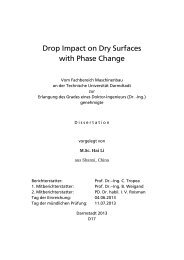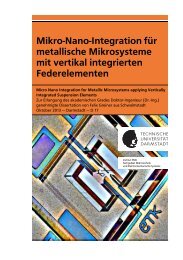INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Konzept „Exklusion“ stammt ursprünglich aus Frankreich (exclusion sociale).<br />
Bereits in den 1960er Jahren fand es Verwendung, wenngleich - im Kontext von<br />
Wachstum und angehender Vollbeschäftigung - mit einem anderen Bedeutungsgehalt.<br />
Interessant ist, dass das Phänomen im französischen Verständnis nicht Individuen<br />
zugerechnet und damit zum Randgruppenproblem wird, sondern der Fokus auf dem<br />
Verlust an vergesellschaftender Kraft der Gesellschaft liegt (vgl. Kronauer: 2002, 44;<br />
Steinert: 1998a, 71). In den Sozialwissenschaften wurde es in den 1980er Jahren aus<br />
einem modernisierungs- und systemtheoretischen Blickwinkel heraus thematisiert (vgl.<br />
Luhmann: 1981). 15 In Großbritannien konzipierte Townsend Armut erstmals Ende der<br />
1970er Jahre (1979: 31) als Ausschluss von Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft<br />
und gebrauchte in diesem Zusammenhang auch den Exklusionsbegriff. In Deutschland<br />
finden sich erste Erwähnungen in der Mitte der 1980er Jahre. Unterdessen hat das<br />
Konzept vor allem auch auf der Ebene der Europäischen Union eine große Resonanz<br />
erfahren (vgl. u.a. Barlösius/Ludwig-Mayerhofer: 2001; Bergounioux: 2001; Dangschat:<br />
1995; Europäische Kommission: 1993; Europäische Kommission: 1994; Kronauer:<br />
2002; Läufer: 1999, Sozialistische Partei Frankreichs: 1999). 16 Dabei steht es nach wie<br />
vor in Konkurrenz zu unterschiedlichen, oftmals nationalen Traditionen verhafteten<br />
Armutsdiskursen, etwa der Lebenslagen- oder der dynamischen Armutsforschung,<br />
oder wird mit diesen zu jeweils eigenen Interpretationen verknüpft. 17 Da auch die<br />
Armutsforschung zunehmend Lebenslagen statt Einkommenslagen, subjektive<br />
Einschätzungen der Betroffenen und Prozessaspekte, beziehungsweise dynamische<br />
Perspektiven integriert, kann mit Böhnke eine weitergehende Schlussfolgerung<br />
getroffen werden: „The concept of social exclusion summarises developments of recent<br />
poverty research“ (2001: 10).<br />
15 Zur Verwendung des Konzeptes bei Max Weber vgl. Burchardt u.a.: 2002, 1f..<br />
16 So gehören die Förderung des sozialen Zusammenhalts und von Inklusion als strategische<br />
Ziele zur Lissabon-Strategie der Europäischen Union (vgl. Burchardt u.a.: 2002, 1). Die<br />
Mitgliedsstaaten verfassen entsprechende Berichte zu „Nationalen Aktionsplänen zur<br />
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ (vgl. Bundesregierung: 2001a). Zur<br />
Rezeptionsgeschichte des Begriffs vergleiche ausführlich Kronauer: 2002, 9-33.<br />
17 Hier können grundsätzlich zwei, sich prinzipiell ergänzende Richtungen unterschieden<br />
werden. Die eine, über Jahrzehnte dominante, untersucht zur Verfügung stehende Ressourcen.<br />
Hierbei stehen vor allem die Einkommensverteilung oder Daten zum Sozialhilfebezug im<br />
Vordergrund. Die zweite untersucht die Verwendung der zur Verfügung stehenden Ressourcen<br />
und unterscheidet nach Lebenslagen. Armut wird hier als Unterversorgung gefasst, die in<br />
unterschiedlichen Bereichen, von Bildung bis Wohnen, auftreten kann. Konzepte relativer<br />
Deprivation versuchen demgegenüber, subjektive Einschätzungen eines allgemeinen<br />
Grundbedarfs in die Messung von Unterversorgung zu integrieren. Der Ansatz der dynamischen<br />
Armutsforschung fokussiert auf biographische Analysen und trägt so zu einer bedeutsamen<br />
Ausdifferenzierung statisch angelegter Untersuchungsansätze bei. Die Bedeutung von Daten<br />
zur subjektiven Einschätzung der persönlichen Lage ist vor allem darin begründet, dass<br />
grundsätzlich Messprobleme in der Armutserfassung bestehen und insbesondere<br />
Vermögensbesitz „in der Regel nicht einbezogen“ ist (Andreß/Lipsmeier: 1995, 35ff.; vgl. auch<br />
Böhnke/Delhey: 1999a; Hauser: 1995, 3ff.; Leibfried u.a.: 1995; Ludwig u.a.: 1995, 24f.).<br />
23