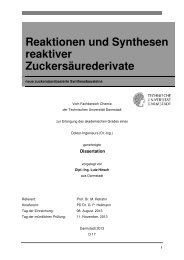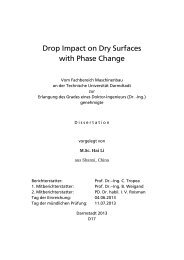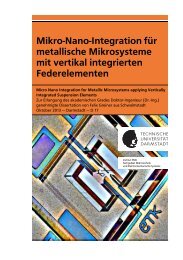INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFEN ... - tuprints
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
man ihn für lange Zeit als konjunkturelle Erscheinung verkennen konnte (Vogelsang:<br />
1999, 876).<br />
Das Baseler Institut Prognos veröffentlicht in regelmäßigen Abständen seinen<br />
„Deutschland Report“, in dem auch Aussagen zur zukünftigen Entwicklung am<br />
Arbeitsmarkt getroffen werden (vgl. Rothkirch: 1995; FAZ v. 14.09.99). Die zentrale<br />
Aussage: Bis 2010 ist „eine grundlegende Besserung am Arbeitsmarkt nicht in Sicht“<br />
(Rothkirch: 1995, 26; vgl. auch: Kurz-Scherf: 1998, 38). Beschäftigung wird in den<br />
meisten Branchen (weiter) abgebaut werden. Auch 2030 dürfte die Zahl der<br />
Arbeitslosen laut Prognos Deutschland Report 2030 noch über zwei Millionen liegen.<br />
Ein Beschäftigungsaufbau im Bereich der Dienstleistungen wird den Wegfall der Jobs<br />
im produzierenden Gewerbe nicht kompensieren können (Nöcker: 2006; Storbeck:<br />
2006, 1) 39 , insbesondere nicht im Bereich der niedrig Qualifizierten (vgl. Reinberg:<br />
2003, 15). 40<br />
Sowohl die Ende der 1990er Jahre beschäftigungspolitisch im Vergleich zu<br />
Deutschland erfolgreicheren Länder 41 als auch wissenschaftliche Expertisen 42 legen<br />
die Schlussfolgerung nahe, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland nicht in der<br />
gegebenen Höhe und nicht auf Dauer nur hingenommen werden muss 43 . So geht etwa<br />
39 In Modellrechnungen des IAB „unter Status-Quo-Bedingungen“ (Schnur/Zika: 2002, 1) wird<br />
für den Zeitraum 2005 bis 2020 dagegen immerhin von einem moderaten<br />
Beschäftigungsaufbau von 39 auf 40,3 Millionen Erwerbstätige in Deutschland (West) und<br />
„deutlichem Abbau der Arbeitslosigkeit“ bei sinkendem Erwerbspersonenpotential<br />
ausgegangen, wobei Verlusten in den Sektoren Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Land- und<br />
Forstwirtschaft Zugewinne im Bereich der Dienstleistungen gegenüberstehen (vgl. Schnur/Zika:<br />
2002; Schnur/Zika: 2005). Damit ist freilich keine Aussage zur möglichen Entwicklung der<br />
Arbeitslosigkeit getroffen. Die Prognosen sind zudem „mit großen Unsicherheiten“ behaftet und<br />
bilden ein „Status-quo-Szenario“ ab, das mögliche weltwirtschaftliche Einflüsse oder<br />
Änderungen in den institutionellen Rahmenbedingungen unberücksichtigt lässt (vgl. ebd.: 6).<br />
40 Dabei wird, Prognosen zufolge, der Bereich der Hilfstätigkeiten weiterhin ein größenmäßig<br />
relevanter Teil der Erwerbstätigkeit in Deutschland sein. So wird davon ausgegangen, dass<br />
„auch im Jahr 2010 noch etwa 16 Prozent aller Arbeitskräfte Hilfstätigkeiten verrichten werden<br />
(Reinberg: 2003, 16).<br />
41 Vgl. u.a. Bieling/Deppe: 1997; Forschungsschwerpunkt Arbeitsmarkt und Beschäftigung:<br />
2000; Eichhorst u.a.: 2001; Emmerich/Werner: 1998; Kröger/van Suntum: 1999; Kröger/van<br />
Suntum: 2000; Schmid/Schömann (Hg.): 1999; Stille: 1998a; Werner: 1998.<br />
42 Vgl. u.a. Autorengemeinschaft: 1998; Franz: 1997; Schmid: 1993; Streeck/Heinze: 1999; zu<br />
diesem Abschnitt außerdem: Belitz: 1995; Klauder: 2001, Kurz-Scherf: 1998, Mendius: 1997,<br />
Querschnittsgruppe Arbeit und Ökologie: 2000.<br />
43 Dabei kann zwischen einer Defensivstrategie, die eine Umverteilung von Arbeit, Einkommen<br />
und Zeit und eine Ausweitung öffentlich geförderter Beschäftigung betont (vgl.<br />
Barloschky/Spitzley: 1998; Massarat: 2003), und einer Offensivstrategie für ein tatsächliches<br />
Arbeitsplatzwachstum und verbesserte Austauschbeziehungen auf dem Arbeitsmarkt (vgl.<br />
Franz: 1997; Streeck/Heinze: 1999; zum Konzept der Übergangsarbeitsmärkte: Schmid: 1993)<br />
unterschieden werden. Brinkmann (1994: 6) schlägt vor, diese Strategien anhand von vier<br />
Kategorienbündeln auf ihre mögliche Effektivität und Effizienz zu überprüfen: 1. Quantitative<br />
und qualitative Beschäftigungswirkungen, 2. Implementationsprobleme, 3. Kosten und Erträge<br />
und 4. Weiteren Einzelaspekten wie beispielsweise Konsistenz und Risiken. Quer zu den<br />
beiden Strategien stehen Vorschläge, die im Kern eine veränderte Definition von Arbeit<br />
thematisieren, die über Erwerbsarbeit hinaus weist (vgl. die Konzepte einer<br />
39