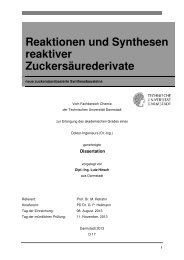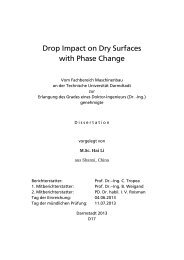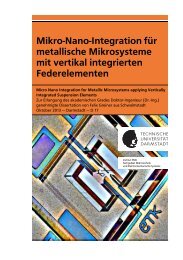- Seite 1 und 2: INKLUSION UND ARBEITSMARKT. SCHAFFE
- Seite 3 und 4: 2.3 Funktionsstörungen der Arbeits
- Seite 5 und 6: 6.4 Neue Perspektiven durch Netzwer
- Seite 7 und 8: Abbildungsverzeichnis Nr. Titel Sei
- Seite 9 und 10: Tabellenverzeichnis Nr. Titel Seite
- Seite 11 und 12: „Leistungen aktiver Arbeitsmarktp
- Seite 13 und 14: gesucht worden, wobei auch netzwerk
- Seite 15 und 16: liegt die These zugrunde, dass die
- Seite 17 und 18: zielen entsprechend allgemeiner auf
- Seite 19 und 20: Kronauer (2002: 43) nennt drei wese
- Seite 21 und 22: sozialen Netzwerken erscheint darum
- Seite 23 und 24: - Abb. 2 Dimensionen des Exklusions
- Seite 25 und 26: Der Siegeszug des Begriffes stößt
- Seite 27 und 28: - Abb. 3 Dimensionen sozialer Ausgr
- Seite 29: Determinanten auf der Mikroebene we
- Seite 33 und 34: Mit der neuen historischen Konstell
- Seite 35 und 36: nur diejenigen Personen in Frage ko
- Seite 37 und 38: Wirtschaft oder Demographie - in de
- Seite 39 und 40: Bereich erneuerbarer Energien (vgl.
- Seite 41 und 42: das IAB in einer Projektion 44 davo
- Seite 43 und 44: - Abb. 6 Wandel der Arbeitformen -
- Seite 45 und 46: Die Pluralisierung oder Diversifizi
- Seite 47 und 48: Morgenroth: 2003). Eher weicht die
- Seite 49 und 50: Gleichzeitig sind die zuletzt leich
- Seite 51 und 52: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an a
- Seite 53 und 54: unfreiwillig Inaktive. 68 Inaktivit
- Seite 55 und 56: Arbeitslosigkeit: 73 Knapp 60 Proze
- Seite 57 und 58: ihrer Weiterqualifizierung erreicht
- Seite 59 und 60: werden, in dessen Zuständigkeitsbe
- Seite 61 und 62: nämlich, wenn sie im Vergleich zum
- Seite 63 und 64: - Abb. 8 Der Politik-Regelkreis - S
- Seite 65 und 66: Problemstränge und darauf bezogene
- Seite 67 und 68: Mangelnde Responsivität auf der St
- Seite 69 und 70: genau umgesetzt werden soll, wird s
- Seite 71 und 72: Finanzausstattung der Bundesagentur
- Seite 73 und 74: wie z.B. zur Bestandssicherung von
- Seite 75 und 76: 2.3.3 Exklusionswirkungen staatlich
- Seite 77 und 78: freilich, dass eine als existenziel
- Seite 79 und 80: Schließlich kann noch davon ausgeg
- Seite 81 und 82:
(hierarchisch) organisierter Arbeit
- Seite 83 und 84:
isherigen Ansätze der Steuerungs-
- Seite 85 und 86:
zivilgesellschaftlichen Regelungsfo
- Seite 87 und 88:
- „Zusammenspiel von (personalen)
- Seite 89 und 90:
- Abb. 11 Landkarte der sozialwisse
- Seite 91 und 92:
Es handelt sich bei den Steuerungsm
- Seite 93 und 94:
- Abb. 12 Politik-Netzwerk-Konzepte
- Seite 95 und 96:
Hierfür wird zunächst grundsätzl
- Seite 97 und 98:
Handlungsstrategien oder -ebenen zu
- Seite 99 und 100:
Ressourcen, Know-How und einem Hand
- Seite 101 und 102:
auf diese Kategorie bezogene Hypoth
- Seite 103 und 104:
Forschung“ (Scharpf: 2000, 32), d
- Seite 105 und 106:
zukunftsfähiges Deutschland“ vor
- Seite 107 und 108:
Beschäftigungspolitik zu erreichen
- Seite 109 und 110:
- Abb. 14 Die Struktur der bundeswe
- Seite 111 und 112:
- Abb. 15 Die Regionalnetzwerke der
- Seite 113 und 114:
Die Arbeitsweise in den einzelnen N
- Seite 115 und 116:
- Abb. 17 Projektarbeit in der Init
- Seite 117 und 118:
Darstellung der Initiative, die Erf
- Seite 119 und 120:
Akteure An dieser Stelle interessie
- Seite 121 und 122:
Kontakt zu knüpfen und eine Einbin
- Seite 123 und 124:
durch die dargestellte asymmetrisch
- Seite 125 und 126:
Vorstands der damaligen Degussa-Hü
- Seite 127 und 128:
Schwerpunkte für vier Arbeitskreis
- Seite 129 und 130:
von Unternehmen und Schulen erreich
- Seite 131 und 132:
aus Geschäftsideen Unternehmenskon
- Seite 133 und 134:
und Anpassung an veränderte Rahmen
- Seite 135 und 136:
Umsetzung eines Projektes für bena
- Seite 137 und 138:
Erfolgsfaktoren entlang der Projekt
- Seite 139 und 140:
- Abb. 20 Das regionale Netzwerk Rh
- Seite 141 und 142:
5.1 Grundzüge der Grounded Theory
- Seite 143 und 144:
zusammengesetzt werden. Dies wird d
- Seite 145 und 146:
Forschungsgebiet zu der gleichen Ei
- Seite 147 und 148:
Untersuchung sind vorläufiger Natu
- Seite 149 und 150:
In dieser Arbeit wurde als Verfahre
- Seite 151 und 152:
Tab. 5 Dimensionen sozialer Ausgren
- Seite 153 und 154:
- Abb. 24 Rahmen zur Analyse sozial
- Seite 155 und 156:
Fall ist im Wohlfahrtssurvey selbst
- Seite 157 und 158:
Frage: Es gibt verschiedene Meinung
- Seite 159 und 160:
auf die Kritik am Begriff der sozia
- Seite 161 und 162:
Hier sind einige Fragen über Mensc
- Seite 163 und 164:
- Abb. 26 Dimensionen zur Operation
- Seite 165 und 166:
5.3 Vorgehensweise im empirischen T
- Seite 167 und 168:
Strategien regionaler Arbeitsmarktp
- Seite 169 und 170:
5.3.1.2 Auswahl des Regionalen Netz
- Seite 171 und 172:
5.3.2 Fokussierung der Fragestellun
- Seite 173 und 174:
Schafft die Initiative für Beschä
- Seite 175 und 176:
5.3.3.1.2 Umgang mit unvollständig
- Seite 177 und 178:
Dieses Verfahren kann insofern als
- Seite 179 und 180:
Erfahrungsbeispielen, zu den spezif
- Seite 181 und 182:
nach der Grounded Theory gerecht. W
- Seite 183 und 184:
Blick auf die Fragestellung, inwiew
- Seite 185 und 186:
- Abb. 32 Gruppe 1/2 Auswertung Pro
- Seite 187 und 188:
Einkommen richtig war, zumal im Unt
- Seite 189 und 190:
- Abb. 36 Gruppe 1/2 Häufigkeiten
- Seite 191 und 192:
- Abb. 39 Gruppe 1/2 Auswertung Ges
- Seite 193 und 194:
Bei einem Fragebogen fehlen Angaben
- Seite 195 und 196:
- Abb. 43 Gruppe 3/4 Auswertung Pro
- Seite 197 und 198:
- Abb. 45 Gruppe 3/4 Auswertung Kon
- Seite 199 und 200:
- Abb. 48 Gruppe 3/4 Häufigkeiten
- Seite 201 und 202:
fallen nach der hier verwendeten Op
- Seite 203 und 204:
Tab. 7 Aggregierte Auswertung der V
- Seite 205 und 206:
Werten der aktuellen und perspektiv
- Seite 207 und 208:
B hat die Grundschule „mit durchs
- Seite 209 und 210:
6.3.3 Teilnehmer C Teilnehmer C ist
- Seite 211 und 212:
suchen, und war ein Jahr lang nicht
- Seite 213 und 214:
leibt auf der Basis der vorhandenen
- Seite 215 und 216:
Für die Richtigkeit der zitierten
- Seite 217 und 218:
Thema ansteht, (…) eine kurze Run
- Seite 219 und 220:
- ich wollte jedoch gleich zum Real
- Seite 221 und 222:
hatten. In den ersten zwei, drei Wo
- Seite 223 und 224:
Follow me. Der kommt mal in die (
- Seite 225 und 226:
wurde dann (…) verkauft. Es ist d
- Seite 227 und 228:
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung ve
- Seite 229 und 230:
Tab. 8 Perspektivenschaffende Wirku
- Seite 231 und 232:
Die Handlungsorientierung entfaltet
- Seite 233 und 234:
Prozessmangement von Bedeutung, das
- Seite 235 und 236:
Im Projekt „Beschäftigungsmotor
- Seite 237 und 238:
Eindruck vom Projekt zu machen, gen
- Seite 239 und 240:
6.5.5 Zwischenfazit VII Die nachfol
- Seite 241 und 242:
usw.), als auch am letztendlichen S
- Seite 243 und 244:
Außenspaltung der Gesellschaft han
- Seite 245 und 246:
Dass dies so ist, darauf hat die Un
- Seite 247 und 248:
Zusammenhang sei noch einmal auf de
- Seite 249 und 250:
Die Initiative für Beschäftigung!
- Seite 251 und 252:
zur Verfügung stehenden Handlungsr
- Seite 253 und 254:
Persönlichkeit des oder der Einzel
- Seite 255 und 256:
genutzt werden konnten. 233 Es blei
- Seite 257 und 258:
von Gruppen (Teilnehmer versus Nich
- Seite 259 und 260:
B Selbstdarstellung der Initiative
- Seite 261 und 262:
2006: Am 3. Februar werden die Gewi
- Seite 263 und 264:
E Beschreibungen der realisierten P
- Seite 265 und 266:
Ansprechpartner: Thomas Klinkel, La
- Seite 267 und 268:
Mathematik oder Sozialkunde Prüfun
- Seite 269 und 270:
Anhang F Fragebogen Technische Univ
- Seite 271 und 272:
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr gee
- Seite 273 und 274:
272
- Seite 275 und 276:
274
- Seite 277 und 278:
Danke für Ihre Unterstützung! 276
- Seite 279 und 280:
Bach, Hans-Uwe u.a. (1999), Der Arb
- Seite 281 und 282:
Bobbio, Noberto (1996), Left and ri
- Seite 283 und 284:
Bundesregierung (2005), Lebenslagen
- Seite 285 und 286:
Emmerich, Knut (1998), Dänemark: A
- Seite 287 und 288:
Privatisierung und staatliche Regul
- Seite 289 und 290:
Initiative für Beschäftigung (Hg.
- Seite 291 und 292:
Knyphausen-Aufseß, Dodo zu (2005),
- Seite 293 und 294:
Marin, Bernd/Renate Mayntz (1991),
- Seite 295 und 296:
Niejahr, Elisabeth (2006), Kollegen
- Seite 297 und 298:
Rothkirch, Christoph von (1995), We
- Seite 299 und 300:
Schnur, Peter/Gerd Zika (2005), Nur
- Seite 301 und 302:
Thoma, Günter (2003), Jugendarbeit
- Seite 303 und 304:
Willke, Helmut ( 3 2001), Systemthe
- Seite 305 und 306:
Erklärung Die vorliegende Arbeit w
- Seite 307 und 308:
(Lebenslauf Seite 2) Stipendien Stu
- Seite 309:
(Lebenslauf Seite 4) Veröffentlich