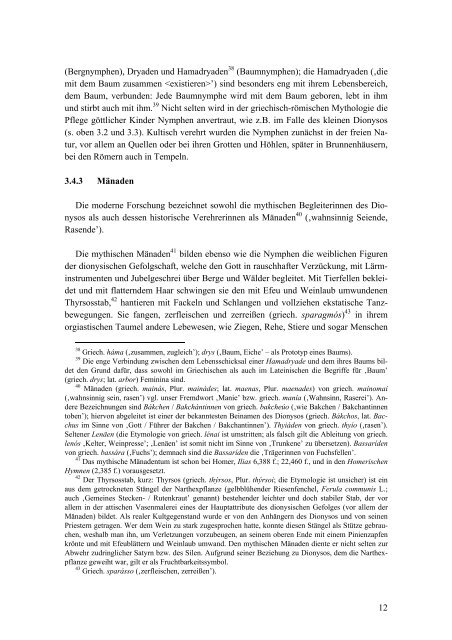Vom Maskenkult zur Theatermaske - Hochschulschriftenserver der ...
Vom Maskenkult zur Theatermaske - Hochschulschriftenserver der ...
Vom Maskenkult zur Theatermaske - Hochschulschriftenserver der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(Bergnymphen), Dryaden und Hamadryaden 38 (Baumnymphen); die Hamadryaden (‚die<br />
mit dem Baum zusammen ’) sind beson<strong>der</strong>s eng mit ihrem Lebensbereich,<br />
dem Baum, verbunden: Jede Baumnymphe wird mit dem Baum geboren, lebt in ihm<br />
und stirbt auch mit ihm. 39 Nicht selten wird in <strong>der</strong> griechisch-römischen Mythologie die<br />
Pflege göttlicher Kin<strong>der</strong> Nymphen anvertraut, wie z.B. im Falle des kleinen Dionysos<br />
(s. oben 3.2 und 3.3). Kultisch verehrt wurden die Nymphen zunächst in <strong>der</strong> freien Natur,<br />
vor allem an Quellen o<strong>der</strong> bei ihren Grotten und Höhlen, später in Brunnenhäusern,<br />
bei den Römern auch in Tempeln.<br />
3.4.3 Mänaden<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Forschung bezeichnet sowohl die mythischen Begleiterinnen des Dionysos<br />
als auch dessen historische Verehrerinnen als Mänaden 40 (‚wahnsinnig Seiende,<br />
Rasende’).<br />
Die mythischen Mänaden 41 bilden ebenso wie die Nymphen die weiblichen Figuren<br />
<strong>der</strong> dionysischen Gefolgschaft, welche den Gott in rauschhafter Verzückung, mit Lärminstrumenten<br />
und Jubelgeschrei über Berge und Wäl<strong>der</strong> begleitet. Mit Tierfellen bekleidet<br />
und mit flatterndem Haar schwingen sie den mit Efeu und Weinlaub umwundenen<br />
Thyrsosstab, 42 hantieren mit Fackeln und Schlangen und vollziehen ekstatische Tanzbewegungen.<br />
Sie fangen, zerfleischen und zerreißen (griech. sparagmós) 43 in ihrem<br />
orgiastischen Taumel an<strong>der</strong>e Lebewesen, wie Ziegen, Rehe, Stiere und sogar Menschen<br />
38<br />
Griech. háma (‚zusammen, zugleich’); drys (‚Baum, Eiche’ – als Prototyp eines Baums).<br />
39<br />
Die enge Verbindung zwischen dem Lebensschicksal einer Hamadryade und dem ihres Baums bildet<br />
den Grund dafür, dass sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen die Begriffe für ‚Baum’<br />
(griech. drys; lat. arbor) Feminina sind.<br />
40<br />
Mänaden (griech. mainás, Plur. mainádes; lat. maenas, Plur. maenades) von griech. maínomai<br />
(‚wahnsinnig sein, rasen’) vgl. unser Fremdwort ‚Manie’ bzw. griech. manía (‚Wahnsinn, Raserei’). An<strong>der</strong>e<br />
Bezeichnungen sind Bákchen / Bakchántinnen von griech. bakcheúo (‚wie Bakchen / Bakchantinnen<br />
toben’); hiervon abgeleitet ist einer <strong>der</strong> bekanntesten Beinamen des Dionysos (griech. Bákchos, lat. Bacchus<br />
im Sinne von ‚Gott / Führer <strong>der</strong> Bakchen / Bakchantinnen’). Thyiáden von griech. thyío (‚rasen’).<br />
Seltener Lenäen (die Etymologie von griech. lénai ist umstritten; als falsch gilt die Ableitung von griech.<br />
lenós ‚Kelter, Weinpresse’; ‚Lenäen’ ist somit nicht im Sinne von ‚Trunkene’ zu übersetzen). Bassaríden<br />
von griech. bassára (‚Fuchs’); demnach sind die Bassaríden die ‚Trägerinnen von Fuchsfellen’.<br />
41<br />
Das mythische Mänadentum ist schon bei Homer, Ilias 6,388 f.; 22,460 f., und in den Homerischen<br />
Hymnen (2,385 f.) vorausgesetzt.<br />
42<br />
Der Thyrsosstab, kurz: Thyrsos (griech. thýrsos, Plur. thýrsoi; die Etymologie ist unsicher) ist ein<br />
aus dem getrockneten Stängel <strong>der</strong> Narthexpflanze (gelbblühen<strong>der</strong> Riesenfenchel, Ferula communis L.;<br />
auch ‚Gemeines Stecken- / Rutenkraut’ genannt) bestehen<strong>der</strong> leichter und doch stabiler Stab, <strong>der</strong> vor<br />
allem in <strong>der</strong> attischen Vasenmalerei eines <strong>der</strong> Hauptattribute des dionysischen Gefolges (vor allem <strong>der</strong><br />
Mänaden) bildet. Als realer Kultgegenstand wurde er von den Anhängern des Dionysos und von seinen<br />
Priestern getragen. Wer dem Wein zu stark zugesprochen hatte, konnte diesen Stängel als Stütze gebrauchen,<br />
weshalb man ihn, um Verletzungen vorzubeugen, an seinem oberen Ende mit einem Pinienzapfen<br />
krönte und mit Efeublättern und Weinlaub umwand. Den mythischen Mänaden diente er nicht selten <strong>zur</strong><br />
Abwehr zudringlicher Satyrn bzw. des Silen. Aufgrund seiner Beziehung zu Dionysos, dem die Narthexpflanze<br />
geweiht war, gilt er als Fruchtbarkeitssymbol.<br />
43<br />
Griech. sparásso (‚zerfleischen, zerreißen’).<br />
12