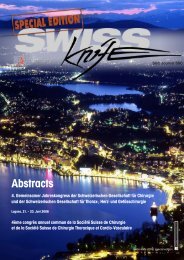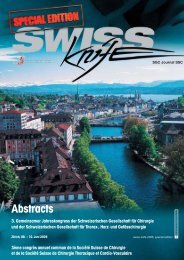Anorectal Manometry in 3D NEW! - Swiss-knife.org
Anorectal Manometry in 3D NEW! - Swiss-knife.org
Anorectal Manometry in 3D NEW! - Swiss-knife.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sonalführung und werden auch <strong>in</strong> der Weiterbildung von Assistenzärzten gebraucht. Diese Arbeit untersucht<br />
diese Zielvere<strong>in</strong>barungen bezüglich ihrer Themenbereiche und ihrer formellen Qualität.<br />
Methods: Die anlässlich der Mitarbeitergespräch von den Assistenzärzten schriftlich formulierten<br />
und vom Chefarzt bestätigten Zielen für die nächste Weiterbildungsperiode wurden gesammelt und<br />
<strong>in</strong> Themenbereiche und <strong>in</strong> Unternehmensziele oder persönliche Entwicklungsziele e<strong>in</strong>geteilt. Weitere<br />
untersuchte Punkte waren die Erfüllung der S.M.A.R.T.-Kriterien („Spezifisch, Messbar, Angemessen,<br />
Realistisch und Term<strong>in</strong>iert“), die Erreichbarkeit aus eigener Kraft und die Basierung auf dem Weiterbildungsprogramm<br />
der FMH.<br />
Results: In den Jahren 2004 bis 2009 wurden von 40 Assistenzärzten anlässlich der Mitarbeitergespräche<br />
241 Ziele genannt. Die Ziele betrafen folgende Themenbereiche : Praktische Fertigkeiten (101)<br />
, theoretisches Wissen (32), Persönlichkeitsentwicklung / Arbeits<strong>org</strong>anisation (45), Karriereplanung<br />
(19), Prüfungen (19), externe Weiterbildungen / Kurse (18) und wissenschaftliche Arbeiten (7). 84<br />
Ziele (34.9%) wurden als Unternehmensziel e<strong>in</strong>gestuft, die restlichen 157 (65.1%) betrafen die persönliche<br />
Entwicklung der Mitarbeiter. Bezüglich den S.M.A.R.T.-Kriterien erfüllten 146 (60.6%) alle fünf Kriterien<br />
und 95 (39.4%) vier der fünf Kriterien. 175 Ziele (72.6%) waren vornehmlich vom E<strong>in</strong>satz und<br />
der Leistung des e<strong>in</strong>zelnen Assistenzarztes abhängig, 66 (27.4%) entsprachen eher Wünschen an die<br />
V<strong>org</strong>esetzten. 107 (44.4%) Ziele leiten sich direkt aus dem Weiterbildungsprogramm für den Facharzt<br />
Chirurgie der FMH ab.<br />
Conclusion: Das Instrument der Zielvere<strong>in</strong>barung anlässlich der Mitarbeitergespräche wird an der untersuchten<br />
Kl<strong>in</strong>ik überwiegend für die Weiterbildungsplanung der Assistenzärzte und weniger für die<br />
Erreichung der Unternehmensziele benutzt. Das Erlernen von praktischen Fähigkeiten steht bei diesen<br />
Entwicklungszielen im Vordergrund, aber nur knapp die Hälfte aller Ziele leitet sich direkt aus dem<br />
Weiterbildungsprogramm zum Facharzt Chirurgie ab. Die formelle Qualität der getroffenen Ziele ist<br />
gemäss den S.M.A.R.T.-Kriterien als gut e<strong>in</strong>zustufen.<br />
70.18<br />
Erste Behandlungsergebnisse bei der Vers<strong>org</strong>ung von Claviculafrakturen mit der w<strong>in</strong>kelstabilen Synthes<br />
LCP Superior Anterior Clavicle Plate im Vergleich zur 3,5 AO- Rekoplatte<br />
J. G. Assmann, C. von der Lippe, K. Oehy (Frauenfeld)<br />
Objective: Zur Vers<strong>org</strong>ung von Frakturen des mittleren Claviculadrittels kommen Osteosyntheseplatten<br />
wie die 3,5-mm-Rekoplatte und die w<strong>in</strong>kelstabile 3,5-mm-LCP zur Anwendung. Die Clavicula ist <strong>in</strong><br />
diesem Bereich am dünnsten und ohne muskulo-ligamentäre Schutzstrukturen kräftigem Muskelzug<br />
ausgesetzt. Dennoch muss die Osteosynthese absolute Stabilität gewährleisten. Die w<strong>in</strong>kelstabile<br />
3,5-mm-LCP sche<strong>in</strong>t diesem Anspruch besser gerecht zu werden als die 3,5-mm-Rekoplatte.<br />
Methods: Während 6 Monaten wurden 7 Patienten mittels LCP vers<strong>org</strong>t. In allen Fällen lag e<strong>in</strong>e dislozierte<br />
Mehrfragmentfraktur vor, e<strong>in</strong>mal sekundär disloziert nach zunächst konservativem Ansatz. In<br />
e<strong>in</strong>em Fall lag e<strong>in</strong>e Delayed union nach Nagelosteosynthese vor. Hier wurde wie bei e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Patienten mit Refraktur bei St.n. Primärvers<strong>org</strong>ung mit e<strong>in</strong>er 3,5-mm-Rekoplatte e<strong>in</strong>e Spongiosaplastik<br />
notwendig. In e<strong>in</strong>em Fall lag e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ationsverletzung mit e<strong>in</strong>er Fraktur des mittleren Schaftes<br />
und der lateralen Clavicula vor. Zum Vergleich wurden Ergebnisse der Vorjahresstudie herangezogen,<br />
bei der 12 Patienten mit e<strong>in</strong>er 3,5-mm-Rekoplatte vers<strong>org</strong>t wurden. Die Nachbehandlung be<strong>in</strong>haltete<br />
e<strong>in</strong>e 2 wöchige Ruhigstellung im Gilchristverband mit anschliessender belastungsfreier Mobilisation<br />
bis 4 Wochen postoperativ. Die Patienten wurden kl<strong>in</strong>isch und radiologisch nach 1, 2 und 3 Monaten<br />
nachkontrolliert.<br />
Results: Alle mit der LCP vers<strong>org</strong>ten Patienten zeigten postoperativ e<strong>in</strong>en komplikationslosen Verlauf.<br />
Implantat<strong>in</strong>suffizienzen oder Refrakturen traten nicht auf. Nach 8 Wochen zeigten sich bei deutlicher<br />
Kallusbildung ke<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>weise auf Pseudarthrosen oder Wundheilungsstörungen. Bei den im Vorjahr<br />
mit der Rekoplatte vers<strong>org</strong>ten Patienten zeigten sich 2 Plattenverbiegungen und 1 Plattenausriss.<br />
Conclusion: Die LCP eignet sich zur Vers<strong>org</strong>ung von Claviculaschaftfrakturen, da sie als kräftiges Implantat<br />
e<strong>in</strong>e anatomische Rekonstruktion und e<strong>in</strong>e rasche Bewegungsfreigabe gewährleistet. Schon<br />
nach den ersten Ergebnissen bei noch recht kle<strong>in</strong>er Fallzahl zeigen sich ausschliesslich gute Operationsresultate.<br />
Die 3,5-mm-Rekoplatte zeigt komplikationsträchtigere Verläufe. Daher sehen wir die LCP<br />
als der Rekoplatte überlegen an.<br />
70.19<br />
Peri-implant fractures of the femur: a challenge <strong>in</strong> treatment<br />
M. Gloyer, M. Rud<strong>in</strong>, T. Hotz, K. Käch (W<strong>in</strong>terthur)<br />
Objective: With the ag<strong>in</strong>g population the number of femur fractures and with this the number of femoral<br />
implants is <strong>in</strong>creas<strong>in</strong>g. Periprosthetic fractures <strong>in</strong> contrast to peri-implant fractures are well-known<br />
and there are therapeutic strategies available. Fractures neighbour<strong>in</strong>g implants present special fixation<br />
challenges. The orig<strong>in</strong>al placement of the implant may predispose to later fractures, and the implant<br />
itself may <strong>in</strong>terfere with heal<strong>in</strong>g or the placement of other fixation devices. Elderly patients often present<br />
with diseases like cancer and osteoporosis which are additional risk factors for peri-implant fractures.<br />
Methods: We present a case series of five patients with peri-implant fractures of the femur. Four with<br />
a previous <strong>in</strong>tramedullary nail fixation and one with a plate osteosynthesis. Two of these patients suffered<br />
from metastatic cancer disease; one had severe osteoporosis, two patients were without any<br />
predispos<strong>in</strong>g diseases. All patients were treated operatively. In two cases we performed an osteosynthesis<br />
with lock<strong>in</strong>g compression plates, one patient was treated with a long proximal femur nail (PFN),<br />
and one patient was treated with a comb<strong>in</strong>ation of both. The fifth patient was treated with a regular<br />
<strong>in</strong>tramedullary nail after remov<strong>in</strong>g the PFN.<br />
Results: The decision of the operative strategy depended on proximal fracture consolidation: If the proximal<br />
fracture was consolidated: Removal of the PFN and implantation of a regular <strong>in</strong>tramedullary nail.<br />
If the proximal fracture was not consolidated and the peri-implant fracture was near the PFN: Removal<br />
of the regular PFN and replacement with a long PFN. If the proximal fracture was not consolidated<br />
and distal to the PFN: Implantation of a long LCP overlapp<strong>in</strong>g the PFN. Periodical Rx controls were<br />
performed. Up to now only one further peri-implant fracture <strong>in</strong> the collective occurred.<br />
Conclusion: In this advanced age group non-operative fracture treatment requir<strong>in</strong>g long bed rest is<br />
not a reasonable option. Stabilization options <strong>in</strong>clude <strong>in</strong>tra- or extramedullary devices such as nails or<br />
plates. Full weight bear<strong>in</strong>g stability is desirable, but not always possible. Surgical treatment is technically<br />
challeng<strong>in</strong>g, stable implant anchorage can be difficult due to poor bone quality. Expanded operation<br />
time and high blood loss may present additional challenges <strong>in</strong> the perioperative management of<br />
this vulnerable patient group.<br />
Figure 1, case 1: preoperative Rx Figure 2: postoperative Rx after implantation of<br />
an <strong>in</strong>tramedullary nail (long PFN)<br />
Figure 3a, case 2: preopertive Rx Figure 3b: preoperative Rx<br />
Figure 4: postoperative Rx after implantation of Figure 5, case 3: preoperative Rx<br />
a lock<strong>in</strong>g compression plate<br />
swiss <strong>knife</strong> 2010; 7: special edition 61