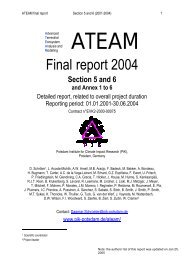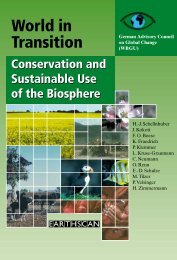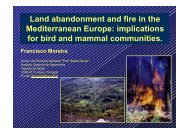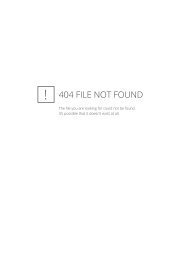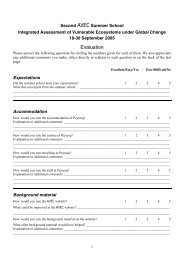Das Dust-Bowl-Syndrom in Deutschland - Potsdam Institute for ...
Das Dust-Bowl-Syndrom in Deutschland - Potsdam Institute for ...
Das Dust-Bowl-Syndrom in Deutschland - Potsdam Institute for ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ursprüngliche QDgl-Ansatz von Kuipers ist wesentlich durch Clancy, Berleant und Kay weiterentwickelt worden.<br />
Hier s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere die Methoden des semiquantitativen Schließens (Q2, Q3 und NSIM; Kay 1996,<br />
Berleant/Kuipers 1998) und der Reduktion der Zahl der zu betrachtenden Fälle (chatter-box abstraction; Clancy<br />
1997), zu nennen. Auch die Ansätze zur Zerlegung hochkomplexer Modelle (DecSIM) und zur E<strong>in</strong>führung<br />
zeitabhängiger Bed<strong>in</strong>gungen (TeQSIM) s<strong>in</strong>d wichtige Schritte zur Anwendbarkeit von QSIM. Interessant ist <strong>in</strong><br />
diesem Zusammenhang auch die Arbeit zur Sicherheitsverifikation von Systemen, bei der mit Hilfe von QSIM<br />
Bed<strong>in</strong>gungen gefunden werden, die verh<strong>in</strong>dern, daß e<strong>in</strong> System <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Katastrophenzone gerät (Loeser et al.<br />
1998).<br />
Diese Verfahren s<strong>in</strong>d bislang noch nicht zur Modellierung globaler oder regionaler Umweltveränderungen<br />
herangezogen worden. Gleichwohl eignen sie sich sehr gut für e<strong>in</strong>en qualitativ orientierten Zugang, weil sie auf<br />
der e<strong>in</strong>en Seite zwar den grundsätzlichen Gedanken funktionaler Abhängigkeiten (objektsprachlich: von Ursache-<br />
Wirkungsbeziehungen) aufrechterhalten und durch die Konzepte der Landmarks (Markste<strong>in</strong>e) und der Monotonie<br />
von Abhängigkeitsbeziehungen auch präzisieren, andererseits aber nicht auf exakte Quantifizierungen von<br />
Zusammenhängen angewiesen s<strong>in</strong>d, sondern e<strong>in</strong>e ganze Schar möglicher qualitativer Gesetzmäßigkeiten dann als<br />
gleich behandeln, wenn das durch die Markste<strong>in</strong>e und Monotonien def<strong>in</strong>ierte Systemverhalten gleich bleibt. Was<br />
aus der Perspektive quantitativ exakt festgelegter Funktionszusammenhänge als Manko ersche<strong>in</strong>en könnte - daß<br />
qualitative Differentialgleichungen nur e<strong>in</strong> ungefähres Systemverhalten def<strong>in</strong>ieren - ersche<strong>in</strong>t aus der Sicht des <strong>in</strong><br />
diesem Projekt zu bearbeitenden Problems geradezu als Stärke: die aus dieser Problem<strong>for</strong>mulierung deduzierten<br />
qualitativen Zeitverläufe bilden ähnliche Klassen von Dynamiken des Mensch-Umweltsystems ab und kommen<br />
damit strukturell dem Projektziel der Typisierung vergleichbarer Fälle nah. Dieser Formalismus versetzt e<strong>in</strong>en<br />
dadurch <strong>in</strong> die Lage, etwas zu tun, was viele regionalen Fallstudien häufig auch dann unterlassen, wenn sie mit<br />
expliziten Modellen der vor Ort wirksamen Mechanismen arbeiten: die Dynamik und die möglichen Verläufe zu<br />
bedenken, die sich aus dem angenommenen Strukturmodell noch ergeben können, <strong>in</strong> der Regel aber nicht<br />
berücksichtigt werden.<br />
Bei der Verwendung qualitativer Differentialgleichungen (QDGln) (Kuipers 1994; zur Anwendung auf den<br />
Globalen Wandel s. Petschel-Held et al 1999; Diskussion über mögliche Anwendungen <strong>in</strong> der Geographie s.<br />
Frank 1996) werden neben den <strong>in</strong> den Beziehungsgeflechten enthaltenen Vorzeichen der Wechselwirkungen im<br />
wesentlichen nur Annahmen über sog. Meilenste<strong>in</strong>e und deren Korrespondenz benötigt, an denen e<strong>in</strong>e qualitative<br />
Änderung der beschriebenen Wechselwirkung hypothetisiert wird. Es ist nicht er<strong>for</strong>derlich, quantitative Werte für<br />
diese Meilenste<strong>in</strong>e zu ermitteln: es reicht h<strong>in</strong>, von ihrer Existenz auszugehen.<br />
Im allgeme<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne QDGln zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bestimmt, die mit den aus den<br />
empirischen Untersuchungen ermittelten Entwicklungen zu vergleichen s<strong>in</strong>d. Wichtig <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
ist die für die Lösung von QDglm relativ neu entwickelte Methode der Chatter-Box-Abstraction (Clancey 1997),<br />
vermittels derer e<strong>in</strong>e deutliche Reduktion der Zahl möglicher Systemverhalten gel<strong>in</strong>gt. Es ist zu erwarten, daß die<br />
Zahl der möglichen Lösungen des qualitativen Differentialgleichungssystems trotz Verwendung dieser und<br />
ähnlicher Abstraktionsmethoden hoch ist.<br />
Aber auch diese arrivierte Form der mathematischen Analyse er<strong>for</strong>dert zunächst die Kondensierung des Ursache-<br />
Wirkungsgeflechts auf se<strong>in</strong>en kybernetischen (d.h. die gegenseitigen Regelungsbeziehungen betreffenden) Kern.<br />
In Abbildung 4.1 wird dieser dynamische Kern des <strong>Syndrom</strong>s iterativ entwickelt und schrittweise analysiert,<br />
wobei zunächst das kybernetische Konzept e<strong>in</strong>es Agrarsektors unter Marktbed<strong>in</strong>gungen diskutiert wird (Abb. 4.1,<br />
A), im nächsten Schritt dann zusätzlich der Umweltaspekt Berücksichtigung f<strong>in</strong>det (Abb. 4.1, B) wird und<br />
schließlich die Aspekte der Markordnung e<strong>in</strong>geführt werden (Abb. 4.1, C).<br />
50