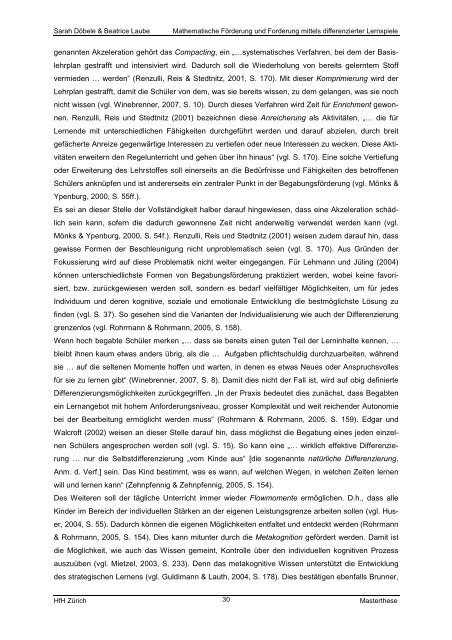Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sarah Döbele & Beatrice Laube <strong>Mathematische</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>und</strong> <strong>Forderung</strong> <strong>mittels</strong> differenzierter Lernspiele<br />
genannten Akzeleration gehört das Compacting, ein „…systematisches Verfahren, bei dem der Basis-<br />
lehrplan gestrafft <strong>und</strong> intensiviert wird. Dadurch soll die Wiederholung von bereits gelerntem Stoff<br />
vermieden … werden“ (Renzulli, Reis & Stedtnitz, 2001, S. 170). Mit dieser Komprimierung wird der<br />
Lehrplan gestrafft, damit die Schüler von dem, was sie bereits wissen, zu dem gelangen, was sie noch<br />
nicht wissen (vgl. Winebrenner, 2007, S. 10). Durch dieses Verfahren wird Zeit für Enrichment gewon-<br />
nen. Renzulli, Reis <strong>und</strong> Stedtnitz (2001) bezeichnen diese Anreicherung als Aktivitäten, „… die für<br />
Lernende mit unterschiedlichen Fähigkeiten durchgeführt werden <strong>und</strong> darauf abzielen, durch breit<br />
gefächerte Anreize gegenwärtige Interessen zu vertiefen oder neue Interessen zu wecken. Diese Akti-<br />
vitäten erweitern den Regelunterricht <strong>und</strong> gehen über ihn hinaus“ (vgl. S. 170). Eine solche Vertiefung<br />
oder Erweiterung des Lehrstoffes soll einerseits an die Bedürfnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten des betroffenen<br />
Schülers anknüpfen <strong>und</strong> ist andererseits ein zentraler Punkt in der Begabungsförderung (vgl. Mönks &<br />
Ypenburg, 2000, S. 55ff.).<br />
Es sei an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass eine Akzeleration schäd-<br />
lich sein kann, sofern die dadurch gewonnene Zeit nicht anderweitig verwendet werden kann (vgl.<br />
Mönks & Ypenburg, 2000, S. 54f.). Renzulli, Reis <strong>und</strong> Stedtnitz (2001) weisen zudem darauf hin, dass<br />
gewisse Formen der Beschleunigung nicht unproblematisch seien (vgl. S. 170). Aus Gründen der<br />
Fokussierung wird auf diese Problematik nicht weiter eingegangen. Für Lehmann <strong>und</strong> Jüling (2004)<br />
können unterschiedlichste Formen von Begabungsförderung praktiziert werden, wobei keine favori-<br />
siert, bzw. zurückgewiesen werden soll, sondern es bedarf vielfältiger Möglichkeiten, um für jedes<br />
Individuum <strong>und</strong> deren kognitive, soziale <strong>und</strong> emotionale Entwicklung die bestmöglichste Lösung zu<br />
finden (vgl. S. 37). So gesehen sind die Varianten der Individualisierung wie auch der Differenzierung<br />
grenzenlos (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 158).<br />
Wenn hoch begabte Schüler merken „… dass sie bereits einen guten Teil der Lerninhalte kennen, …<br />
bleibt ihnen kaum etwas anders übrig, als die … Aufgaben pflichtschuldig durchzuarbeiten, während<br />
sie … auf die seltenen Momente hoffen <strong>und</strong> warten, in denen es etwas Neues oder Anspruchsvolles<br />
für sie zu lernen gibt“ (Winebrenner, 2007, S. 8). Damit dies nicht der Fall ist, wird auf obig definierte<br />
Differenzierungsmöglichkeiten zurückgegriffen. „In der Praxis bedeutet dies zunächst, dass Begabten<br />
ein Lernangebot mit hohem Anforderungsniveau, grosser Komplexität <strong>und</strong> weit reichender Autonomie<br />
bei der Bearbeitung ermöglicht werden muss“ (Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 159). Edgar <strong>und</strong><br />
Walcroft (2002) weisen an dieser Stelle darauf hin, dass möglichst die Begabung eines jeden einzel-<br />
nen Schülers angesprochen werden soll (vgl. S. 15). So kann eine „… wirklich effektive Differenzie-<br />
rung … nur die Selbstdifferenzierung „vom Kinde aus“ [die sogenannte natürliche Differenzierung,<br />
Anm. d. Verf.] sein. Das Kind bestimmt, was es wann, auf welchen Wegen, in welchen Zeiten lernen<br />
will <strong>und</strong> lernen kann“ (Zehnpfennig & Zehnpfennig, 2005, S. 154).<br />
Des Weiteren soll der tägliche Unterricht immer wieder Flowmomente ermöglichen. D.h., dass alle<br />
Kinder im Bereich der individuellen Stärken an der eigenen Leistungsgrenze arbeiten sollen (vgl. Hus-<br />
er, 2004, S. 55). Dadurch können die eigenen Möglichkeiten entfaltet <strong>und</strong> entdeckt werden (Rohrmann<br />
& Rohrmann, 2005, S. 154). Dies kann mitunter durch die Metakognition gefördert werden. Damit ist<br />
die Möglichkeit, wie auch das Wissen gemeint, Kontrolle über den individuellen kognitiven Prozess<br />
auszuüben (vgl. Mietzel, 2003, S. 233). Denn das metakognitive Wissen unterstützt die Entwicklung<br />
des strategischen Lernens (vgl. Guldimann & Lauth, 2004, S. 178). Dies bestätigen ebenfalls Brunner,<br />
HfH Zürich 30<br />
Masterthese