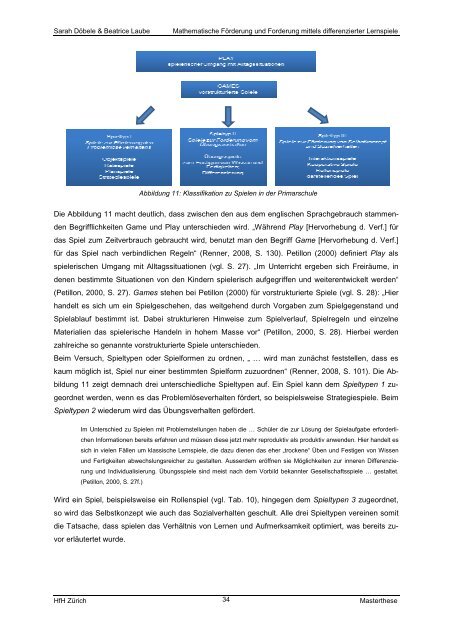Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Mathematische Förderung und Forderung mittels ... - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sarah Döbele & Beatrice Laube <strong>Mathematische</strong> <strong>Förderung</strong> <strong>und</strong> <strong>Forderung</strong> <strong>mittels</strong> differenzierter Lernspiele<br />
Die Abbildung 11 macht deutlich, dass zwischen den aus dem englischen Sprachgebrauch stammen-<br />
den Begrifflichkeiten Game <strong>und</strong> Play unterschieden wird. „Während Play [Hervorhebung d. Verf.] für<br />
das Spiel zum Zeitverbrauch gebraucht wird, benutzt man den Begriff Game [Hervorhebung d. Verf.]<br />
für das Spiel nach verbindlichen Regeln“ (Renner, 2008, S. 130). Petillon (2000) definiert Play als<br />
spielerischen Umgang mit Alltagssituationen (vgl. S. 27). „Im Unterricht ergeben sich Freiräume, in<br />
denen bestimmte Situationen von den Kindern spielerisch aufgegriffen <strong>und</strong> weiterentwickelt werden“<br />
(Petillon, 2000, S. 27). Games stehen bei Petillon (2000) für vorstrukturierte Spiele (vgl. S. 28): „Hier<br />
handelt es sich um ein Spielgeschehen, das weitgehend durch Vorgaben zum Spielgegenstand <strong>und</strong><br />
Spielablauf bestimmt ist. Dabei strukturieren Hinweise zum Spielverlauf, Spielregeln <strong>und</strong> einzelne<br />
Materialien das spielerische Handeln in hohem Masse vor“ (Petillon, 2000, S. 28). Hierbei werden<br />
zahlreiche so genannte vorstrukturierte Spiele unterschieden.<br />
Beim Versuch, Spieltypen oder Spielformen zu ordnen, „ … wird man zunächst feststellen, dass es<br />
kaum möglich ist, Spiel nur einer bestimmten Spielform zuzuordnen“ (Renner, 2008, S. 101). Die Ab-<br />
bildung 11 zeigt demnach drei unterschiedliche Spieltypen auf. Ein Spiel kann dem Spieltypen 1 zu-<br />
geordnet werden, wenn es das Problemlöseverhalten fördert, so beispielsweise Strategiespiele. Beim<br />
Spieltypen 2 wiederum wird das Übungsverhalten gefördert.<br />
Im Unterschied zu Spielen mit Problemstellungen haben die … Schüler die zur Lösung der Spielaufgabe erforderli-<br />
chen Informationen bereits erfahren <strong>und</strong> müssen diese jetzt mehr reproduktiv als produktiv anwenden. Hier handelt es<br />
sich in vielen Fällen um klassische Lernspiele, die dazu dienen das eher „trockene“ Üben <strong>und</strong> Festigen von Wissen<br />
<strong>und</strong> Fertigkeiten abwechslungsreicher zu gestalten. Ausserdem eröffnen sie Möglichkeiten zur inneren Differenzie-<br />
rung <strong>und</strong> Individualisierung. Übungsspiele sind meist nach dem Vorbild bekannter Gesellschaftsspiele … gestaltet.<br />
(Petillon, 2000, S. 27f.)<br />
Wird ein Spiel, beispielsweise ein Rollenspiel (vgl. Tab. 10), hingegen dem Spieltypen 3 zugeordnet,<br />
so wird das Selbstkonzept wie auch das Sozialverhalten geschult. Alle drei Spieltypen vereinen somit<br />
die Tatsache, dass spielen das Verhältnis von Lernen <strong>und</strong> Aufmerksamkeit optimiert, was bereits zu-<br />
vor erläutertet wurde.<br />
Abbildung 11: Klassifikation zu Spielen in der Primarschule<br />
HfH Zürich 34<br />
Masterthese