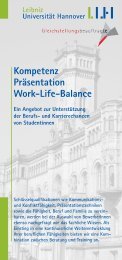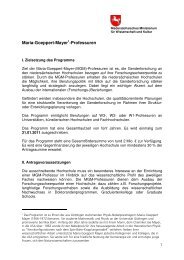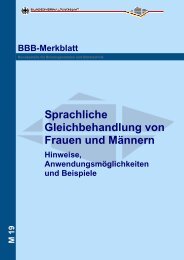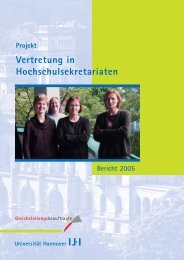Mentoring - Gleichstellungsbüro der Leibniz Universität Hannover
Mentoring - Gleichstellungsbüro der Leibniz Universität Hannover
Mentoring - Gleichstellungsbüro der Leibniz Universität Hannover
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Altersstruktur <strong>der</strong> Mentor/innen<br />
10<br />
5<br />
0<br />
36-40 41-45 46-50 51-55 55-65<br />
(Daten aus: Abschlussfragebogen Mentor/innen)<br />
Die Mentor/innen stellten fest, dass sich<br />
im Laufe <strong>der</strong> Zeit ein Vertrauensverhältnis<br />
entwickelte, welches hauptsächlich auf<br />
die konsequente Strukturierung und Zielorientierung<br />
in <strong>der</strong> Partnerschaft zurückzuführen<br />
war. So konnten auch persönliche<br />
Interessen erörtert werden, die neben<br />
fachlichen Entscheidungen ebenfalls<br />
erheblichen Einfluss auf berufliche Entwicklungen<br />
haben. Das trug für alle Beteiligten<br />
zu dem Gefühl bei, sich gegenseitig<br />
etwas geben zu können.<br />
M entoring<br />
Bausteine des Wissensmanagements<br />
Der Ansatz <strong>der</strong> Bausteine des Wissensmanagements nach Probst/Raub/Romhardt<br />
ist ein in <strong>der</strong> Praxis häufig verwendeter ganzheitlicher Ansatz, <strong>der</strong> durch seine<br />
Aufglie<strong>der</strong>ung in einzelne Wissensmanagement-Bausteine es PraktikerInnen ermöglicht,<br />
Wissensprobleme in ihren Organisationen besser einordnen, verstehen und<br />
lösen zu können. Dieser Ansatz soll deshalb im folgenden näher dargestellt werden:“<br />
Texte zu den Bausteinen des Wissensmanagements:<br />
Wissensziele: Wissensziele sind richtungsweisend für den gesamten Wissensmanagementprozess<br />
und ergänzen die (klassischen) Organisationsziele. Sie stellen<br />
die Basis für die Ermittlung des Wissensbedarfs sowie für Einschätzungen und Kontrollaktivitäten<br />
dar.<br />
Wissensidentifikation: Das interne und externe Wissensumfeld wird analysiert<br />
und erfor<strong>der</strong>liche Fähigkeiten werden definiert. Es ist aufzuzeigen, wo welches<br />
Wissen vorliegt.<br />
Wissenserwerb: Wissensdefizite können gegebenenfalls durch Erwerb externen<br />
Wissens geschlossen werden. Aufgabe des Wissensmanagements ist es hier, relevantes<br />
externes Wissen zu importieren und zu integrieren.<br />
Wissensentwicklung: Wissensentwicklung ergänzt das Aufgabenfeld des Wissenserwerbs<br />
um den (ständigen) Aufbau neuen, unternehmensintern noch nicht vorhandenen<br />
Wissens. Hier steht die bewusste Erzeugung neuer bzw. besserer Fähigkeiten,<br />
Produkte/Dienstleistungen und Prozesse im Mittelpunkt.“<br />
Wissens(ver)teilung: Die Verteilung von Wissen in <strong>der</strong> Organisation ist die zwingende<br />
Voraussetzung, um isoliert vorhandene Informationen o<strong>der</strong> Erfahrungen für<br />
die gesamte Organisation nutzbar zu machen.<br />
Wissensnutzung: Die zielorientierte Anwendung des Wissens erzeugt erst den<br />
eigentlichen Nutzen für die Organisation. Das identifizierte, erworbene o<strong>der</strong> entwickelte<br />
Wissen soll nun auch konsequent angewendet werden.“<br />
Wissensbewahrung: Der Baustein Wissensbewahrung betrifft den Erhalt relevanten<br />
Wissens durch Nutzung angemessener Speichermedien. Aufgaben <strong>der</strong><br />
Wissensbewahrung umfassen die gezielte Auswahl, Aufbereitung, Speicherung und<br />
Aktualisierung von Wissen.<br />
Wissensmessung und Wissensbewertung: Die Durchführung einer Wissensbewertung<br />
schließt den Wissensmanagement-Kreislauf und liefert Rückmeldungen<br />
für Analysen und Interventionen in den Wissensmanagementprozess.<br />
Mit <strong>der</strong> Zeit wird das Lösen einer schweren Aufgabe zur Routine, so dass das<br />
Wissen - wie man eine solche Aufgabe zu lösen hat - zum Selbstverständnis (implizites<br />
Wissen [F]) wird. Mit <strong>der</strong> Zeit wird das Bewältigen einer solchen Aufgabe so<br />
normal, dass gar nicht mehr bewusst wird, dass für die Lösung des Problems ganz<br />
bestimmtes Wissen gebraucht wird.<br />
Die verschieden Stufen des Wissensaufbaus kann man in vier Schritte glie<strong>der</strong>n:<br />
a Weiss nicht, was er nicht weiss - Unbewusste Inkompetenz<br />
b Weiss, was er nicht weiss - Bewusste Inkompetenz<br />
c Weiss, was er weiss - Bewusste Kompetenz<br />
d Weiss nicht, was er weiss - Unbewusste Kompetenz<br />
Quelle: http://www.net-working.de/wbt/8bausteine.htm<br />
13