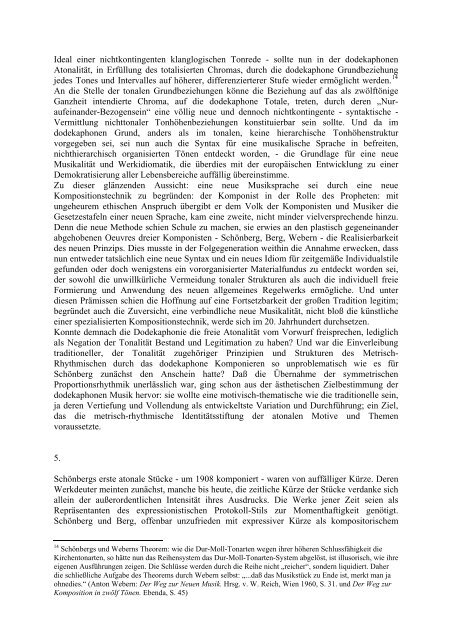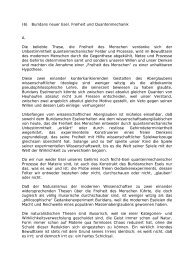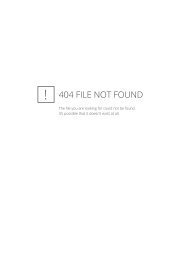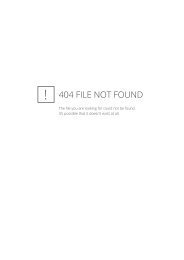ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ideal einer nichtkontingenten klanglogischen Tonrede - sollte nun in der dodekaphonen<br />
Atonalität, in Erfüllung des totalisierten Chromas, durch die dodekaphone Grundbeziehung<br />
jedes Tones und Intervalles auf höherer, differenzierterer Stufe wieder ermöglicht werden. 14<br />
An die Stelle der tonalen Grundbeziehungen könne die Beziehung auf das als zwölftönige<br />
Ganzheit intendierte Chroma, auf die dodekaphone Totale, treten, durch deren „Nuraufeinander-Bezogensein“<br />
eine völlig neue und dennoch nichtkontingente - syntaktische -<br />
Vermittlung nichttonaler Tonhöhenbeziehungen konstituierbar sein sollte. Und da im<br />
dodekaphonen Grund, anders als im tonalen, keine hierarchische Tonhöhenstruktur<br />
vorgegeben sei, sei nun auch die Syntax für eine musikalische Sprache in befreiten,<br />
nichthierarchisch organisierten Tönen entdeckt worden, - die Grundlage für eine neue<br />
Musikalität und Werkidiomatik, die überdies mit der europäischen Entwicklung zu einer<br />
Demokratisierung aller Lebensbereiche auffällig übereinstimme.<br />
Zu dieser glänzenden Aussicht: eine neue Musiksprache sei durch eine neue<br />
Kompositionstechnik zu begründen: der Komponist in der Rolle des Propheten: mit<br />
ungeheurem ethischen Anspruch übergibt er dem Volk der Komponisten und Musiker die<br />
Gesetzestafeln einer neuen Sprache, kam eine zweite, nicht minder vielversprechende hinzu.<br />
Denn die neue Methode schien Schule zu machen, sie erwies an den plastisch gegeneinander<br />
abgehobenen Oeuvres dreier Komponisten - Schönberg, Berg, Webern - die Realisierbarkeit<br />
des neuen Prinzips. Dies musste in der Folgegeneration weithin die Annahme erwecken, dass<br />
nun entweder tatsächlich eine neue Syntax und ein neues Idiom für zeitgemäße Individualstile<br />
gefunden oder doch wenigstens ein vororganisierter Materialfundus zu entdeckt worden sei,<br />
der sowohl die unwillkürliche Vermeidung tonaler Strukturen als auch die individuell freie<br />
Formierung und Anwendung des neuen allgemeines Regelwerks ermögliche. Und unter<br />
diesen Prämissen schien die Hoffnung auf eine Fortsetzbarkeit der großen Tradition legitim;<br />
begründet auch die Zuversicht, eine verbindliche neue Musikalität, nicht bloß die künstliche<br />
einer spezialisierten Kompositionstechnik, werde sich im <strong>20</strong>. Jahrhundert durchsetzen.<br />
Konnte demnach die Dodekaphonie die freie Atonalität vom Vorwurf freisprechen, lediglich<br />
als Negation der Tonalität Bestand und Legitimation zu haben? Und war die Einverleibung<br />
traditioneller, der Tonalität zugehöriger Prinzipien und Strukturen des Metrisch-<br />
Rhythmischen durch das dodekaphone Komponieren so unproblematisch wie es für<br />
Schönberg zunächst den Anschein hatte? Daß die Übernahme der symmetrischen<br />
Proportionsrhythmik unerlässlich war, ging schon aus der ästhetischen Zielbestimmung der<br />
dodekaphonen Musik hervor: sie wollte eine motivisch-thematische wie die traditionelle sein,<br />
ja deren Vertiefung und Vollendung als entwickeltste Variation und Durchführung; ein Ziel,<br />
das die metrisch-rhythmische Identitätsstiftung der atonalen Motive und Themen<br />
voraussetzte.<br />
5.<br />
Schönbergs erste atonale Stücke - um 1908 komponiert - waren von auffälliger Kürze. Deren<br />
Werkdeuter meinten zunächst, manche bis heute, die zeitliche Kürze der Stücke verdanke sich<br />
allein der außerordentlichen Intensität ihres Ausdrucks. Die Werke jener Zeit seien als<br />
Repräsentanten des expressionistischen Protokoll-Stils zur Momenthaftigkeit genötigt.<br />
Schönberg und Berg, offenbar unzufrieden mit expressiver Kürze als kompositorischem<br />
14 Schönbergs und Weberns Theorem: wie die Dur-Moll-Tonarten wegen ihrer höheren Schlussfähigkeit die<br />
Kirchentonarten, so hätte nun das Reihensystem das Dur-Moll-Tonarten-System abgelöst, ist illusorisch, wie ihre<br />
eigenen Ausführungen zeigen. Die Schlüsse werden durch die Reihe nicht „reicher“, sondern liquidiert. Daher<br />
die schließliche Aufgabe des Theorems durch Webern selbst: „...daß das Musikstück zu Ende ist, merkt man ja<br />
ohnedies.“ (Anton Webern: Der Weg zur Neuen Musik. Hrsg. v. W. Reich, Wien 1960, S. 31. und Der Weg zur<br />
Komposition in zwölf Tönen. Ebenda, S. 45)