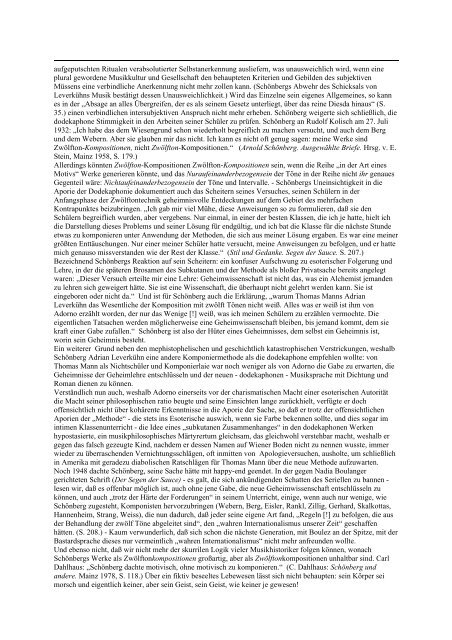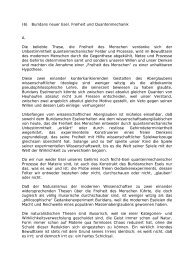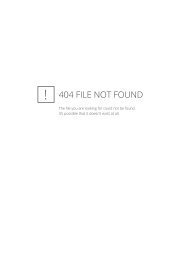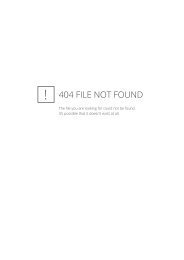ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
aufgeputschten Ritualen verabsolutierter Selbstanerkennung ausliefern, was unausweichlich wird, wenn eine<br />
plural gewordene Musikkultur und Gesellschaft den behaupteten Kriterien und Gebilden des subjektiven<br />
Müssens eine verbindliche Anerkennung nicht mehr zollen kann. (Schönbergs Abwehr des Schicksals von<br />
Leverkühns Musik bestätigt dessen Unausweichlichkeit.) Wird das Einzelne sein eigenes Allgemeines, so kann<br />
es in der „Absage an alles Übergreifen, der es als seinem Gesetz unterliegt, über das reine Diesda hinaus“ (S.<br />
35.) einen verbindlichen intersubjektiven Anspruch nicht mehr erheben. Schönberg weigerte sich schließlich, die<br />
dodekaphone Stimmigkeit in den Arbeiten seiner Schüler zu prüfen. Schönberg an Rudolf Kolisch am 27. Juli<br />
1932: „Ich habe das dem Wiesengrund schon wiederholt begreiflich zu machen versucht, und auch dem Berg<br />
und dem Webern. Aber sie glauben mir das nicht. Ich kann es nicht oft genug sagen: meine Werke sind<br />
Zwölfton-Kompositionen, nicht Zwölfton-Kompositionen.“ (Arnold Schönberg. Ausgewählte Briefe. Hrsg. v. E.<br />
Stein, Mainz 1958, S. 179.)<br />
Allerdings könnten Zwölfton-Kompositionen Zwölfton-Kompositionen sein, wenn die Reihe „in der Art eines<br />
Motivs“ Werke generieren könnte, und das Nuraufeinanderbezogensein der Töne in der Reihe nicht ihr genaues<br />
Gegenteil wäre: Nichtaufeinanderbezogensein der Töne und Intervalle. - Schönbergs Uneinsichtigkeit in die<br />
Aporie der Dodekaphonie dokumentiert auch das Scheitern seines Versuches, seinen Schülern in der<br />
Anfangsphase der Zwölftontechnik geheimnisvolle Entdeckungen auf dem Gebiet des mehrfachen<br />
Kontrapunktes beizubringen. „Ich gab mir viel Mühe, diese Anweisungen so zu formulieren, daß sie den<br />
Schülern begreiflich wurden, aber vergebens. Nur einmal, in einer der besten Klassen, die ich je hatte, hielt ich<br />
die Darstellung dieses Problems und seiner Lösung für endgültig, und ich bat die Klasse für die nächste Stunde<br />
etwas zu komponieren unter Anwendung der Methoden, die sich aus meiner Lösung ergaben. Es war eine meiner<br />
größten Enttäuschungen. Nur einer meiner Schüler hatte versucht, meine Anweisungen zu befolgen, und er hatte<br />
mich genauso missverstanden wie der Rest der Klasse.“ (Stil und Gedanke. Segen der Sauce. S. <strong>20</strong>7.)<br />
Bezeichnend Schönbergs Reaktion auf sein Scheitern: ein konfuser Aufschwung zu esoterischer Folgerung und<br />
Lehre, in der die späteren Brosamen des Subkutanen und der Methode als bloßer Privatsache bereits angelegt<br />
waren: „Dieser Versuch erteilte mir eine Lehre: Geheimwissenschaft ist nicht das, was ein Alchemist jemanden<br />
zu lehren sich geweigert hätte. Sie ist eine Wissenschaft, die überhaupt nicht gelehrt werden kann. Sie ist<br />
eingeboren oder nicht da.“ Und ist für Schönberg auch die Erklärung, „warum Thomas Manns Adrian<br />
Leverkühn das Wesentliche der Komposition mit zwölft Tönen nicht weiß. Alles was er weiß ist ihm von<br />
Adorno erzählt worden, der nur das Wenige [!] weiß, was ich meinen Schülern zu erzählen vermochte. Die<br />
eigentlichen Tatsachen werden möglicherweise eine Geheimwissenschaft bleiben, bis jemand kommt, dem sie<br />
kraft einer Gabe zufallen.“ Schönberg ist also der Hüter eines Geheimnisses, dem selbst ein Geheimnis ist,<br />
worin sein Geheimnis besteht.<br />
Ein weiterer Grund neben den mephistophelischen und geschichtlich katastrophischen Verstrickungen, weshalb<br />
Schönberg Adrian Leverkühn eine andere Komponiermethode als die dodekaphone empfehlen wollte: von<br />
Thomas Mann als Nichtschüler und Komponierlaie war noch weniger als von Adorno die Gabe zu erwarten, die<br />
Geheimnisse der Geheimlehre entschlüsseln und der neuen - dodekaphonen - Musiksprache mit Dichtung und<br />
Roman dienen zu können.<br />
Verständlich nun auch, weshalb Adorno einerseits vor der charismatischen Macht einer esoterischen Autorität<br />
die Macht seiner philosophischen ratio beugte und seine Einsichten lange zurückhielt, verfügte er doch<br />
offensichtlich nicht über kohärente Erkenntnisse in die Aporie der Sache, so daß er trotz der offensichtlichen<br />
Aporien der „Methode“ - die stets ins Esoterische auswich, wenn sie Farbe bekennen sollte, und dies sogar im<br />
intimen Klassenunterricht - die Idee eines „subkutanen Zusammenhanges“ in den dodekaphonen Werken<br />
hypostasierte, ein musikphilosophisches Märtyrertum gleichsam, das gleichwohl verstehbar macht, weshalb er<br />
gegen das falsch gezeugte Kind, nachdem er dessen Namen auf Wiener Boden nicht zu nennen wusste, immer<br />
wieder zu überraschenden Vernichtungsschlägen, oft inmitten von Apologieversuchen, ausholte, um schließlich<br />
in Amerika mit geradezu diabolischen Ratschlägen für Thomas Mann über die neue Methode aufzuwarten.<br />
Noch 1948 dachte Schönberg, seine Sache hätte mit happy-end geendet. In der gegen Nadia Boulanger<br />
gerichteten Schrift (Der Segen der Sauce) - es galt, die sich ankündigenden Schatten des Seriellen zu bannen -<br />
lesen wir, daß es offenbar möglich ist, auch ohne jene Gabe, die neue Geheimwissenschaft entschlüsseln zu<br />
können, und auch „trotz der Härte der Forderungen“ in seinem Unterricht, einige, wenn auch nur wenige, wie<br />
Schönberg zugesteht, Komponisten hervorzubringen (Webern, Berg, Eisler, Rankl, Zillig, Gerhard, Skalkottas,<br />
Hannenheim, Strang, Weiss), die nun dadurch, daß jeder seine eigene Art fand, „Regeln [!] zu befolgen, die aus<br />
der Behandlung der zwölf Töne abgeleitet sind“, den „wahren Internationalismus unserer Zeit“ geschaffen<br />
hätten. (S. <strong>20</strong>8.) - Kaum verwunderlich, daß sich schon die nächste Generation, mit Boulez an der Spitze, mit der<br />
Bastardsprache dieses nur vermeintlich „wahren Internationalismus“ nicht mehr anfreunden wollte.<br />
Und ebenso nicht, daß wir nicht mehr der skurrilen Logik vieler Musikhistoriker folgen können, wonach<br />
Schönbergs Werke als Zwölftonkompositionen großartig, aber als Zwölftonkompositionen unhaltbar sind. Carl<br />
Dahlhaus: „Schönberg dachte motivisch, ohne motivisch zu komponieren.“ (C. Dahlhaus: Schönberg und<br />
andere. Mainz 1978, S. 118.) Über ein fiktiv beseeltes Lebewesen lässt sich nicht behaupten: sein Körper sei<br />
morsch und eigentlich keiner, aber sein Geist, sein Geist, wie keiner je gewesen!