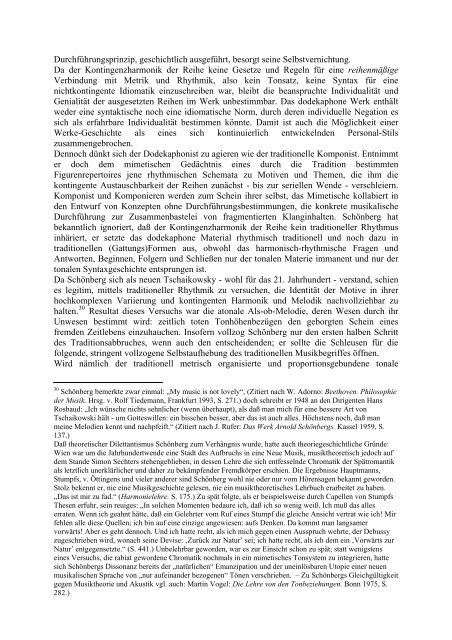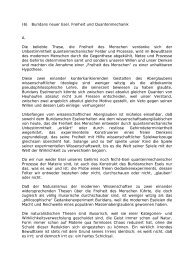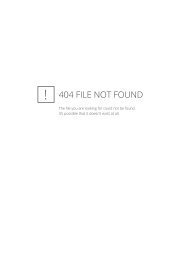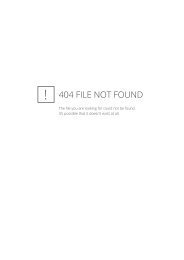ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Durchführungsprinzip, geschichtlich ausgeführt, besorgt seine Selbstvernichtung.<br />
Da der Kontingenzharmonik der Reihe keine Gesetze und Regeln für eine reihenmäßige<br />
Verbindung mit Metrik und Rhythmik, also kein Tonsatz, keine Syntax für eine<br />
nichtkontingente Idiomatik einzuschreiben war, bleibt die beanspruchte Individualität und<br />
Genialität der ausgesetzten Reihen im Werk unbestimmbar. Das dodekaphone Werk enthält<br />
weder eine syntaktische noch eine idiomatische Norm, durch deren individuelle Negation es<br />
sich als erfahrbare Individualität bestimmen könnte. Damit ist auch die Möglichkeit einer<br />
Werke-Geschichte als eines sich kontinuierlich entwickelnden Personal-Stils<br />
zusammengebrochen.<br />
Dennoch dünkt sich der Dodekaphonist zu agieren wie der traditionelle Komponist. Entnimmt<br />
er doch dem mimetischen Gedächtnis eines durch die Tradition bestimmten<br />
Figurenrepertoires jene rhythmischen Schemata zu Motiven und Themen, die ihm die<br />
kontingente Austauschbarkeit der Reihen zunächst - bis zur seriellen Wende - verschleiern.<br />
Komponist und Komponieren werden zum Schein ihrer selbst, das Mimetische kollabiert in<br />
den Entwurf von Konzepten ohne Durchführungsbestimmungen, die konkrete musikalische<br />
Durchführung zur Zusammenbastelei von fragmentierten Klanginhalten. Schönberg hat<br />
bekanntlich ignoriert, daß der Kontingenzharmonik der Reihe kein traditioneller Rhythmus<br />
inhäriert, er setzte das dodekaphone Material rhythmisch traditionell und noch dazu in<br />
traditionellen (Gattungs)Formen aus, obwohl das harmonisch-rhythmische Fragen und<br />
Antworten, Beginnen, Folgern und Schließen nur der tonalen Materie immanent und nur der<br />
tonalen Syntaxgeschichte entsprungen ist.<br />
Da Schönberg sich als neuen Tschaikowsky - wohl für das 21. Jahrhundert - verstand, schien<br />
es legitim, mittels traditioneller Rhythmik zu versuchen, die Identität der Motive in ihrer<br />
hochkomplexen Variierung und kontingenten Harmonik und Melodik nachvollziehbar zu<br />
halten. 30 Resultat dieses Versuchs war die atonale Als-ob-Melodie, deren Wesen durch ihr<br />
Unwesen bestimmt wird: zeitlich toten Tonhöhenbezügen den geborgten Schein eines<br />
fremden Zeitlebens einzuhauchen. Insofern vollzog Schönberg nur den ersten halben Schritt<br />
des Traditionsabbruches, wenn auch den entscheidenden; er sollte die Schleusen für die<br />
folgende, stringent vollzogene Selbstaufhebung des traditionellen Musikbegriffes öffnen.<br />
Wird nämlich der traditionell metrisch organisierte und proportionsgebundene tonale<br />
30 Schönberg bemerkte zwar einmal: „My music is not lovely“, (Zitiert nach W. Adorno: Beethoven. Philosophie<br />
der Musik. Hrsg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt 1993, S. 271.) doch schreibt er 1948 an den Dirigenten Hans<br />
Rosbaud: „Ich wünsche nichts sehnlicher (wenn überhaupt), als daß man mich für eine bessere Art von<br />
Tschaikowski hält - um Gotteswillen: ein bisschen besser, aber das ist auch alles. Höchstens noch, daß man<br />
meine Melodien kennt und nachpfeift.“ (Zitiert nach J. Rufer: Das Werk Arnold Schönbergs. Kassel 1959, S.<br />
137.)<br />
Daß theoretischer Dilettantismus Schönberg zum Verhängnis wurde, hatte auch theoriegeschichtliche Gründe:<br />
Wien war um die Jahrhundertwende eine Stadt des Aufbruchs in eine Neue Musik, musiktheoretisch jedoch auf<br />
dem Stande Simon Sechters stehengeblieben, in dessen Lehre die sich entfesselnde Chromatik der Spätromantik<br />
als letztlich unerklärlicher und daher zu bekämpfender Fremdkörper erschien. Die Ergebnisse Hauptmanns,<br />
Stumpfs, v. Öttingens und vieler anderer sind Schönberg wohl nie oder nur vom Hörensagen bekannt geworden.<br />
Stolz bekennt er, nie eine Musikgeschichte gelesen, nie ein musiktheoretisches Lehrbuch erarbeitet zu haben.<br />
„Das ist mir zu fad.“ (Harmonielehre. S. 175.) Zu spät folgte, als er beispielsweise durch Capellen von Stumpfs<br />
Thesen erfuhr, sein reuiges: „In solchen Momenten bedaure ich, daß ich so wenig weiß. Ich muß das alles<br />
erraten. Wenn ich geahnt hätte, daß ein Gelehrter vom Ruf eines Stumpf die gleiche Ansicht vertrat wie ich! Mir<br />
fehlen alle diese Quellen; ich bin auf eine einzige angewiesen: aufs Denken. Da kommt man langsamer<br />
vorwärts! Aber es geht dennoch. Und ich hatte recht, als ich mich gegen einen Ausspruch wehrte, der Debussy<br />
zugeschrieben wird, wonach seine Devise: ‚Zurück zur Natur’ sei; ich hatte recht, als ich dem ein ‚Vorwärts zur<br />
Natur’ entgegensetzte.“ (S. 441.) Unbelehrbar geworden, war es zur Einsicht schon zu spät; statt wenigstens<br />
eines Versuchs, die rabiat gewordene Chromatik nochmals in ein mimetisches Tonsystem zu integrieren, hatte<br />
sich Schönbergs Dissonanz bereits der „natürlichen“ Emanzipation und der uneinlösbaren Utopie einer neuen<br />
musikalischen Sprache von „nur aufeinander bezogenen“ Tönen verschrieben. – Zu Schönbergs Gleichgültigkeit<br />
gegen Musiktheorie und Akustik vgl. auch: Martin Vogel: Die Lehre von den Tonbeziehungen. Bonn 1975, S.<br />
282.)