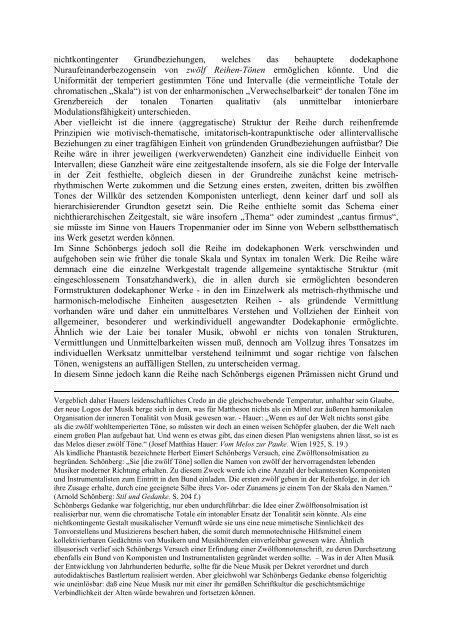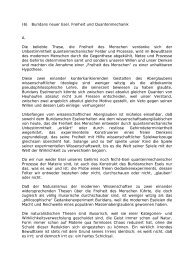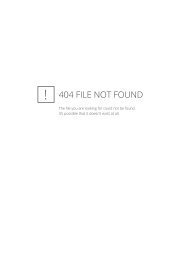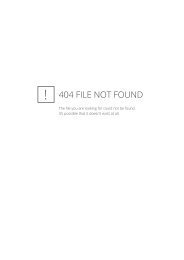ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nichtkontingenter Grundbeziehungen, welches das behauptete dodekaphone<br />
Nuraufeinanderbezogensein von zwölf Reihen-Tönen ermöglichen könnte. Und die<br />
Uniformität der temperiert gestimmten Töne und Intervalle (die vermeintliche Totale der<br />
chromatischen „Skala“) ist von der enharmonischen „Verwechselbarkeit“ der tonalen Töne im<br />
Grenzbereich der tonalen Tonarten qualitativ (als unmittelbar intonierbare<br />
Modulationsfähigkeit) unterschieden.<br />
Aber vielleicht ist die innere (aggregatische) Struktur der Reihe durch reihenfremde<br />
Prinzipien wie motivisch-thematische, imitatorisch-kontrapunktische oder allintervallische<br />
Beziehungen zu einer tragfähigen Einheit von gründenden Grundbeziehungen aufrüstbar? Die<br />
Reihe wäre in ihrer jeweiligen (werkverwendeten) Ganzheit eine individuelle Einheit von<br />
Intervallen; diese Ganzheit wäre eine zeitgestaltende insofern, als sie die Folge der Intervalle<br />
in der Zeit festhielte, obgleich diesen in der Grundreihe zunächst keine metrischrhythmischen<br />
Werte zukommen und die Setzung eines ersten, zweiten, dritten bis zwölften<br />
Tones der Willkür des setzenden Komponisten unterliegt, denn keiner darf und soll als<br />
hierarchisierender Grundton gesetzt sein. Die Reihe enthielte somit das Schema einer<br />
nichthierarchischen Zeitgestalt, sie wäre insofern „Thema“ oder zumindest „cantus firmus“,<br />
sie müsste im Sinne von Hauers Tropenmanier oder im Sinne von Webern selbstthematisch<br />
ins Werk gesetzt werden können.<br />
Im Sinne Schönbergs jedoch soll die Reihe im dodekaphonen Werk verschwinden und<br />
aufgehoben sein wie früher die tonale Skala und Syntax im tonalen Werk. Die Reihe wäre<br />
demnach eine die einzelne Werkgestalt tragende allgemeine syntaktische Struktur (mit<br />
eingeschlossenem Tonsatzhandwerk), die in allen durch sie ermöglichten besonderen<br />
Formstrukturen dodekaphoner Werke - in den im Einzelwerk als metrisch-rhythmische und<br />
harmonisch-melodische Einheiten ausgesetzten Reihen - als gründende Vermittlung<br />
vorhanden wäre und daher ein unmittelbares Verstehen und Vollziehen der Einheit von<br />
allgemeiner, besonderer und werkindividuell angewandter Dodekaphonie ermöglichte.<br />
Ähnlich wie der Laie bei tonaler Musik, obwohl er nichts von tonalen Strukturen,<br />
Vermittlungen und Unmittelbarkeiten wissen muß, dennoch am Vollzug ihres Tonsatzes im<br />
individuellen Werksatz unmittelbar verstehend teilnimmt und sogar richtige von falschen<br />
Tönen, wenigstens an auffälligen Stellen, zu unterscheiden vermag.<br />
In diesem Sinne jedoch kann die Reihe nach Schönbergs eigenen Prämissen nicht Grund und<br />
Vergeblich daher Hauers leidenschaftliches Credo an die gleichschwebende Temperatur, unhaltbar sein Glaube,<br />
der neue Logos der Musik berge sich in dem, was für Mattheson nichts als ein Mittel zur äußeren harmonikalen<br />
Organisation der inneren Tonalität von Musik gewesen war. - Hauer: „Wenn es auf der Welt nichts sonst gäbe<br />
als die zwölf wohltemperierten Töne, so müssten wir doch an einen weisen Schöpfer glauben, der die Welt nach<br />
einem großen Plan aufgebaut hat. Und wenn es etwas gibt, das einen diesen Plan wenigstens ahnen lässt, so ist es<br />
das Melos dieser zwölf Töne.“ (Josef Matthias Hauer: Vom Melos zur Pauke. Wien 1925, S. 19.)<br />
Als kindliche Phantastik bezeich<strong>net</strong>e Herbert Eimert Schönbergs Versuch, eine Zwölftonsolmisation zu<br />
begründen. Schönberg: „Sie [die zwölf Töne] sollen die Namen von zwölf der hervorragendsten lebenden<br />
Musiker moderner Richtung erhalten. Zu diesem Zweck werde ich eine Anzahl der bekanntesten Komponisten<br />
und Instrumentalisten zum Eintritt in den Bund einladen. Die ersten zwölf geben in der Reihenfolge, in der ich<br />
ihre Zusage erhalte, durch eine geeig<strong>net</strong>e Silbe ihres Vor- oder Zunamens je einem Ton der Skala den Namen.“<br />
(Arnold Schönberg: Stil und Gedanke. S. <strong>20</strong>4 f.)<br />
Schönbergs Gedanke war folgerichtig, nur eben undurchführbar: die Idee einer Zwölftonsolmisation ist<br />
realisierbar nur, wenn die chromatische Totale ein intonabler Ersatz der Tonalität sein könnte. Als eine<br />
nichtkontingente Gestalt musikalischer Vernunft würde sie uns eine neue mimetische Sinnlichkeit des<br />
Tonvorstellens und Musizierens beschert haben, die somit durch memnotechnische Hilfsmittel einem<br />
kollektivierbaren Gedächtnis von Musikern und Musikhörenden einverleibbar gewesen wäre. Ähnlich<br />
illsusorisch verlief sich Schönbergs Versuch einer Erfindung einer Zwölftonnotenschrift, zu deren Durchsetzung<br />
ebenfalls ein Bund von Komponisten und Instrumentalisten gegründet werden sollte. – Was in der Alten Musik<br />
der Entwicklung von Jahrhunderten bedurfte, sollte für die Neue Musik per Dekret verord<strong>net</strong> und durch<br />
autodidaktisches Bastlertum realisiert werden. Aber gleichwohl war Schönbergs Gedanke ebenso folgerichtig<br />
wie uneinlösbar: daß eine Neue Musik nur mit einer ihr gemäßen Schriftkultur die geschichtsmächtige<br />
Verbindlichkeit der Alten würde bewahren und fortsetzen können.