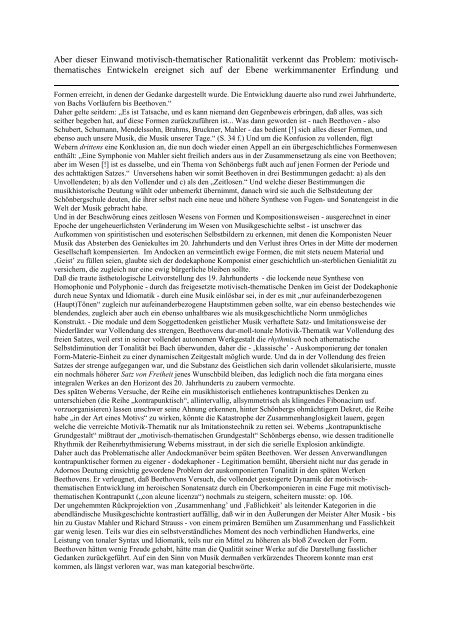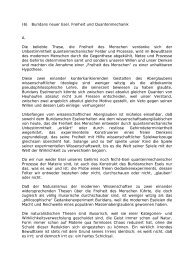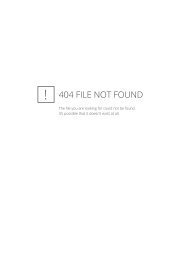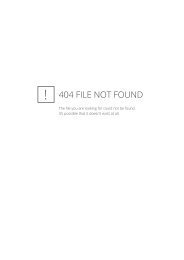ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aber dieser Einwand motivisch-thematischer Rationalität verkennt das Problem: motivischthematisches<br />
Entwickeln ereig<strong>net</strong> sich auf der Ebene werkimmanenter Erfindung und<br />
Formen erreicht, in denen der Gedanke dargestellt wurde. Die Entwicklung dauerte also rund zwei Jahrhunderte,<br />
von Bachs Vorläufern bis Beethoven.“<br />
Daher gelte seitdem: „Es ist Tatsache, und es kann niemand den Gegenbeweis erbringen, daß alles, was sich<br />
seither begeben hat, auf diese Formen zurückzuführen ist... Was dann geworden ist - nach Beethoven - also<br />
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Mahler - das bedient [!] sich alles dieser Formen, und<br />
ebenso auch unsere Musik, die Musik unserer Tage.“ (S. 34 f.) Und um die Konfusion zu vollenden, fügt<br />
Webern drittens eine Konklusion an, die nun doch wieder einen Appell an ein übergeschichtliches Formenwesen<br />
enthält: „Eine Symphonie von Mahler sieht freilich anders aus in der Zusammensetzung als eine von Beethoven;<br />
aber im Wesen [!] ist es dasselbe, und ein Thema von Schönbergs fußt auch auf jenen Formen der Periode und<br />
des achttaktigen Satzes.“ Unversehens haben wir somit Beethoven in drei Bestimmungen gedacht: a) als den<br />
Unvollendeten; b) als den Vollender und c) als den „Zeitlosen.“ Und welche dieser Bestimmungen die<br />
musikhistorische Deutung wählt oder unbemerkt übernimmt, danach wird sie auch die Selbstdeutung der<br />
Schönbergschule deuten, die ihrer selbst nach eine neue und höhere Synthese von Fugen- und Sonatengeist in die<br />
Welt der Musik gebracht habe.<br />
Und in der Beschwörung eines zeitlosen Wesens von Formen und Kompositionsweisen - ausgerech<strong>net</strong> in einer<br />
Epoche der ungeheuerlichsten Veränderung im Wesen von Musikgeschichte selbst - ist unschwer das<br />
Aufkommen von spiritistischen und esoterischen Selbstbildern zu erkennen, mit denen die Komponisten Neuer<br />
Musik das Absterben des Geniekultes im <strong>20</strong>. Jahrhunderts und den Verlust ihres Ortes in der Mitte der modernen<br />
Gesellschaft kompensierten. Im Andocken an vermeintlich ewige Formen, die mit stets neuem Material und<br />
‚Geist’ zu füllen seien, glaubte sich der dodekaphone Komponist einer geschichtlich un-sterblichen Genialität zu<br />
versichern, die zugleich nur eine ewig bürgerliche bleiben sollte.<br />
Daß die traute ästhetologische Leitvorstellung des 19. Jahrhunderts - die lockende neue Synthese von<br />
Homophonie und Polyphonie - durch das freigesetzte motivisch-thematische Denken im Geist der Dodekaphonie<br />
durch neue Syntax und Idiomatik - durch eine Musik einlösbar sei, in der es mit „nur aufeinanderbezogenen<br />
(Haupt)Tönen“ zugleich nur aufeinanderbezogene Hauptstimmen geben sollte, war ein ebenso bestechendes wie<br />
blendendes, zugleich aber auch ein ebenso unhaltbares wie als musikgeschichtliche Norm unmögliches<br />
Konstrukt. - Die modale und dem Soggettodenken geistlicher Musik verhaftete Satz- und Imitationsweise der<br />
Niederländer war Vollendung des strengen, Beethovens dur-moll-tonale Motivik-Thematik war Vollendung des<br />
freien Satzes, weil erst in seiner vollendet autonomen Werkgestalt die rhythmisch noch athematische<br />
Selbstdiminution der Tonalität bei Bach überwunden, daher die - ‚klassische’ - Auskomponierung der tonalen<br />
Form-Materie-Einheit zu einer dynamischen Zeitgestalt möglich wurde. Und da in der Vollendung des freien<br />
Satzes der strenge aufgegangen war, und die Substanz des Geistlichen sich darin vollendet säkularisierte, musste<br />
ein nochmals höherer Satz von Freiheit jenes Wunschbild bleiben, das lediglich noch die fata morgana eines<br />
integralen Werkes an den Horizont des <strong>20</strong>. Jahrhunderts zu zaubern vermochte.<br />
Des späten Weberns Versuche, der Reihe ein musikhistorisch entliehenes kontrapunktisches Denken zu<br />
unterschieben (die Reihe „kontrapunktisch“, allintervallig, allsymmetrisch als klingendes Fibonacium usf.<br />
vorzuorganisieren) lassen unschwer seine Ahnung erkennen, hinter Schönbergs ohmächtigem Dekret, die Reihe<br />
habe „in der Art eines Motivs“ zu wirken, könnte die Katastrophe der Zusammenhanglosigkeit lauern, gegen<br />
welche die verreichte Motivik-Thematik nur als Imitationstechnik zu retten sei. Weberns „kontrapunktische<br />
Grundgestalt“ mißtraut der „motivisch-thematischen Grundgestalt“ Schönbergs ebenso, wie dessen traditionelle<br />
Rhythmik der Reihenrhythmisierung Weberns misstraut, in der sich die serielle Explosion ankündigte.<br />
Daher auch das Problematische aller Andockmanöver beim späten Beethoven. Wer dessen Anverwandlungen<br />
kontrapunktischer formen zu eigener - dodekaphoner - Legitimation bemüht, übersieht nicht nur das gerade in<br />
Adornos Deutung einsichtig gewordene Problem der auskomponierten Tonalität in den späten Werken<br />
Beethovens. Er verleug<strong>net</strong>, daß Beethovens Versuch, die vollendet gesteigerte Dynamik der motivischthematischen<br />
Entwicklung im heroischen Sonatensatz durch ein Überkomponieren in eine Fuge mit motivischthematischen<br />
Kontrapunkt („con alcune licenza“) nochmals zu steigern, scheitern musste: op. 106.<br />
Der ungehemmten Rückprojektion von ‚Zusammenhang’ und ‚Faßlichkeit’ als leitender Kategorien in die<br />
abendländische Musikgeschichte kontrastiert auffällig, daß wir in den Äußerungen der Meister Alter Musik - bis<br />
hin zu Gustav Mahler und Richard Strauss - von einem primären Bemühen um Zusammenhang und Fasslichkeit<br />
gar wenig lesen. Teils war dies ein selbstverständliches Moment des noch verbindlichen Handwerks, eine<br />
Leistung von tonaler Syntax und Idiomatik, teils nur ein Mittel zu höheren als bloß Zwecken der Form.<br />
Beethoven hätten wenig Freude gehabt, hätte man die Qualität seiner Werke auf die Darstellung fasslicher<br />
Gedanken zurückgeführt. Auf ein den Sinn von Musik dermaßen verkürzendes Theorem konnte man erst<br />
kommen, als längst verloren war, was man kategorial beschwörte.