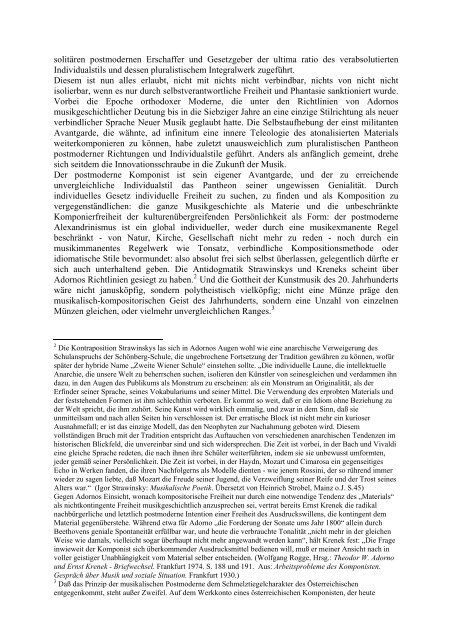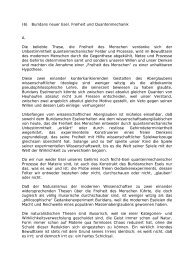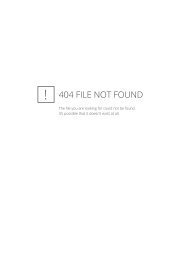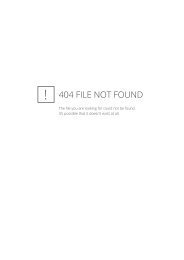ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
solitären postmodernen Erschaffer und Gesetzgeber der ultima ratio des verabsolutierten<br />
Individualstils und dessen pluralistischem Integralwerk zugeführt.<br />
Diesem ist nun alles erlaubt, nicht mit nichts nicht verbindbar, nichts von nicht nicht<br />
isolierbar, wenn es nur durch selbstverantwortliche Freiheit und Phantasie sanktioniert wurde.<br />
Vorbei die Epoche orthodoxer Moderne, die unter den Richtlinien von Adornos<br />
musikgeschichtlicher Deutung bis in die Siebziger Jahre an eine einzige Stilrichtung als neuer<br />
verbindlicher Sprache Neuer Musik geglaubt hatte. Die Selbstaufhebung der einst militanten<br />
Avantgarde, die wähnte, ad infinitum eine innere Te<strong>leo</strong>logie des atonalisierten Materials<br />
weiterkomponieren zu können, habe zuletzt unausweichlich zum pluralistischen Pantheon<br />
postmoderner Richtungen und Individualstile geführt. Anders als anfänglich gemeint, drehe<br />
sich seitdem die Innovationsschraube in die Zukunft der Musik.<br />
Der postmoderne Komponist ist sein eigener Avantgarde, und der zu erreichende<br />
unvergleichliche Individualstil das Pantheon seiner ungewissen Genialität. Durch<br />
individuelles Gesetz individuelle Freiheit zu suchen, zu finden und als Komposition zu<br />
vergegenständlichen: die ganze Musikgeschichte als Materie und die unbeschränkte<br />
Komponierfreiheit der kulturenübergreifenden Persönlichkeit als Form: der postmoderne<br />
Alexandrinismus ist ein global individueller, weder durch eine musikexmanente Regel<br />
beschränkt - von Natur, Kirche, Gesellschaft nicht mehr zu reden - noch durch ein<br />
musikimmanentes Regelwerk wie Tonsatz, verbindliche Kompositionsmethode oder<br />
idiomatische Stile bevormundet: also absolut frei sich selbst überlassen, gelegentlich dürfte er<br />
sich auch unterhaltend geben. Die Antidogmatik Strawinskys und Kreneks scheint über<br />
Adornos Richtlinien gesiegt zu haben. 2 Und die Gottheit der Kunstmusik des <strong>20</strong>. Jahrhunderts<br />
wäre nicht janusköpfig, sondern polytheistisch vielköpfig; nicht eine Münze präge den<br />
musikalisch-kompositorischen Geist des Jahrhunderts, sondern eine Unzahl von einzelnen<br />
Münzen gleichen, oder vielmehr unvergleichlichen Ranges. 3<br />
2 Die Kontraposition Strawinskys las sich in Adornos Augen wohl wie eine anarchische Verweigerung des<br />
Schulanspruchs der Schönberg-Schule, die ungebrochene Fortsetzung der Tradition gewähren zu können, wofür<br />
später der hybride Name „Zweite Wiener Schule“ einstehen sollte. „Die individuelle Laune, die intellektuelle<br />
Anarchie, die unsere Welt zu beherrschen suchen, isolieren den Künstler von seinesgleichen und verdammen ihn<br />
dazu, in den Augen des Publikums als Monstrum zu erscheinen: als ein Monstrum an Originalität, als der<br />
Erfinder seiner Sprache, seines Vokabulariums und seiner Mittel. Die Verwendung des erprobten Materials und<br />
der feststehenden Formen ist ihm schlechthin verboten. Er kommt so weit, daß er ein Idiom ohne Beziehung zu<br />
der Welt spricht, die ihm zuhört. Seine Kunst wird wirklich einmalig, und zwar in dem Sinn, daß sie<br />
unmitteilsam und nach allen Seiten hin verschlossen ist. Der erratische Block ist nicht mehr ein kurioser<br />
Ausnahmefall; er ist das einzige Modell, das den Neophyten zur Nachahmung geboten wird. Diesem<br />
vollständigen Bruch mit der Tradition entspricht das Auftauchen von verschiedenen anarchischen Tendenzen im<br />
historischen Blickfeld, die unvereinbar sind und sich widersprechen. Die Zeit ist vorbei, in der Bach und Vivaldi<br />
eine gleiche Sprache redeten, die nach ihnen ihre Schüler weiterführten, indem sie sie unbewusst umformten,<br />
jeder gemäß seiner Persönlichkeit. Die Zeit ist vorbei, in der Haydn, Mozart und Cimarosa ein gegenseitiges<br />
Echo in Werken fanden, die ihren Nachfolgerns als Modelle dienten - wie jenem Rossini, der so rührend immer<br />
wieder zu sagen liebte, daß Mozart die Freude seiner Jugend, die Verzweiflung seiner Reife und der Trost seines<br />
Alters war.“ (Igor Strawinsky: Musikalische Poetik. Übersetzt von Heinrich Strobel, Mainz o.J. S.45)<br />
Gegen Adornos Einsicht, wonach kompositorische Freiheit nur durch eine notwendige Tendenz des „Materials“<br />
als nichtkontingente Freiheit musikgeschichtlich anzusprechen sei, vertrat bereits Ernst Krenek die radikal<br />
nachbürgerliche und letztlich postmoderne Intention einer Freiheit des Ausdruckswillens, die kontingent dem<br />
Material gegenüberstehe. Während etwa für Adorno „die Forderung der Sonate ums Jahr 1800“ allein durch<br />
Beethovens geniale Spontaneität erfüllbar war, und heute die verbrauchte Tonalität „nicht mehr in der gleichen<br />
Weise wie damals, vielleicht sogar überhaupt nicht mehr angewandt werden kann“, hält Krenek fest: „Die Frage<br />
inwieweit der Komponist sich überkommender Ausdrucksmittel bedienen will, muß er meiner Ansicht nach in<br />
voller geistiger Unabhängigkeit vom Material selber entscheiden. (Wolfgang Rogge, Hrsg.: Theodor W. Adorno<br />
und Ernst Krenek - Briefwechsel. Frankfurt 1974. S. 188 und 191. Aus: Arbeitsprobleme des Komponisten.<br />
Gespräch über Musik und soziale Situation. Frankfurt 1930.)<br />
3 Daß das Prinzip der musikalischen Postmoderne dem Schmelztiegelcharakter des Österreichischen<br />
entgegenkommt, steht außer Zweifel. Auf dem Werkkonto eines österreichischen Komponisten, der heute