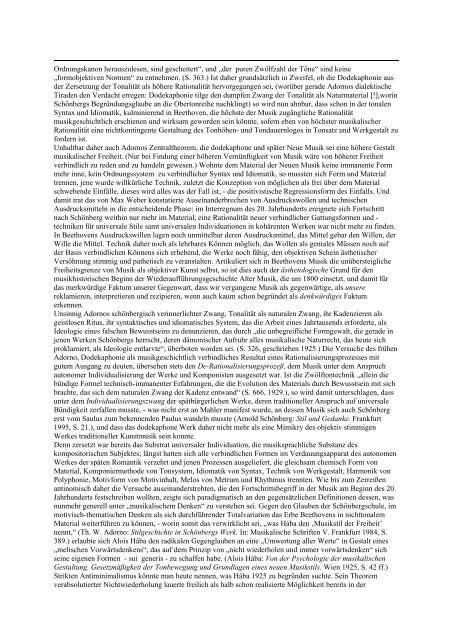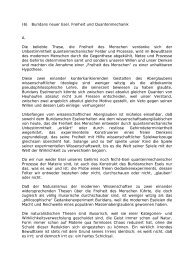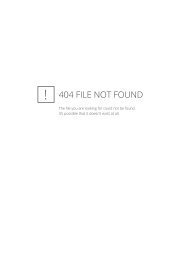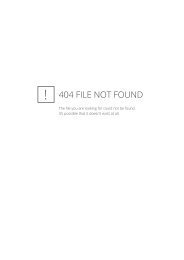ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ordnungskanon herauszulesen, sind gescheitert“, und „der puren Zwölfzahl der Töne“ sind keine<br />
„formobjektiven Normen“ zu entnehmen. (S. 363.) Ist daher grundsätzlich in Zweifel, ob die Dodekaphonie aus<br />
der Zersetzung der Tonalität als höhere Rationalität hervorgegangen sei, (worüber gerade Adornos dialektische<br />
Tiraden den Verdacht erregen: Dodekaphonie tilge den dumpfen Zwang der Tonalität als Naturmaterial [!],worin<br />
Schönbergs Begründungsglaube an die Obertonreihe nachklingt) so wird nun ahnbar, dass schon in der tonalen<br />
Syntax und Idiomatik, kulminierend in Beethoven, die höchste der Musik zugängliche Rationalität<br />
musikgeschichtlich erschienen und wirksam geworden sein könnte, sofern eben von höchster musikalischer<br />
Rationalität eine nichtkontingente Gestaltung des Tonhöhen- und Tondauernlogos in Tonsatz und Werkgestalt zu<br />
fordern ist.<br />
Unhaltbar daher auch Adornos Zentraltheorem, die dodekaphone und später Neue Musik sei eine höhere Gestalt<br />
musikalischer Freiheit. (Nur bei Findung einer höheren Vernünftigkeit von Musik wäre von höherer Freiheit<br />
verbindlich zu reden und zu handeln gewesen.) Wohnte dem Material der Neuen Musik keine immanente Form<br />
mehr inne, kein Ordnungssystem zu verbindlicher Syntax und Idiomatik, so mussten sich Form und Material<br />
trennen, jene wurde willkürliche Technik, zuletzt die Konzeption von möglichen als frei über dem Material<br />
schwebende Einfälle, dieses wird alles was der Fall ist, - die positivistische Regressionsform des Einfalls. Und<br />
damit trat das von Max Weber konstatierte Auseinanderbrechen von Ausdruckswollen und technischen<br />
Ausdrucksmitteln in die entscheidende Phase: im Interregnum des <strong>20</strong>. Jahrhunderts ereig<strong>net</strong>e sich Fortschritt<br />
nach Schönberg weithin nur mehr im Material, eine Rationalität neuer verbindlicher Gattungsformen und -<br />
techniken für universale Stile samt universalen Individuationen in kohärenten Werken war nicht mehr zu finden.<br />
In Beethovens Ausdruckswillen lagen noch unmittelbar deren Ausdrucksmittel, das Mittel gebar den Willen, der<br />
Wille die Mittel. Technik daher noch als lehrbares Können möglich, das Wollen als geniales Müssen noch auf<br />
der Basis verbindlichen Könnens sich erhebend, die Werke noch fähig, den objektiven Schein ästhetischer<br />
Versöhnung stimmig und pathetisch zu veranstalten. Artikuliert sich in Beethovens Musik die unübersteigliche<br />
Freiheitsgrenze von Musik als objektiver Kunst selbst, so ist dies auch der ästhetologische Grund für den<br />
musikhistorischen Beginn der Wiederaufführungsgeschichte Alter Musik, die um 1800 einsetzt, und damit für<br />
das merkwürdige Faktum unserer Gegenwart, dass wir vergangene Musik als gegenwärtige, als unsere<br />
reklamieren, interpretieren und rezipieren, wenn auch kaum schon begründet als denkwürdiges Faktum<br />
erkennen.<br />
Unsinnig Adornos schönbergisch verinnerlichter Zwang, Tonalität als naturalen Zwang, ihr Kadenzieren als<br />
geistlosen Ritus, ihr syntaktisches und idiomatisches System, das die Arbeit eines Jahrtausends erforderte, als<br />
Ideologie eines falschen Bewusstseins zu denunzieren, das durch „die unbegreifliche Formgewalt, die gerade in<br />
jenen Werken Schönbergs herrscht, deren dämonischer Aufruhr alles musikalische Naturrecht, das heute sich<br />
proklamiert, als Ideologie entlarvte“, überboten worden sei. (S. 326, geschrieben 1925.) Die Versuche des frühen<br />
Adorno, Dodekaphonie als musikgeschichtlich verbindliches Resultat eines Rationalisierungsprozesses mit<br />
gutem Ausgang zu deuten, übersehen stets den De-Rationalisierungsprozeß, dem Musik unter dem Anspruch<br />
autonomer Individualisierung der Werke und Komponisten ausgesetzt war. Ist die Zwölftontechnik „allein die<br />
bündige Formel technisch-immanenter Erfahrungen, die die Evolution des Materials durch Bewusstsein mit sich<br />
brachte, das sich dem naturalen Zwang der Kadenz entwand“ (S. 666, 1929.), so wird damit unterschlagen, dass<br />
unter dem Individualisierungszwang der spätbürgerlichen Werke, deren traditioneller Anspruch auf universale<br />
Bündigkeit zerfallen musste, - was nicht erst an Mahler manifest wurde, an dessen Musik sich auch Schönberg<br />
erst vom Saulus zum bekennenden Paulus wandeln musste (Arnold Schönberg: Stil und Gedanke. Frankfurt<br />
1995, S. 21.), und dass das dodekaphone Werk daher nicht mehr als eine Mimikry des objektiv stimmigen<br />
Werkes traditioneller Kunstmusik sein konnte.<br />
Denn zersetzt war bereits das Substrat universaler Individuation, die musiksprachliche Substanz des<br />
kompositorischen Subjektes; längst hatten sich alle verbindlichen Formen im Verdauungsapparat des autonomen<br />
Werkes der späten Romantik verzehrt und jenen Prozessen ausgeliefert, die gleichsam chemisch Form von<br />
Material, Komponiermethode von Tonsystem, Idiomatik von Syntax, Technik von Werkgestalt, Harmonik von<br />
Polyphonie, Motivform von Motivinhalt, Melos von Metrum und Rhythmus trennten. Wie bis zum Zerreißen<br />
antinomisch daher die Versuche auseinanderstrebten, die den Fortschrittsbegriff in der Musik am Beginn des <strong>20</strong>.<br />
Jahrhunderts festschreiben wollten, zeigte sich paradigmatisch an den gegensätzlichen Definitionen dessen, was<br />
nunmehr generell unter „musikalischem Denken“ zu verstehen sei. Gegen den Glauben der Schönbergschule, im<br />
motivisch-thematischen Denken als sich durchführender Totalvariation das Erbe Beethovens in nichttonalem<br />
Material weiterführen zu können, - worin somit das verwirklicht sei, „was Hába den ‚Musikstil der Freiheit’<br />
nennt,“ (Th. W. Adorno: Stilgeschichte in Schönbergs Werk. In: Musikalische Schriften V. Frankfurt 1984, S.<br />
389.) erlaubte sich Alois Hába den radikalen Gegenglauben an eine „Umwertung aller Werte“ in Gestalt eines<br />
„melischen Vorwärtsdenkens“, das auf dem Prinzip von „nicht wiederholen und immer vorwärtsdenken“ sich<br />
seine eigenen Formen - sui generis - zu schaffen habe. (Alois Hába: Von der Psychologie der musikalischen<br />
Gestaltung. Gesetzmäßigkeit der Tonbewegung und Grundlagen eines neuen Musikstils. Wien 1925, S. 42 ff.)<br />
Strikten Antiminimalismus könnte man heute nennen, was Hába 1925 zu begründen suchte. Sein Theorem<br />
verabsolutierter Nichtwiederholung lauerte freilich als halb schon realisierte Möglichkeit bereits in der