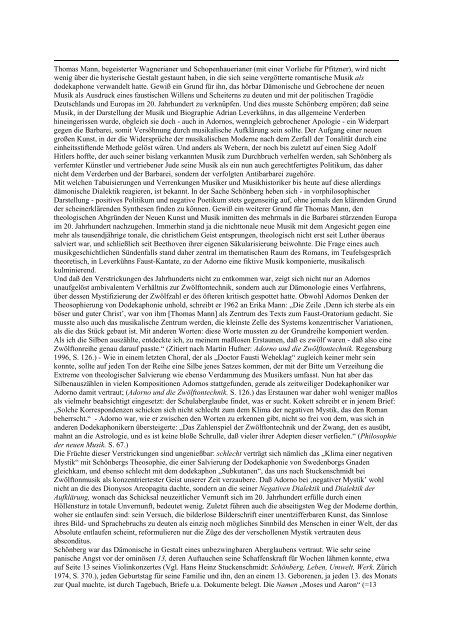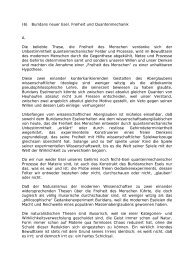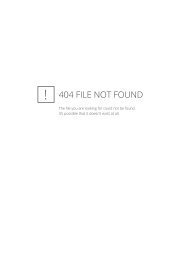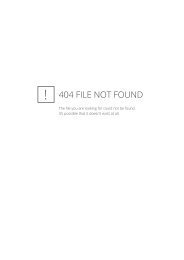ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Thomas Mann, begeisterter Wagnerianer und Schopenhauerianer (mit einer Vorliebe für Pfitzner), wird nicht<br />
wenig über die hysterische Gestalt gestaunt haben, in die sich seine vergötterte romantische Musik als<br />
dodekaphone verwandelt hatte. Gewiß ein Grund für ihn, das hörbar Dämonische und Gebrochene der neuen<br />
Musik als Ausdruck eines faustischen Willens und Scheiterns zu deuten und mit der politischen Tragödie<br />
Deutschlands und Europas im <strong>20</strong>. Jahrhundert zu verknüpfen. Und dies musste Schönberg empören; daß seine<br />
Musik, in der Darstellung der Musik und Biographie Adrian Leverkühns, in das allgemeine Verderben<br />
hineingerissen wurde, obgleich sie doch - auch in Adornos, wenngleich gebrochener Apologie - ein Widerpart<br />
gegen die Barbarei, somit Versöhnung durch musikalische Aufklärung sein sollte. Der Aufgang einer neuen<br />
großen Kunst, in der die Widersprüche der musikalischen Moderne nach dem Zerfall der Tonalität durch eine<br />
einheitsstiftende Methode gelöst wären. Und anders als Webern, der noch bis zuletzt auf einen Sieg Adolf<br />
Hitlers hoffte, der auch seiner bislang verkannten Musik zum Durchbruch verhelfen werden, sah Schönberg als<br />
verfemter Künstler und vertriebener Jude seine Musik als ein nun auch gerechtfertigtes Politikum, das daher<br />
nicht dem Verderben und der Barbarei, sondern der verfolgten Antibarbarei zugehöre.<br />
Mit welchen Tabuisierungen und Verrenkungen Musiker und Musikhistoriker bis heute auf diese allerdings<br />
dämonische Dialektik reagieren, ist bekannt. In der Sache Schönberg heben sich - in vorphilosophischer<br />
Darstellung - positives Politikum und negative Poetikum stets gegenseitig auf, ohne jemals den klärenden Grund<br />
der scheinerklärenden Synthesen finden zu können. Gewiß ein weiterer Grund für Thomas Mann, den<br />
theologischen Abgründen der Neuen Kunst und Musik inmitten des mehrmals in die Barbarei stürzenden Europa<br />
im <strong>20</strong>. Jahrhundert nachzugehen. Immerhin stand ja die nichttonale neue Musik mit dem Angesicht gegen eine<br />
mehr als tausendjährige tonale, die christlichem Geist entsprungen, theologisch nicht erst seit Luther überaus<br />
salviert war, und schließlich seit Beethoven ihrer eigenen Säkularisierung beiwohnte. Die Frage eines auch<br />
musikgeschichtlichen Sündenfalls stand daher zentral im thematischen Raum des Romans, im Teufelsgespräch<br />
theoretisch, in Leverkühns Faust-Kantate, zu der Adorno eine fiktive Musik komponierte, musikalisch<br />
kulminierend.<br />
Und daß den Verstrickungen des Jahrhunderts nicht zu entkommen war, zeigt sich nicht nur an Adornos<br />
unaufgelöst ambivalentem Verhältnis zur Zwölftontechnik, sondern auch zur Dämonologie eines Verfahrens,<br />
über dessen Mystifizierung der Zwölfzahl er des öfteren kritisch gespottet hatte. Obwohl Adornos Denken der<br />
Theosophierung von Dodekaphonie unhold, schreibt er 1962 an Erika Mann: „Die Zeile ‚Denn ich sterbe als ein<br />
böser und guter Christ’, war von ihm [Thomas Mann] als Zentrum des Texts zum Faust-Oratorium gedacht. Sie<br />
musste also auch das musikalische Zentrum werden, die kleinste Zelle des Systems konzentrischer Variationen,<br />
als die das Stück gebaut ist. Mit anderen Worten: diese Worte mussten zu der Grundreihe komponiert werden.<br />
Als ich die Silben auszählte, entdeckte ich, zu meinem maßlosen Erstaunen, daß es zwölf waren - daß also eine<br />
Zwölftonreihe genau darauf passte.“ (Zitiert nach Martin Hufner: Adorno und die Zwölftontechnik. Regensburg<br />
1996, S. 126.) - Wie in einem letzten Choral, der als „Doctor Fausti Weheklag“ zugleich keiner mehr sein<br />
konnte, sollte auf jeden Ton der Reihe eine Silbe jenes Satzes kommen, der mit der Bitte um Verzeihung die<br />
Extreme von theologischer Salvierung wie ebenso Verdammung des Musikers umfasst. Nun hat aber das<br />
Silbenauszählen in vielen Kompositionen Adornos stattgefunden, gerade als zeitweiliger Dodekaphoniker war<br />
Adorno damit vertraut; (Adorno und die Zwölftontechnik. S. 126.) das Erstaunen war daher wohl weniger maßlos<br />
als vielmehr beabsichtigt eingesetzt: der Schulaberglaube findet, was er sucht. Kokett schreibt er in jenem Brief:<br />
„Solche Korrespondenzen schicken sich nicht schlecht zum dem Klima der negativen Mystik, das den Roman<br />
beherrscht.“ - Adorno war, wie er zwischen den Worten zu erkennen gibt, nicht so frei von dem, was sich in<br />
anderen Dodekaphonikern übersteigerte: „Das Zahlenspiel der Zwölftontechnik und der Zwang, den es ausübt,<br />
mahnt an die Astrologie, und es ist keine bloße Schrulle, daß vieler ihrer Adepten dieser verfielen.“ (Philosophie<br />
der neuen Musik. S. 67.)<br />
Die Früchte dieser Verstrickungen sind ungenießbar: schlecht verträgt sich nämlich das „Klima einer negativen<br />
Mystik“ mit Schönbergs Theosophie, die einer Salvierung der Dodekaphonie von Swedenborgs Gnaden<br />
gleichkam, und ebenso schlecht mit dem dodekaphon „Subkutanen“, das uns nach Stuckenschmidt bei<br />
Zwölftonmusik als konzentriertester Geist unserer Zeit verzaubere. Daß Adorno bei ‚negativer Mystik’ wohl<br />
nicht an die des Dionysos Areopagita dachte, sondern an die seiner Negativen Dialektik und Dialektik der<br />
Aufklärung, wonach das Schicksal neuzeitlicher Vernunft sich im <strong>20</strong>. Jahrhundert erfülle durch einen<br />
Höllensturz in totale Unvernunft, bedeutet wenig. Zuletzt führen auch die abseitigsten Weg der Moderne dorthin,<br />
woher sie entlaufen sind: sein Versuch, die bilderlose Bilderschrift einer unentzifferbaren Kunst, das Sinnlose<br />
ihres Bild- und Sprachebruchs zu deuten als einzig noch mögliches Sinnbild des Menschen in einer Welt, der das<br />
Absolute entlaufen scheint, reformulieren nur die Züge des der verschollenen Mystik vertrauten deus<br />
absconditus.<br />
Schönberg war das Dämonische in Gestalt eines unbezwingbaren Aberglaubens vertraut. Wie sehr seine<br />
panische Angst vor der ominösen 13, deren Auftauchen seine Schaffenskraft für Wochen lähmen konnte, etwa<br />
auf Seite 13 seines Violinkonzertes (Vgl. Hans Heinz Stuckenschmidt: Schönberg, Leben, Umwelt, Werk. Zürich<br />
1974, S. 370.), jeden Geburtstag für seine Familie und ihn, den an einem 13. Geborenen, ja jeden 13. des Monats<br />
zur Qual machte, ist durch Tagebuch, Briefe u.a. Dokumente belegt. Die Namen „Moses und Aaron“ (=13