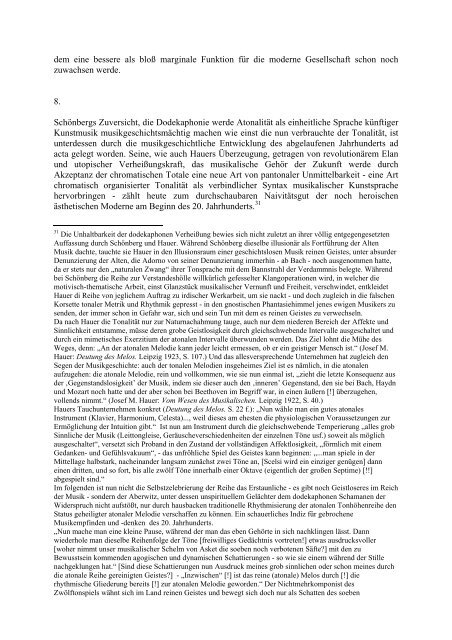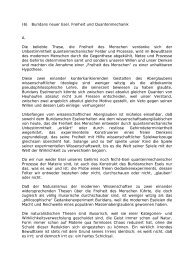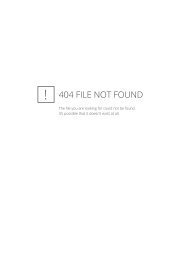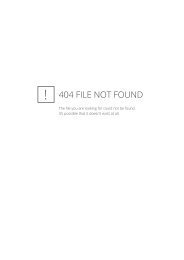ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dem eine bessere als bloß marginale Funktion für die moderne Gesellschaft schon noch<br />
zuwachsen werde.<br />
8.<br />
Schönbergs Zuversicht, die Dodekaphonie werde Atonalität als einheitliche Sprache künftiger<br />
Kunstmusik musikgeschichtsmächtig machen wie einst die nun verbrauchte der Tonalität, ist<br />
unterdessen durch die musikgeschichtliche Entwicklung des abgelaufenen Jahrhunderts ad<br />
acta gelegt worden. Seine, wie auch Hauers Überzeugung, getragen von revolutionärem Elan<br />
und utopischer Verheißungskraft, das musikalische Gehör der Zukunft werde durch<br />
Akzeptanz der chromatischen Totale eine neue Art von pantonaler Unmittelbarkeit - eine Art<br />
chromatisch organisierter Tonalität als verbindlicher Syntax musikalischer Kunstsprache<br />
hervorbringen - zählt heute zum durchschaubaren Naivitätsgut der noch heroischen<br />
ästhetischen Moderne am Beginn des <strong>20</strong>. Jahrhunderts. 31<br />
31 Die Unhaltbarkeit der dodekaphonen Verheißung bewies sich nicht zuletzt an ihrer völlig entgegengesetzten<br />
Auffassung durch Schönberg und Hauer. Während Schönberg dieselbe illusionär als Fortführung der Alten<br />
Musik dachte, tauchte sie Hauer in den Illusionsraum einer geschichtslosen Musik reinen Geistes, unter absurder<br />
Denunzierung der Alten, die Adorno von seiner Denunzierung immerhin - ab Bach - noch ausgenommen hatte,<br />
da er stets nur den „naturalen Zwang“ ihrer Tonsprache mit dem Bannstrahl der Verdammnis belegte. Während<br />
bei Schönberg die Reihe zur Verstandeshölle willkürlich gefesselter Klangoperationen wird, in welcher die<br />
motivisch-thematische Arbeit, einst Glanzstück musikalischer Vernunft und Freiheit, verschwindet, entkleidet<br />
Hauer di Reihe von jeglichem Auftrag zu irdischer Werkarbeit, um sie nackt - und doch zugleich in die falschen<br />
Korsette tonaler Metrik und Rhythmik gepresst - in den gnostischen Phantasiehimmel jenes ewigen Musikers zu<br />
senden, der immer schon in Gefahr war, sich und sein Tun mit dem es reinen Geistes zu verwechseln.<br />
Da nach Hauer die Tonalität nur zur Naturnachahmung tauge, auch nur dem niederen Bereich der Affekte und<br />
Sinnlichkeit entstamme, müsse deren grobe Geistlosigkeit durch gleichschwebende Intervalle ausgeschaltet und<br />
durch ein mimetisches Exerzitium der atonalen Intervalle überwunden werden. Das Ziel lohnt die Mühe des<br />
Weges, denn: „An der atonalen Melodie kann jeder leicht ermessen, ob er ein geistiger Mensch ist.“ (Josef M.<br />
Hauer: Deutung des Melos. Leipzig 1923, S. 107.) Und das allesversprechende Unternehmen hat zugleich den<br />
Segen der Musikgeschichte: auch der tonalen Melodien insgeheimes Ziel ist es nämlich, in die atonalen<br />
aufzugehen: die atonale Melodie, rein und vollkommen, wie sie nun einmal ist, „zieht die letzte Konsequenz aus<br />
der ‚Gegenstandslosigkeit’ der Musik, indem sie dieser auch den ‚inneren’ Gegenstand, den sie bei Bach, Haydn<br />
und Mozart noch hatte und der aber schon bei Beethoven im Begriff war, in einen äußern [!] überzugehen,<br />
vollends nimmt.“ (Josef M. Hauer: Vom Wesen des Musikalischen. Leipzig 1922, S. 40.)<br />
Hauers Tauchunternehmen konkret (Deutung des Melos. S. 22 f.): „Nun wähle man ein gutes atonales<br />
Instrument (Klavier, Harmonium, Celesta)..., weil dieses am ehesten die physiologischen Voraussetzungen zur<br />
Ermöglichung der Intuition gibt.“ Ist nun am Instrument durch die gleichschwebende Temperierung „alles grob<br />
Sinnliche der Musik (Leittongleise, Geräuscheverschiedenheiten der einzelnen Töne usf.) soweit als möglich<br />
ausgeschaltet“, versetzt sich Proband in den Zustand der vollständigen Affektlosigkeit, „förmlich mit einem<br />
Gedanken- und Gefühlsvakuum“, - das unfröhliche Spiel des Geistes kann beginnen: „...man spiele in der<br />
Mittellage halbstark, nacheinander langsam zunächst zwei Töne an, [Scelsi wird ein einziger genügen] dann<br />
einen dritten, und so fort, bis alle zwölf Töne innerhalb einer Oktave (eigentlich der großen Septime) [!!]<br />
abgespielt sind.“<br />
Im folgenden ist nun nicht die Selbstzelebrierung der Reihe das Erstaunliche - es gibt noch Geistloseres im Reich<br />
der Musik - sondern der Aberwitz, unter dessen unspirituellem Gelächter dem dodekaphonen Schamanen der<br />
Widerspruch nicht aufstößt, nur durch hausbacken traditionelle Rhythmisierung der atonalen Tonhöhenreihe den<br />
Status geheiligter atonaler Melodie verschaffen zu können. Ein schauerliches Indiz für gebrochene<br />
Musikempfinden und -denken des <strong>20</strong>. Jahrhunderts.<br />
„Nun mache man eine kleine Pause, während der man das eben Gehörte in sich nachklingen lässt. Dann<br />
wiederhole man dieselbe Reihenfolge der Töne [freiwilliges Gedächtnis vortreten!] etwas ausdrucksvoller<br />
[woher nimmt unser musikalischer Schelm von Asket die soeben noch verbotenen Säfte?] mit den zu<br />
Bewusstsein kommenden agogischen und dynamischen Schattierungen - so wie sie einem während der Stille<br />
nachgeklungen hat.“ [Sind diese Schattierungen nun Ausdruck meines grob sinnlichen oder schon meines durch<br />
die atonale Reihe gereinigten Geistes?] - „Inzwischen“ [!] ist das reine (atonale) Melos durch [!] die<br />
rhythmische Gliederung bereits [!] zur atonalen Melodie geworden.“ Der Nichtmehrkomponist des<br />
Zwölftonspiels wähnt sich im Land reinen Geistes und bewegt sich doch nur als Schatten des soeben