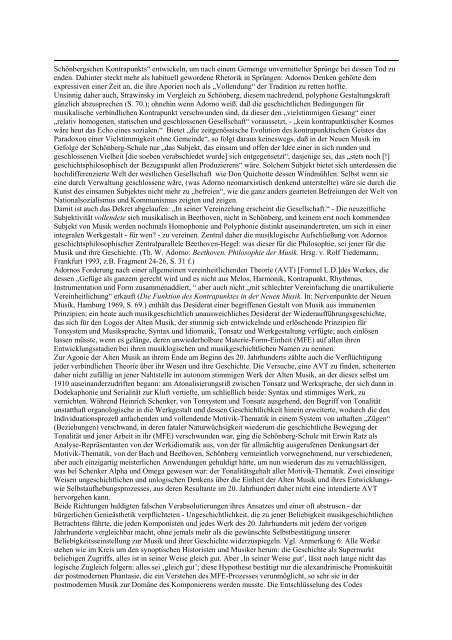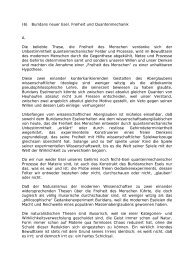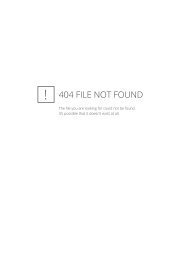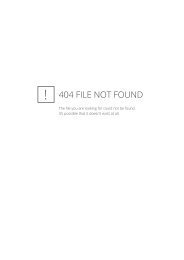ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schönbergschen Kontrapunkts“ entwickeln, um nach einem Gemenge unvermittelter Sprünge bei dessen Tod zu<br />
enden. Dahinter steckt mehr als habituell gewordene Rhetorik in Sprüngen: Adornos Denken gehörte dem<br />
expressiven einer Zeit an, die ihre Aporien noch als „Vollendung“ der Tradition zu retten hoffte.<br />
Unsinnig daher auch, Strawinsky im Vergleich zu Schönberg, diesem nachredend, polyphone Gestaltungskraft<br />
gänzlich abzusprechen (S. 70.); ohnehin wenn Adorno weiß, daß die geschichtlichen Bedingungen für<br />
musikalische verbindlichen Kontrapunkt verschwunden sind, da dieser den „vielstimmigen Gesang“ einer<br />
„relativ homogenen, statischen und geschlossenen Gesellschaft“ voraussetzt, - „kein kontrapunktischer Kosmos<br />
wäre heut das Echo eines sozialen.“ Bietet „die zeitgenössische Evolution des kontrapunktischen Geistes das<br />
Paradoxon einer Vielstimmigkeit ohne Gemeinde“, so folgt daraus keineswegs, daß in der Neuen Musik im<br />
Gefolge der Schönberg-Schule nur „das Subjekt, das einsam und offen der Idee einer in sich runden und<br />
geschlossenen Vielheit [die soeben verabschiedet wurde] sich entgegensetzt“, dasjenige sei, das „stets noch [!]<br />
geschichtsphilosophisch der Bezugspunkt allen Produzierens“ wäre. Solchem Subjekt bietet sich unterdessen die<br />
hochdifferenzierte Welt der westlichen Gesellschaft wie Don Quichotte dessen Windmühlen. Selbst wenn sie<br />
eine durch Verwaltung geschlossene wäre, (was Adorno neomarxistisch denkend unterstellte) wäre sie durch die<br />
Kunst des einsamen Subjektes nicht mehr zu „befreien“, wie die ganz anders gearteten Befreiungen der Welt von<br />
Nationalsozialismus und Kommunismus zeigten und zeigen.<br />
Damit ist auch das Dekret abgelaufen: „In seiner Vereinzelung erscheint die Gesellschaft.“ - Die neuzeitliche<br />
Subjektivität vollendete sich musikalisch in Beethoven, nicht in Schönberg, und keinem erst noch kommenden<br />
Subjekt von Musik werden nochmals Homophonie und Polyphonie distinkt auseinandertreten, um sich in einer<br />
integralen Werkgestalt - für wen? - zu vereinen. Zentral daher die musiklogische Aufschließung von Adornos<br />
geschichtsphilosophischer Zentralparallele Beethoven-Hegel: was dieser für die Philosophie, sei jener für die<br />
Musik und ihre Geschichte. (Th. W. Adorno: Beethoven. Philosophie der Musik. Hrsg. v. Rolf Tiedemann,<br />
Frankfurt 1993, z.B. Fragment 24-26, S. 31 f.)<br />
Adornos Forderung nach einer allgemeinen vereinheitlichenden Theorie (AVT) [Formel L.D.]des Werkes, die<br />
dessen „Gefüge als ganzem gerecht wird und es nicht aus Melos, Harmonik, Kontrapunkt, Rhythmus,<br />
Instrumentation und Form zusammenaddiert, “ aber auch nicht „mit schlechter Vereinfachung die unartikulierte<br />
Vereinheitlichung“ erkauft (Die Funktion des Kontrapunktes in der Neuen Musik. In: Nervenpunkte der Neuen<br />
Musik, Hamburg 1969, S. 69.) enthält das Desiderat einer begriffenen Gestalt von Musik aus immanenten<br />
Prinzipien; ein heute auch musikgeschichtlich unausweichliches Desiderat der Wiederaufführungsgeschichte,<br />
das sich für den Logos der Alten Musik, der stimmig sich entwickelnde und erlöschende Prinzipien für<br />
Tonsystem und Musiksprache, Syntax und Idiomatik, Tonsatz und Werkgestaltung verfügte, auch einlösen<br />
lassen müsste, wenn es gelänge, deren unwiederholbare Materie-Form-Einheit (MFE) auf allen ihren<br />
Entwicklungsstadien bei ihren musiklogischen und musikgeschichtlichen Namen zu nennen.<br />
Zur Agonie der Alten Musik an ihrem Ende am Beginn des <strong>20</strong>. Jahrhunderts zählte auch die Verflüchtigung<br />
jeder verbindlichen Theorie über ihr Wesen und ihre Geschichte. Die Versuche, eine AVT zu finden, scheiterten<br />
daher nicht zufällig an jener Nahtstelle im autonom stimmigen Werk der Alten Musik, an der dieses selbst um<br />
1910 auseinanderzudriften begann: am Atonalisierungsriß zwischen Tonsatz und Werksprache, der sich dann in<br />
Dodekaphonie und Serialität zur Kluft vertiefte, um schließlich beide: Syntax und stimmiges Werk, zu<br />
vernichten. Während Heinrich Schenker, von Tonsystem und Tonsatz ausgehend, den Begriff von Tonalität<br />
unstatthaft organologische in die Werkgestalt und dessen Geschichtlichkeit hinein erweiterte, wodurch die den<br />
Individuationsprozeß anfachenden und vollendende Motivik-Thematik in einem System von urhaften „Zügen“<br />
(Beziehungen) verschwand, in deren fataler Naturwüchsigkeit wiederum die geschichtliche Bewegung der<br />
Tonalität und jener Arbeit in ihr (MFE) verschwunden war, ging die Schönberg-Schule mit Erwin Ratz als<br />
Analyse-Repräsentanten von der Werkidiomatik aus, von der für allmächtig ausgerufenen Denkungsart der<br />
Motivik-Thematik, von der Bach und Beethoven, Schönberg vermeintlich vorwegnehmend, nur verschiedenen,<br />
aber auch einzigartig meisterlichen Anwendungen gehuldigt hätte, um nun wiederum das zu vernachlässigen,<br />
was bei Schenker Alpha und Omega gewesen war: der Tonalitätsgehalt aller Motivik-Thematik. Zwei einseitige<br />
Weisen ungeschichtlichen und unlogischen Denkens über die Einheit der Alten Musik und ihres Entwicklungs-<br />
wie Selbstaufhebungsprozesses, aus deren Resultante im <strong>20</strong>. Jahrhundert daher nicht eine intendierte AVT<br />
hervorgehen kann.<br />
Beide Richtungen huldigten falschen Verabsolutierungen ihres Ansatzes und einer oft abstrusen - der<br />
bürgerlichen Genieästhetik verpflichteten - Ungeschichtlichkeit, die zu jener Beliebigkeit musikgeschichtlichen<br />
Betrachtens führte, die jeden Komponisten und jedes Werk des <strong>20</strong>. Jahrhunderts mit jedem der vorigen<br />
Jahrhunderte vergleichbar macht, ohne jemals mehr als die gewünschte Selbstbestätigung unserer<br />
Beliebigkeitsseinstellung zur Musik und ihrer Geschichte widerzuspiegeln. Vgl. Anmerkung 6: Alle Werke<br />
stehen wie im Kreis um den synoptischen Historisten und Musiker herum: die Geschichte als Supermarkt<br />
beliebigen Zugriffs, alles ist in seiner Weise gleich gut. Aber ‚In seiner Weise gut’, lässt noch lange nicht das<br />
logische Zugleich folgern: alles sei ‚gleich gut’; diese Hypothese bestätigt nur die alexandrinische Promiskuität<br />
der postmodernen Phantasie, die ein Verstehen des MFE-Prozesses verunmöglicht, so sehr sie in der<br />
postmodernen Musik zur Domäne des Komponierens werden musste. Die Entschlüsselung des Codes