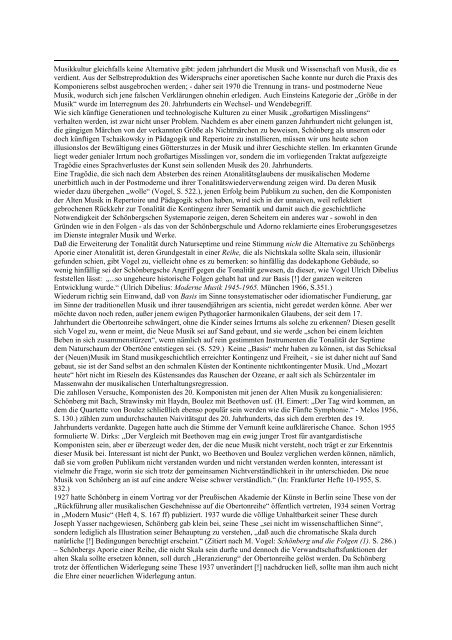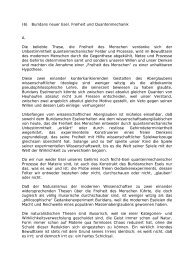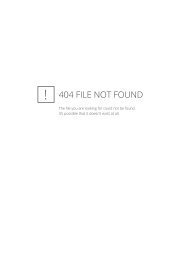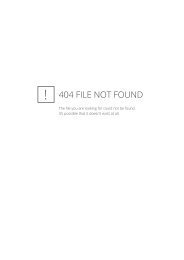ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Musikkultur gleichfalls keine Alternative gibt: jedem jahrhundert die Musik und Wissenschaft von Musik, die es<br />
verdient. Aus der Selbstreproduktion des Widerspruchs einer aporetischen Sache konnte nur durch die Praxis des<br />
Komponierens selbst ausgebrochen werden; - daher seit 1970 die Trennung in trans- und postmoderne Neue<br />
Musik, wodurch sich jene falschen Verklärungen ohnehin erledigen. Auch Einsteins Kategorie der „Größe in der<br />
Musik“ wurde im Interregnum des <strong>20</strong>. Jahrhunderts ein Wechsel- und Wendebegriff.<br />
Wie sich künftige Generationen und technologische Kulturen zu einer Musik „großartigen Misslingens“<br />
verhalten werden, ist zwar nicht unser Problem. Nachdem es aber einem ganzen Jahrhundert nicht gelungen ist,<br />
die gängigen Märchen von der verkannten Größe als Nichtmärchen zu beweisen, Schönberg als unseren oder<br />
doch künftigen Tschaikowsky in Pädagogik und Repertoire zu installieren, müssen wir uns heute schon<br />
illusionslos der Bewältigung eines Göttersturzes in der Musik und ihrer Geschichte stellen. Im erkannten Grunde<br />
liegt weder genialer Irrtum noch großartiges Misslingen vor, sondern die im vorliegenden Traktat aufgezeigte<br />
Tragödie eines Sprachverlustes der Kunst sein sollenden Musik des <strong>20</strong>. Jahrhunderts.<br />
Eine Tragödie, die sich nach dem Absterben des reinen Atonalitätsglaubens der musikalischen Moderne<br />
unerbittlich auch in der Postmoderne und ihrer Tonalitätswiederverwendung zeigen wird. Da deren Musik<br />
wieder dazu übergehen „wolle“ (Vogel, S. 522.), jenen Erfolg beim Publikum zu suchen, den die Komponisten<br />
der Alten Musik in Repertoire und Pädagogik schon haben, wird sich in der unnaiven, weil reflektiert<br />
gebrochenen Rückkehr zur Tonalität die Kontingenz ihrer Semantik und damit auch die geschichtliche<br />
Notwendigkeit der Schönbergschen Systemaporie zeigen, deren Scheitern ein anderes war - sowohl in den<br />
Gründen wie in den Folgen - als das von der Schönbergschule und Adorno reklamierte eines Eroberungsgesetzes<br />
im Dienste integraler Musik und Werke.<br />
Daß die Erweiterung der Tonalität durch Naturseptime und reine Stimmung nicht die Alternative zu Schönbergs<br />
Aporie einer Atonalität ist, deren Grundgestalt in einer Reihe, die als Nichtskala sollte Skala sein, illusionär<br />
gefunden schien, gibt Vogel zu, vielleicht ohne es zu bemerken: so hinfällig das dodekaphone Gebäude, so<br />
wenig hinfällig sei der Schönbergsche Angriff gegen die Tonalität gewesen, da dieser, wie Vogel Ulrich Dibelius<br />
feststellen lässt: „...so ungeheure historische Folgen gehabt hat und zur Basis [!] der ganzen weiteren<br />
Entwicklung wurde.“ (Ulrich Dibelius: Moderne Musik 1945-1965. München 1966, S.351.)<br />
Wiederum richtig sein Einwand, daß von Basis im Sinne tonsystematischer oder idiomatischer Fundierung, gar<br />
im Sinne der traditionellen Musik und ihrer tausendjährigen ars scientia, nicht geredet werden könne. Aber wer<br />
möchte davon noch reden, außer jenem ewigen Pythagoräer harmonikalen Glaubens, der seit dem 17.<br />
Jahrhundert die Obertonreihe schwängert, ohne die Kinder seines Irrtums als solche zu erkennen? Diesen gesellt<br />
sich Vogel zu, wenn er meint, die Neue Musik sei auf Sand gebaut, und sie werde „schon bei einem leichten<br />
Beben in sich zusammenstürzen“, wenn nämlich auf rein gestimmten Instrumenten die Tonalität der Septime<br />
dem Naturschaum der Obertöne entstiegen sei. (S. 529.) Keine „Basis“ mehr haben zu können, ist das Schicksal<br />
der (Neuen)Musik im Stand musikgeschichtlich erreichter Kontingenz und Freiheit, - sie ist daher nicht auf Sand<br />
gebaut, sie ist der Sand selbst an den schmalen Küsten der Kontinente nichtkontingenter Musik. Und „Mozart<br />
heute“ hört nicht im Rieseln des Küstensandes das Rauschen der Ozeane, er aalt sich als Schürzentaler im<br />
Massenwahn der musikalischen Unterhaltungsregression.<br />
Die zahllosen Versuche, Komponisten des <strong>20</strong>. Komponisten mit jenen der Alten Musik zu kongenialisieren:<br />
Schönberg mit Bach, Strawinsky mit Haydn, Boulez mit Beethoven usf. (H. Eimert: „Der Tag wird kommen, an<br />
dem die Quartette von Boulez schließlich ebenso populär sein werden wie die Fünfte Symphonie.“ - Melos 1956,<br />
S. 130.) zählen zum undurchschauten Naivitätsgut des <strong>20</strong>. Jahrhunderts, das sich dem ererbten des 19.<br />
Jahrhunderts verdankte. Dagegen hatte auch die Stimme der Vernunft keine aufklärerische Chance. Schon 1955<br />
formulierte W. Dirks: „Der Vergleich mit Beethoven mag ein ewig junger Trost für avantgardistische<br />
Komponisten sein, aber er überzeugt weder den, der die neue Musik nicht versteht, noch trägt er zur Erkenntnis<br />
dieser Musik bei. Interessant ist nicht der Punkt, wo Beethoven und Boulez verglichen werden können, nämlich,<br />
daß sie vom großen Publikum nicht verstanden wurden und nicht verstanden werden konnten, interessant ist<br />
vielmehr die Frage, worin sie sich trotz der gemeinsamen Nichtverständlichkeit in ihr unterschieden. Die neue<br />
Musik von Schönberg an ist auf eine andere Weise schwer verständlich.“ (In: Frankfurter Hefte 10-1955, S.<br />
832.)<br />
1927 hatte Schönberg in einem Vortrag vor der Preußischen Akademie der Künste in Berlin seine These von der<br />
„Rückführung aller musikalischen Geschehnisse auf die Obertonreihe“ öffentlich vertreten, 1934 seinen Vortrag<br />
in „Modern Music“ (Heft 4, S. 167 ff) publiziert. 1937 wurde die völlige Unhaltbarkeit seiner These durch<br />
Joseph Yasser nachgewiesen, Schönberg gab klein bei, seine These „sei nicht im wissenschaftlichen Sinne“,<br />
sondern lediglich als Illustration seiner Behauptung zu verstehen, „daß auch die chromatische Skala durch<br />
natürliche [!] Bedingungen berechtigt erscheint.“ (Zitiert nach M. Vogel: Schönberg und die Folgen (1). S. 286.)<br />
– Schönbergs Aporie einer Reihe, die nicht Skala sein durfte und dennoch die Verwandtschaftsfunktionen der<br />
alten Skala sollte ersetzen können, soll durch „Heranzierung“ der Obertonreihe gelöst werden. Da Schönberg<br />
trotz der öffentlichen Widerlegung seine These 1937 unverändert [!] nachdrucken ließ, sollte man ihm auch nicht<br />
die Ehre einer neuerlichen Widerlegung antun.