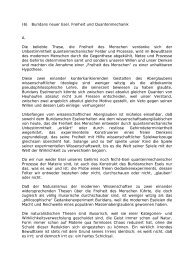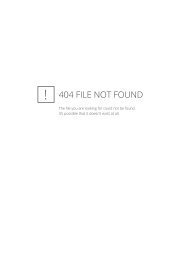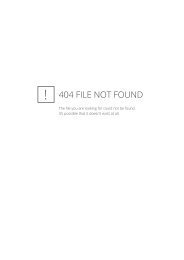ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6.<br />
Teilte man nun mit Schönberg die Ansicht, zwischen tonal und atonal sei kein qualitativer<br />
Unterschied, so bedingte dies eine Intervallbeziehung von Tönen, in der tatsächlich jeder Ton<br />
Grund seiner Beziehung zu seinem nächsten, dieser wiederum wechselwirkend für jenen<br />
wäre. 22 Jeder Ton jedes Intervalls fungierte als unmittelbarer Beziehungsgrund seiner bzw.<br />
ihrer Beziehung. Die musikalische Beziehung selbst müsste nicht als ein funktional Drittes,<br />
nicht als konkrete Vermittlung zweier unmittelbar gegebener Töne anwesend sein, - um deren<br />
Unmittelbarkeit als „gegebene“ zu vermitteln. Dieses Argument übersieht, dass das rein<br />
22 Schönbergs Weigerung, Atonalität als Privation von Tonalität zu verstehen, ein Verständnis, das sich heute als<br />
allgemeingültiges Vorurteil einzubürgern versucht, erklärt sich aus seiner bis zuletzt festgehaltenen Hoffnung,<br />
Dodekaphonie werde sich als Pantonalität erweisen. Aber weder das „Subkutane“ der dodekaphonen Werke,<br />
noch die vermeintliche Regenerationskraft der Obertonreihe, noch auch ein Wink aus Seraphitas Welt konnten<br />
Schönbergs Hoffnung erfüllen.<br />
Zur Erinnerung eines der vielen Sophismen aus Schönbergs Harmonielehre (1922, S. 487 f.): „ Es ist schon der<br />
Ausdruck: tonal unrichtig gebraucht, wenn man ihn im ausschließlichen und nicht im einschließlichen Sinn<br />
meint. Nur so kann es gelten: Alles was aus einer Tonreihe hervorgeht, sei es durch das Mittel der direkten<br />
Beziehung auf einen einzigen Grundton oder [!] durch kompliziertere Bindungen zusammengefasst, bildet die<br />
Tonalität.“ - Dies enthält bereits die petitio principii: tonal sei jede von Komponisten gesetzte „kompliziertere“<br />
Beziehung von Tönen: - eine Tonreihe ist eine Beziehung von Tönen, also ist jede Tonreihe tonal. - „Daß sich<br />
von dieser einzig richtigen Definition kein vernünftiger, dem Wort Atonalität entsprechender Gegensatz bilden<br />
lässt, muß einleuchten.“ - Richtig, aber weil die Definition falsch ist. Eine sich selbst dekretierende<br />
Vernünftigkeit ist stets ihr Gegenteil. - „Wo lässt sich hier die Negation anbringen: Soll nicht alles oder nicht was<br />
aus einer Tonreihe hervorgeht die Atonalität charakterisieren?“ - Wie und wozu soll sich an einem Begriff, der<br />
keine seine Negationen ausschließt, ein einem „Panbegriff“ von Tonalität, irgendeine Negation anbringen<br />
lassen? - Ein Musikstück wird mindestens [!] insoweit tonal sein müssen, als von Ton zu Ton eine Beziehung<br />
bestehen muß, vermöge welcher die Töne, neben- oder übereinandergesetzt, eine als solche auffaßbare Folge<br />
ergeben.“ - Besteht die Beziehung der Töne nur in ihrer Folgebeziehung? Was wäre eine reine Folgebeziehung?<br />
Durch welche Beziehungen werden Töne als eine Folge gefolgerter Töne auffaßbar? Ist jede Reihe von Tönen<br />
eine durch Beziehung vermittelte Folge von Tönen? – „Die Tonalität mag dann vielleicht weder fühlbar noch<br />
nachweisbar sein, diese Beziehungen mögen dunkel und schwerverständlich sein, unverständlich sogar.“ - Eine<br />
Beziehung von Tönen, die soeben noch eine auffaßbare, durch keine Negation negierbare Folge war, ist nun<br />
plötzlich weder fühlbar noch nachweisbar? Unverständlichkeit kann nicht Teilbegriff von Verständlichkeit sein.<br />
– „Aber atonal wird man irgend ein [!] Verhältnis von Tönen sowenig nennen können, als man ein Verhältnis<br />
von Farben als aspektral oder akomplementär bezeichnen dürfte.“ - Doch ist das Spektralverhältnis der Farben<br />
nicht „irgendeines“, sondern der durch Gesetz differenzierte Bezugskreis ihrer Einheit im Begriff des Lichtes, -<br />
daher „Komplementärfarben.“ Indem Schönberg den Unterschied von Kontingenz und Nichtkontingenz kappt,<br />
dies zugleich nicht bemerkt, wird seine Rede eine von unvernünftigen Paradoxen, - von Scheinparadoxen.<br />
(Meinungen, die ohne Sachbezug sind, können dennoch als solche ausgegeben werden.)<br />
Während für Josef Matthias Hauer der Ausdruck ‚atonal’ ein geradezu sakraler Name war, folgten Schönbergs<br />
Schüler getreulich dem „Nur so kann es gelten“ ihres Meisters. Für Anton Webern war es ein „schreckliches<br />
Wort“, für Alban Berg eine Erfindung des Teufels: „Der leibhaftige Antichrist hätte keinen teuflischeren Namen<br />
ersinnen können als dieses Wort ‚atonal’“. - (Anton Webern: Wege zur Neuen Musik. Wien 1960, S. 45. - Alban<br />
Berg: Rundfunkvortrag vom 23. April 1930, mehrfach gedruckt.)<br />
Béla Bártok teilte Schönbergs Zuversicht, ohne vielleicht dessen Obertonglauben zu teilen: „Die Musik unserer<br />
Tage strebt entschieden dem Atonalen zu. Dennoch scheint es nicht richtig zu sein, wenn das tonale Prinzip als<br />
absoluter Gegensatz des atonalen Prinzips aufgefasst wird. Das letztere ist vielmehr die Konsequenz einer<br />
allmählich aus dem tonalen entstandenen Entwicklung, welche durchaus graduell vor sich geht und keinerlei<br />
Lücken oder gewaltsame Sprünge aufweist.“ (Zitiert nach Elmar Budde: Atonalität. In: Die Musik in Geschichte<br />
und Gegenwart, Sachteil 1, Kassel 1994, Sp. 947.)<br />
Nun schließen sich aber das Graduelle und das Gegensätzliche nicht aus: jede Entwicklung kennt graduelle sich<br />
potenzierende Vorbereitungsphasen mit sich erfüllenden Sprüngen, mit siegender Revolution oder vernichtender<br />
Niederlage. Nicht ob ein Gegensatz vorliegt, ist die Frage, sondern: welches Prinzip (und welche Rationalität) ist<br />
das allgemeinere, das gründendere? Die Tonalität hätte sich solange graduell ihrer Grenze genähert, bis sie in der<br />
Atonalität als ihrem geschichtlich und sachlich höheren Tonsystem verschwunden wäre. Nach vollbrachter und<br />
weltgeschichtlich durchgesetzter Revolution wäre das Alte vom Neuen aufgesogen, enteig<strong>net</strong>, umerzogen und<br />
transformiert worden. Die Atonalität hätte sich als wirklich pantonale erwiesen, sie hätte integriert, was durch sie<br />
überwunden worden wäre.