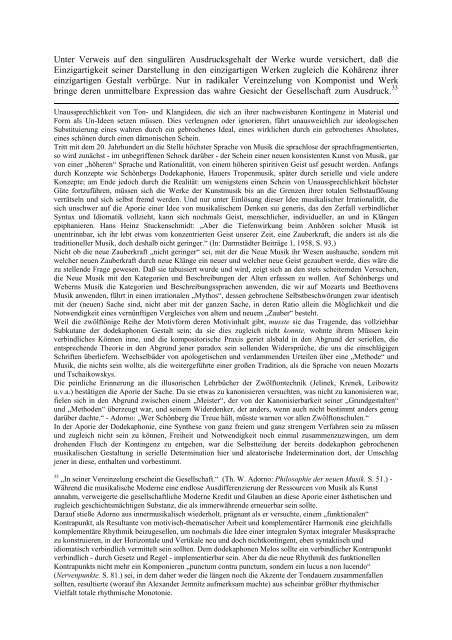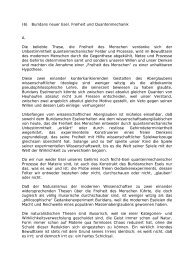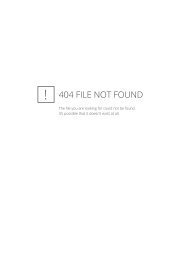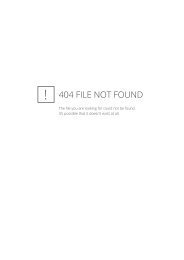ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unter Verweis auf den singulären Ausdrucksgehalt der Werke wurde versichert, daß die<br />
Einzigartigkeit seiner Darstellung in den einzigartigen Werken zugleich die Kohärenz ihrer<br />
einzigartigen Gestalt verbürge. Nur in radikaler Vereinzelung von Komponist und Werk<br />
bringe deren unmittelbare Expression das wahre Gesicht der Gesellschaft zum Ausdruck. 33<br />
Unaussprechlichkeit von Ton- und Klangideen, die sich an ihrer nachweisbaren Kontingenz in Material und<br />
Form als Un-Ideen setzen müssen. Dies verleugnen oder ignorieren, führt unausweichlich zur ideologischen<br />
Substituierung eines wahren durch ein gebrochenes Ideal, eines wirklichen durch ein gebrochenes Absolutes,<br />
eines schönen durch einen dämonischen Schein.<br />
Tritt mit dem <strong>20</strong>. Jahrhundert an die Stelle höchster Sprache von Musik die sprachlose der sprachfragmentierten,<br />
so wird zunächst - im unbegriffenen Schock darüber - der Schein einer neuen konsistenten Kunst von Musik, gar<br />
von einer „höheren“ Sprache und Rationalität, von einem höheren spiritiven Geist usf gesucht werden. Anfangs<br />
durch Konzepte wie Schönbergs Dodekaphonie, Hauers Tropenmusik, später durch serielle und viele andere<br />
Konzepte; am Ende jedoch durch die Realität: um wenigstens einen Schein von Unaussprechlichkeit höchster<br />
Güte fortzuführen, müssen sich die Werke der Kunstmusik bis an die Grenzen ihrer totalen Selbstauflösung<br />
verrätseln und sich selbst fremd werden. Und nur unter Einlösung dieser Idee musikalischer Irrationalität, die<br />
sich unschwer auf die Aporie einer Idee von musikalischem Denken sui generis, das den Zerfall verbindlicher<br />
Syntax und Idiomatik vollzieht, kann sich nochmals Geist, menschlicher, individueller, an und in Klängen<br />
epiphanieren. Hans Heinz Stuckenschmidt: „Aber die Tiefenwirkung beim Anhören solcher Musik ist<br />
unentrinnbar, ich ihr lebt etwas vom konzentrierten Geist unserer Zeit, eine Zauberkraft, die anders ist als die<br />
traditioneller Musik, doch deshalb nicht geringer.“ (In: Darmstädter Beiträge 1, 1958, S. 93.)<br />
Nicht ob die neue Zauberkraft „nicht geringer“ sei, mit der die Neue Musik ihr Wesen aushauche, sondern mit<br />
welcher neuen Zauberkraft durch neue Klänge ein neuer und welcher neue Geist gezaubert werde, dies wäre die<br />
zu stellende Frage gewesen. Daß sie tabuisiert wurde und wird, zeigt sich an den stets scheiternden Versuchen,<br />
die Neue Musik mit den Kategorien und Beschreibungen der Alten erfassen zu wollen. Auf Schönbergs und<br />
Weberns Musik die Kategorien und Beschreibungssprachen anwenden, die wir auf Mozarts und Beethovens<br />
Musik anwenden, führt in einen irrationalen „Mythos“, dessen gebrochene Selbstbeschwörungen zwar identisch<br />
mit der (neuen) Sache sind, nicht aber mit der ganzen Sache, in deren Ratio allein die Möglichkeit und die<br />
Notwendigkeit eines vernünftigen Vergleiches von altem und neuem „Zauber“ besteht.<br />
Weil die zwölftönige Reihe der Motivform deren Motivinhalt gibt, musste sie das Tragende, das vollziehbar<br />
Subkutane der dodekaphonen Gestalt sein; da sie dies zugleich nicht konnte, wohnte ihrem Müssen kein<br />
verbindliches Können inne, und die kompositorische Praxis geriet alsbald in den Abgrund der seriellen, die<br />
entsprechende Theorie in den Abgrund jener paradox sein sollenden Widersprüche, die uns die einschlägigen<br />
Schriften überliefern. Wechselbäder von apologetischen und verdammenden Urteilen über eine „Methode“ und<br />
Musik, die nichts sein wollte, als die weitergeführte einer großen Tradition, als die Sprache von neuen Mozarts<br />
und Tschaikowskys.<br />
Die peinliche Erinnerung an die illusorischen Lehrbücher der Zwölftontechnik (Jelinek, Krenek, Leibowitz<br />
u.v.a.) bestätigen die Aporie der Sache. Da sie etwas zu kanonisieren versuchten, was nicht zu kanonisieren war,<br />
fielen sich in den Abgrund zwischen einem „Meister“, der von der Kanonisierbarkeit seiner „Grundgestalten“<br />
und „Methoden“ überzeugt war, und seinem Widerdenker, der anders, wenn auch nicht bestimmt anders genug<br />
darüber dachte.“ - Adorno: „Wer Schönberg die Treue hält, müsste warnen vor allen Zwölftonschulen.“<br />
In der Aporie der Dodekaphonie, eine Synthese von ganz freiem und ganz strengem Verfahren sein zu müssen<br />
und zugleich nicht sein zu können, Freiheit und Notwendigkeit noch einmal zusammenzuzwingen, um dem<br />
drohenden Fluch der Kontingenz zu entgehen, war die Selbstteilung der bereits dodekaphon gebrochenen<br />
musikalischen Gestaltung in serielle Determination hier und aleatorische Indetermination dort, der Umschlag<br />
jener in diese, enthalten und vorbestimmt.<br />
33 „In seiner Vereinzelung erscheint die Gesellschaft.“ (Th. W. Adorno: Philosophie der neuen Musik. S. 51.) -<br />
Während die musikalische Moderne eine endlose Ausdifferenzierung der Ressourcen von Musik als Kunst<br />
annahm, verweigerte die gesellschaftliche Moderne Kredit und Glauben an diese Aporie einer ästhetischen und<br />
zugleich geschichtsmächtigen Substanz, die als immerwährende erneuerbar sein sollte.<br />
Darauf stieße Adorno aus innermusikalisch wiederholt, prägnant als er versuchte, einem „funktionalen“<br />
Kontrapunkt, als Resultante von motivisch-thematischer Arbeit und komplementärer Harmonik eine gleichfalls<br />
komplementäre Rhythmik beizugesellen, um nochmals die Idee einer integralen Syntax integraler Musiksprache<br />
zu konstruieren, in der Horizontale und Vertikale neu und doch nichtkontingent, eben syntaktisch und<br />
idiomatisch verbindlich vermittelt sein sollten. Dem dodekaphonen Melos sollte ein verbindlicher Kontrapunkt<br />
verbindlich - durch Gesetz und Regel - implementierbar sein. Aber da die neue Rhythmik des funktionellen<br />
Kontrapunkts nicht mehr ein Komponieren „punctum contra punctum, sondern ein lucus a non lucendo“<br />
(Nervenpunkte. S. 81.) sei, in dem daher weder die längen noch die Akzente der Tondauern zusammenfallen<br />
sollten, resultierte (worauf ihn Alexander Jemnitz aufmerksam machte) aus scheinbar größter rhythmischer<br />
Vielfalt totale rhythmische Monotonie.