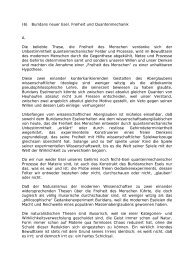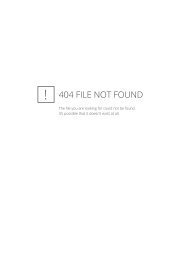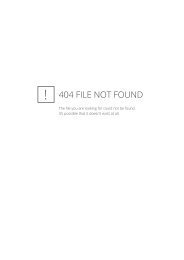ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
ZUM PARADIGMENWECHSEL DER MUSIK IM 20 ... - leo-dorner.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wunder leisten zu können.) Und die Zusicherung, das Subkutane eines verborgenen, sei es<br />
auch dämonischen Zusammenhanges werde dereinst als verbindliche Rationalität<br />
musikalischer Freiheit fassbar werden, ist als jene Illusion durchschaubar geworden, die den<br />
revolutionären Elan und die utopische Verheißungskraft der musikalischen Moderne bis hin<br />
zu Adornos „Philosophie der neuen Musik“ beflügelte. 32<br />
32 Obwohl die Schönbergschule den emphatischen Anspruch erhob, aus kompositorischer und denkerischer Kraft<br />
allein eine neue Sprache für eine neue Kunstmusik entdeckt zu haben, eine Sprache, in der Zusammenhang und<br />
Fasslichkeit das Alpha und Omega des Komponierens und Hörens sei, bemühte sie alsbald die Kategorie des<br />
„Subkutanen“, diesen Brosamen unbewusster Rezeption verborgener Zusammenhänge, um die Glaubwürdigkeit<br />
des Brillanten Reihe zu retten. Den emphatischen Gesetzgebern konnte nicht verborgen bleiben, daß ein<br />
Problematisches und zutiefst Fragwürdiges, eine merkwürdige innere Gebrochenheit an der neuen Fasslichkeit<br />
bestehen blieb. Die Diskussionen in der Schule müssen heftig gewesen sein (vgl. Anmerkung 34), und<br />
keineswegs primär durch die schmerzhaft erfahrene Reaktion eines sich verweigernden Publikums veranlasst.<br />
Adornos bedrohlicher Befund lautete: „Die Stimmigkeit von Zwölftonmusik lässt sich nicht unmittelbar ‚hören’<br />
- das ist der einfachste Name für jenes Moment des Sinnlosen an ihr.“ (Philosophie der neuen Musik. Frankfurt<br />
1958, S. 113.) Doch schien eine listige Erklärung Adornos den Stachel der Unstimmigkeit und die Gefahr des<br />
Sinnlosen milde zu bannen: die Dodekaphonie, die nach Webern sogar mehr als ein Tonalitätsersatz sein sollte,<br />
sollte eben doch kein Tonalitätsersatz, sondern nur „gleichsam“ einer sein. „Doch ist die Zwölftontechnik<br />
keineswegs, wie man sie vielfach missversteht, ein Tonalitätsersatz, da sie die musikalischen Ereignisse<br />
gleichsam hinter [!] der Szene vorformt. Jede Komposition wird aus ihrer besonderen Reihe neu konstruiert, [!]<br />
kein hörbares und unverrückbares Bezugssystem umfängt die musikalischen Einzelereignisse.“ (Musikalische<br />
Schriften V. S. 318.)<br />
Folglich ist die Reihe die uneigennützigste Dienerin ihres Herrn, des Werkes guter Geist, so virtuos im Dienst an<br />
den Motiven und Themen verschwindend, daß sie und ihr Dienst den neugierigen Hörer rein gar nichts angeht.<br />
Die Reihe ist „nichts, was zu bemerken wäre und was bemerkt werden sollte; im Gegenteil, würde die Reihe als<br />
solche hervortreten, so gestattete sie einen kunstfremden Blick in die Werkstatt dort, wo lediglich das Gebilde<br />
für sich selbst einstehen soll.“ - Es scheint gleichsam wie in tonaler Musik zu sein: an Beethovens<br />
Freudemelodie deren diatonische, harmonische, rhythmische und sonstige formale Nomenklatur als deren<br />
Substanz und ästhetischen Zweck (womöglich als „Fasslichkeit“) nachzuvollziehen (das kunstgewerblich<br />
Banausische an Heinrich Schenkers Musiktheorie und Werkanalysen), wäre allerdings ein kunstfremder Blick in<br />
die Werkküche der Melodie, ein Blick, den lediglich die formale Analyse zu spezialistischen oder pädagogischen<br />
Zwecken auf das Werk werfen darf. Aber das Problem der dodekaphonen Reihe ist nicht nur deren kontingente<br />
(daher verschwinden sollende) Verwendung im Werk, es ist schon die Kontingenz der vermeintlich stimmigen<br />
Vororganisation des Materials das Faktum eines unlösbaren Problems.<br />
Die diatonische „Reihe“ im tonalen Thema muß stets konstitutiv mitgehört werden (sie muß sich ihres<br />
Vororganisierens nicht schämen), weil Themenform und Themeninhalt noch dialektisch eins sind; daher vermag<br />
sich das tonale Hören den Luxus eines sowohl subkutanen wie eines bewusst strukturellen Vollzuges zu leisten;<br />
unbewusst wird daher dem Laien in tonaler Musik dasselbe bewusst wie dem Kenner; eine Differenz und<br />
Identität von Laie und Kenner, von unbewusst und bewusst, die dem dodekaphonen Werkgeist völlig abhanden<br />
gekommen ist: würde nämlich die dodekaphone Reihe im Werk als solche vernommen, träte die Unvermitteltheit<br />
ihres Aggregatums als bewiesener Grund von Adornos Sinnlosigkeitsverdacht unmittelbar zutage; daher soll sie<br />
nicht gehört werden, daher soll sie in der Maske eines deus ex machina verhüllt bleiben und wirken. In<br />
dodekaphoner Musik ist jeder sein eigener Autodidakt, in ihr gibt es nur Laien als selbsternannte Könner,<br />
gleichsam selbsterfundene Autodidakten sind: ihrer selbst nicht bewusste Scharlatane. (Zur Dämonologie des<br />
musikgeschichtlichen Prozesses vgl. Anmerkung 37.)<br />
Der vehementeste Vertreter (Gläubiger) eines höchsten musikalischen Zusammenhanges, einer stimmigsten<br />
Fasslichkeit durch Dodekaphonie war Anton Webern. Wie Bach an einem Thema zeigen wollte, „was alles aus<br />
einem einzigen Gedanken geholt werden kann“, so liegt „dieselbe Denkungsart“ trotz aller Unterschiede „im<br />
einzelnen“ auch der Zwölftonmusik zugrunde. (Anton Webern: Der Weg zur Komposition in zwölf Tönen. S. 59.)<br />
Folgerichtig werden die bewährten Tafeln scheingültiger Gleichungen aufgerichtet: „Dem Sinne nach ist die<br />
‚Kunst der Fug’ das gleiche wie das, was wir in der Zwölftonkomposition schreiben. Bei Bach sind es die sieben<br />
Töne der alten Skala, hier liegt die chromatische Skala zugrunde. Auf dieser neuen Basis wird jetzt erfunden.“<br />
Daher ist zunächst auch nicht ersichtlich, weshalb sich diese neue Basis hinter der Szene verstecken muß, noch<br />
weniger, weshalb sich deren Stimmigkeit nicht sollte hören lassen.<br />
Jedenfalls ein Affront gegen Adorno als Ideologen eines strukturellen Hörens, dem angehörs Neuer Musik<br />
aufgetragen wurde, daß „sein Ohr, wolle es nicht hilflos zurückbleiben, die ganze Arbeit des Komponierens von<br />
sich aus noch einmal leisten müsse.“ Und dennoch sollte das Kernstück des neuen Geistes, „die Methode mit nur<br />
aufeinander bezogenen zwölf Tönen“ zu komponieren, vom Nachvollzug ausgeschlossen sein? „Daß Schönbergs<br />
Musik vom Hörer so viel Kraft der Konzentration, so viel kombinatorische Fähigkeit, so viel Geist verlangt, wie