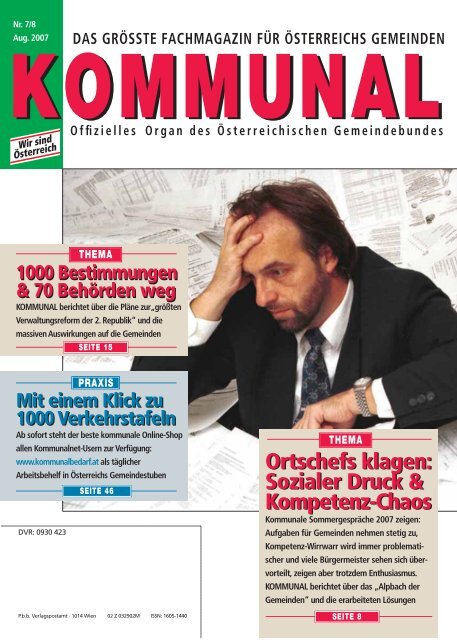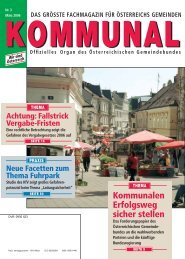DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 7/8<br />
Aug. 2007<br />
<strong>DAS</strong> <strong>GRÖSSTE</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>ÖSTERREICHS</strong> <strong>GEMEINDEN</strong><br />
KOMMUNAL<br />
Wir sind<br />
Österreich<br />
DVR: 0930 423<br />
Offizielles Organ des Österreichischen Gemeindebundes<br />
THEMA<br />
1000 Bestimmungen<br />
& 70 Behörden weg<br />
KOMMUNAL berichtet über die Pläne zur„größten<br />
Verwaltungsreform der 2. Republik“ und die<br />
massiven Auswirkungen auf die Gemeinden<br />
SEITE 15<br />
PRAXIS<br />
Mit einem Klick zu<br />
1000 Verkehrstafeln<br />
Ab sofort steht der beste kommunale Online-Shop<br />
allen Kommunalnet-Usern zur Verfügung:<br />
www.kommunalbedarf.at als täglicher<br />
Arbeitsbehelf in Österreichs Gemeindestuben<br />
SEITE 46<br />
P.b.b. Verlagspostamt · 1014 Wien 02 Z 032902M ISSN: 1605-1440<br />
THEMA<br />
Ortschefs klagen:<br />
Sozialer Druck &<br />
Kompetenz-Chaos<br />
Kommunale Sommergespräche 2007 zeigen:<br />
Aufgaben für Gemeinden nehmen stetig zu,<br />
Kompetenz-Wirrwarr wird immer problematischer<br />
und viele Bürgermeister sehen sich übervorteilt,<br />
zeigen aber trotzdem Enthusiasmus.<br />
KOMMUNAL berichtet über das „Alpbach der<br />
Gemeinden“ und die erarbeiteten Lösungen<br />
SEITE 8
Martina Taferner<br />
1.)<br />
Elke Fiedler<br />
Johannes Fries<br />
Gerhard Huemer<br />
DIE NUMMER 1 IN PUBLIC FINANCE.<br />
IHR TEAM <strong>FÜR</strong> DIE REALISIERUNG IHRER FINANZIERUNGSVORHABEN.<br />
www.kommunalkredit.at<br />
Elfriede Holzinger
Gemeindepolitik<br />
6 Gemeinden werden sich nicht auseinander<br />
dividieren lassen: Gefährliches Sommerloch<br />
8 Weg mit Landtagen? Ortschefs zu gutmütig?<br />
„Alpbach der Gemeinden“ diskutierte heiße Fragen<br />
18 54. Österrichischer Gemeindetag in Klagenfurt:<br />
Nur mehr knapp fünf Wochen<br />
20 Top-Event KOMMUNALMESSE 2007:<br />
Ausverkauft – Nur mehr Platz auf der Warteliste<br />
24 Europas Diskussion zur Daseinsvorsorge:<br />
Ist „öffentlich“ gleich „nicht rentabel“?<br />
31 Umfrage: Gemeinden kämpfen gegen Vandalen<br />
Recht & Verwaltung<br />
15 Gemeinden sind von der geplanten „größten<br />
Verfassungsbereinigung der 2. Republik“ betroffen<br />
16 Ist die Selbstverwaltung in Österreich in<br />
Gefahr? Wehret den Anfängen!<br />
26 Mietvertragsklauseln: OGH-Entscheidung klärt,<br />
bei wem die Erhaltungspflicht liegt<br />
Europapolitik<br />
32 Der Europarat – seit 1949 im Dienste der Bürger<br />
34 Reformvertragsentwurf: Forderungen umgesetzt<br />
37 Making it happen – Regionen machen’s möglich<br />
KOMMUNAL<br />
PRAXIS<br />
Public Management<br />
46 Mit einem Klick zu 1000 Verkehrszeichen:<br />
Ab sofort steht der beste kommunale<br />
Online-Shop allen Kommunalnet-Usern<br />
zur Verfügung: www.kommunalbedarf.at<br />
52 Vom Amtsleiter zum Public Manager:<br />
Das Unternehmen Kommunalverwaltung<br />
Energie in der Gemeinde<br />
72 Auf dem Weg zur energieeffizienten<br />
Gemeinde: Viele Möglichkeiten<br />
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
Inhalt<br />
80 KfV-Sicherheits-Tipps: Wenn der Berg ruft<br />
82 „Gemeinde“-Minister Günther Platter sucht<br />
den „Zivildiener des Jahres“<br />
84 Der 19. Bürgermeistertag in Wieselburg:<br />
Miteinander zum Erfolg<br />
86 Aus den Bundesländern<br />
90 Info-Mix<br />
KOMMUNAL 3
Fachmesse für Öffentliche Verwaltung, Infrastruktur,<br />
kommunale Ausstattung und Umweltschutz<br />
27./ 28. September 2007<br />
Messezentrum Klagenfurt<br />
Im Rahmen der größten<br />
kommunalpolitischen Veranstaltung, des<br />
54. Österreichischen Gemeindetages<br />
des Österreichischen Gemeindebundes<br />
Information:<br />
Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH<br />
1010 Wien, Löwelstraße 6/2.Stock<br />
Tel: 01/532 23 88-11<br />
E-Mail: johanna.ritter@kommunal.at
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Österreichischer Gemeindebund,<br />
Löwelstraße 6, 1010 Wien<br />
Medieninhaber:<br />
Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH.,<br />
Löwelstr. 6, 2. Stock, 1010 Wien,<br />
Tel.: 01/532 23 88, Fax: 01/532 23 77,<br />
E-Mail: kommunalverlag@kommunal.at<br />
Geschäftsführung:<br />
Walter Zimper<br />
Sekretariat: Patrizia Poropatits<br />
E-Mail: patrizia.poropatits@kommunal.at<br />
www.kommunal.at<br />
Redaktion: Tel.: 01/ 532 23 88<br />
Mag. Hans Braun - DW 16 (Leitung)<br />
Mag. Helmut Reindl - DW 15<br />
E-Mail: redaktion@kommunal.at<br />
Anzeigenberatung:<br />
Tel.: 01/532 23 88<br />
Johanna K. Ritter – DW 11<br />
johanna.ritter@kommunal.at<br />
Mag. Sabine Brüggemann – DW 12<br />
sabine.brueggemann@kommunal.at<br />
Gerhard Klodner – DW 14<br />
gerhard.klodner@kommunal.at<br />
Heinz Lederer – DW 19<br />
heinz.lederer@kommunal.at<br />
Grafik:<br />
Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH.,<br />
Ernst Horvath, grafik@kommunal.at<br />
Fotos: www.bilderbox.at<br />
www.bilder.services.at<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Mag. Ewald Buschenreiter (Verbandsdirektor<br />
der sozialdemokratischen Gemeindevertreter NÖ),<br />
Mag. Jürgen Beilein (BM für Gesundheit,<br />
Familien und Jugend)<br />
Mag. Martin Brandstötter (BM für Inneres)<br />
Mag. Nicolaus Drimmel<br />
(Österreichischer Gemeindebund)<br />
Dr. Gustav Fischer (BM für Land- und<br />
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)<br />
Mag. Michael Girardi (BM für Inneres)<br />
Prof. Dr. Roman Häußl<br />
(Experte f. Gemeinderecht)<br />
Mag. Petra Hafner (BM für Unterricht, Kunst<br />
und Kultur)<br />
Dr. Robert Hink (Generalsekretär des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Dr. Clemes Hüffel (BM für Wissenschaft und<br />
Forschung)<br />
Daniel Kosak (Pressereferent des<br />
Österreichischen Gemeindebundes)<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer (Präsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Mag. Georg Möstl (BM für Wirtschaft & Arbeit)<br />
Eduard Olbrich (BM für Soziales und<br />
Konsumentenschutz<br />
Prof. Dietmar Pilz (Finanzexperte des<br />
Österreichischen Gemeinde bundes),<br />
Dr. Walter Reichel (Bundeskanzleramt),<br />
Univ. Prof. Dr. Reinbert Schauer<br />
(Johannes Kepler-Universität Linz),<br />
Prof. Walter Zimper (Verleger),<br />
Walter Zimper jun. (Geschäftsführer)<br />
Cornelia Zoppoth (Bundeskanzleramt)<br />
Hersteller:<br />
Leykam Druck, 7201 Neudörfl<br />
Persönlich gezeichnete Artikel fallen unter die<br />
Verantwortlichkeit des Autors und müssen sich<br />
nicht unbedingt mit der Meinung von<br />
KOMMUNAL decken.<br />
Mit „E.E.“ gekennzeichnete oder unter der<br />
Bezeichnung „Service“ laufende Artikel sind<br />
bezahlte Informationen und fallen nicht in die<br />
Verantwortlichkeit der Redaktion.<br />
Druckauflage: 34.651<br />
(Jahresdurchschnitt 2006)<br />
Teilen dieser Ausgabe liegen Informatio -<br />
nen der ARGE Forum mineralische Rohstoffe,<br />
der Firma Auer – Bausoftware<br />
sowie Unibind Austria bei.<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Editorial<br />
Die Sommerpause war kurz und neigt sich ihrem Ende zu. In ihren Händen halten<br />
Sie die sommerliche Doppelnummer der größten kommunalen Zeitschrift, vollgepackt<br />
mit brandaktuellen Themen für Gemeinden. Ein Großereignis liegt schon<br />
hinter uns, die kommunalen Sommergespräche von Bad Aussee, bei denen Mitte<br />
Juli Kommunalpolitiker, Experten und Wirtschaftsgrößen über die kommenden<br />
Herausforderungen diskutiert und Lösungen erarbeitet haben. Selbstverständlich<br />
war KOMMUNAL bei diesen Sommergesprächen vor Ort dabei und berichtet für<br />
Sie exklusiv.<br />
Der Höhepunkt des kommunalen Jahres steht allerdings noch bevor: Am 27. und<br />
28. September 2007 geht in Klagenfurt der 54. Österreichische Gemeindetag über<br />
die Bühne, der die Daseinsvorsorge zum inhaltlichen Schwerpunkt hat. Dazu passt<br />
auch ideal der Gastbeitrag von Dr. Caspar Einem in dieser Ausgabe. Rund 2000<br />
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden am Gemeindetag teilnehmen, Fachtagungen<br />
und spezielle Veranstaltungen umrahmen den politischen Teil der Veranstaltung,<br />
für die höchste Prominenz schon zugesagt hat. Das Who is who der heimischen<br />
Innenpolitik, angeführt von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, gibt sich<br />
ein Stelldichein.<br />
Für die Praktiker in der Gemeindepolitik unerlässlich: Die KOMMUNALMESSE, die<br />
genau wie der Gemeindetag selbst, am Messegelände in Klagenfurt stattfindet. Hier<br />
gibt es einen Rekord zu vermelden: Mehr als 120 Aussteller präsentieren ihre<br />
Produkte und Dienstleistungen für den kommunalen Bereich. Noch nie war das<br />
Interesse der Aussteller so groß, inzwischen gibt es sogar Wartelisten für Firmen,<br />
die aus Platzgründen nicht mehr zum Zug gekommen sind. Der Erfolg und die<br />
Bedeutung dieser Messe nehmen von Jahr zu Jahr zu. Kein Wunder: Sind es doch<br />
die Gemeinden, die den größten Anteil an Investitionen im Land leisten, mehr als<br />
der Bund, mehr als alle Bundesländer zusammen. Selbstverständlich wird<br />
KOMMUNAL, mit einer Sonderausgabe, vor Ort von allen Ereignissen berichten.<br />
Der Gemeindetag selbst wird wohl auch in die heiße Phase der Verhandlungen zu<br />
einem neuen Finanzausgleich fallen und daher sind sowohl vom Kanzler als auch<br />
vom Finanzminister spannende Aussagen zu erwarten. Die Übertragung weiterer<br />
Aufgaben an die Gemeinden hingegen lässt sich in einem einfachen Satz<br />
zusammen fassen: „Ohne Geld ka Musi!“<br />
Weiters in dieser Ausgabe von KOMMUNAL: Die Vorbereitungen zum 60. Geburtstag<br />
des Gemeindebundes sowie die neueste Entwicklung zur Verfassungsreform,<br />
die für die Gemeinden gravierende Änderungen nach sich ziehen könnte. Im Sinne<br />
der Aktion „1000 Bürgermeister fahren nach Europa“ berichten wir auch über die<br />
im Herbst bevorstehende Bürgermeisterreise nach Lissabon. Seit Jahren schon<br />
berichtet KOMMUNAL über die neuesten Entwicklungen auf europäischer Ebene,<br />
die für Gemeinden relevant sind. Kein anderes Magazin legt so großen Wert auf<br />
faire und ausgewogene Berichterstattung über europäische Themen. Aus gutem<br />
Grund: Ein Großteil jener Gesetze und Verordnungen, die in Brüssel entstehen,<br />
wirkt sich früher oder später auch sehr direkt auf Österreichs Gemeinden aus.<br />
Genießen Sie die letzten Sommertage, wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim<br />
KOMMUNAL-Stand am 54. Österreichischen Gemeindetag und der<br />
KOMMUNALMESSE in Klagenfurt.<br />
Prof. Walter Zimper<br />
KOMMUNAL-Verleger<br />
KOMMUNAL 5
Kommentar<br />
Gemeinden werden sich nicht auseinander dividieren lassen<br />
Gefährliches Sommerloch<br />
Es war ein ungeschriebenes Gesetz,<br />
dass in der Ferienzeit auch die<br />
Politik sich zu einer Ruhe- und<br />
Erholungspause zurückzieht. Das ist<br />
auch der Sinn eines Urlaubs, dass man<br />
in Musestunden neue Kraft tankt und<br />
sich für neue Herausforderungen<br />
stärkt. Das trifft natürlich auch auf jene<br />
Menschen zu, die die Geschicke dieses<br />
Landes führen und somit eine besondere<br />
Verantwortung für die Bürgerinnen<br />
und Bürger tragen. Wenn man<br />
allerdings den politischen Sommer, der<br />
meist geprägt ist von einem Loch,<br />
beobachtet, so fällt heuer eine besonders<br />
hektische Aktivität auf. Und so<br />
mancher hohe Politiker fällt von einem<br />
Loch ins andere oder tritt von einem<br />
Fettnäpfchen ins andere. Der Jahrmarkt<br />
der Eitelkeiten oder die Börse der<br />
unmöglichsten Ideen erlebt in diesem<br />
Sommer einen besonderen Höhepunkt.<br />
Da gibt es tagtäglich neue Vorschläge,<br />
wie man das jetzt etwas stärker sprudelnde<br />
Steuergeld, das aber bei Weitem<br />
noch nicht ausreicht, um die derzeitigen<br />
Ausgaben zu finanzieren, unter die<br />
Leute bringen kann: Vom Papa-Monat<br />
bis zur pädagogischen Bewertung dreijähriger<br />
Kinder reicht die Palette.<br />
Und schließlich darf natürlich auch die<br />
„Reformitis“ nicht fehlen. In Sommer-<br />
Interviews leuchten die Ideenblitze von<br />
selbsternannten Experten auf, wo und<br />
wie man überall Milliarden einsparen<br />
könne. Dass davor nicht einmal der<br />
Rechnungshof gefeit ist, erfüllt mit<br />
gewisser Sorge.<br />
Der Österreichische Gemeindebund<br />
ist nicht der Versuchung<br />
unterlegen, sich mit großspurigen<br />
Ankündigungen in die Sommerloch-Debatte<br />
einzubringen, sondern hat<br />
sich zu einer Arbeitsklausur zurückgezogen.<br />
Über hundert Kommunalpolitikerinnen<br />
und Kommunalpolitiker<br />
haben sich mit Wissenschaftern aus<br />
Politik und Wirtschaft im steirischen<br />
Bad Aussee zur Diskussion über die<br />
zukünftigen Aufgaben der Gemeinden<br />
versammelt. Die Ergebnisse dieses offenen<br />
Dialogs zeigen, dass sich der<br />
rasante Wandel in der Struktur und bei<br />
der Aufgabenstellung der Gemeinden<br />
verstärkt fortsetzen wird. Sowohl die<br />
Gemeindepolitik als auch ihre Interessensvertretung<br />
wird noch mehr gefor-<br />
6 KOMMUNAL<br />
dert werden, die Bürger werden ihre<br />
erste und wichtigste politische Servicestelle<br />
noch intensiver in Anspruch nehmen<br />
und noch mehr Qualität einfordern.<br />
Das muss auch unseren Partnern auf<br />
Landes- und Bundesebene bewusst<br />
werden, wenn wir jetzt über die Verteilung<br />
der Steuermittel in Form des<br />
Finanzausgleichs verhandeln. Wenn<br />
man den Bürgern die hohe Lebensqualität<br />
garantieren will, dann muss man<br />
auch den Gemeinden mehr Geld geben.<br />
Vor allem die kleinen und mittleren<br />
Gemeinden werden zur Verbesserung<br />
und zum Erhalt ihrer Infrastruktur<br />
einen größeren Anteil brauchen. Und<br />
diese Forderung wird nicht dadurch<br />
erfüllt werden können, dass man den<br />
anderen Gemeinden dieses Geld einfach<br />
wegnimmt, sondern dass man<br />
zusätzliches Geld auf den Tisch legt.<br />
Es kann nicht Ziel einer Interessensvertretung<br />
sein, dass man vom<br />
Verhandlungstisch aufsteht und<br />
zur Kenntnis nimmt, dass es Gewinner<br />
und Verlierer gibt, sondern insgesamt<br />
muss den Gemeinden wieder jener<br />
Anteil zukommen, der möglichst<br />
gerecht ist und den Erwartungen der<br />
Bürger einiger Maßen entspricht. Wenn<br />
ich daran denke, was in den vergangenen<br />
Wochen alles den Bürgern in Aussicht<br />
gestellt wurde, dann müssten die<br />
Kassen bei so manchem Bundespolitiker<br />
recht locker sitzen. Aber die harte<br />
Realität schaut meist anders aus. Und<br />
deshalb ist es gut, wenn die Zeit der<br />
gefährlichen Sommerlöcher bald vorbei<br />
ist und die großsprechenden Politiker<br />
auf den Boden der Vernunft zurückgeholt<br />
werden.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Präsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
»<br />
Die Forderung nach<br />
mehr Geld wird nicht<br />
dadurch erfüllt<br />
werden können, dass<br />
man dieses den<br />
anderen Gemeinden<br />
einfach wegnimmt,<br />
sondern dass man<br />
zusätzliches Geld auf<br />
den Tisch legt.<br />
«
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
Rechnungshof: Vier Milliarden Euro gesucht mit teils sechs Jahre alten Ideen<br />
Alte Hüte in neuem Gewand<br />
Für großes Aufsehen sorgen<br />
die jüngsten Vorschläge des<br />
Rechnungshofes, durch die in<br />
der öffentlichen Verwaltung<br />
vier Milliarden Euro eingespart<br />
werden sollen. Bei<br />
genauerer Durchsicht verlieren<br />
die 206 Empfehlungen<br />
einiges an Glanz – manche<br />
der Vorschläge stammen aus<br />
2001. Zudem sollen allein<br />
rund 2,5 Milliarden Euro mit<br />
Einsparungen bei den ÖBB-<br />
Pensionen und bei der Wohn-<br />
Natura 2000: Klage<br />
EU-Kommission<br />
klagt Österreich<br />
Ende Juni reichte die EU-<br />
Kommission Klage beim<br />
Europäischen Gerichtshof<br />
wegen unvollständiger<br />
Umsetzung der Habitat- sowie<br />
der Vogelschutzrichtlinie.<br />
Österreich wird vorgeworfen,<br />
weder eine ausreichende<br />
Anzahl von Naturschutzgebieten<br />
ausgewiesen, noch die<br />
Vogelschutzrichtlinie im erforderlichen<br />
Ausmaß umgesetzt<br />
zu haben. http://europa.eu<br />
bauförderung gewonnen<br />
werden. Unter den restlichen<br />
204 Vorschlägen sind u.a. so<br />
veraltete wie „die Gemeinden<br />
sollen ihre Siedlungswasserwirtschaft<br />
in Verbänden<br />
erledigen“ (wird zu 95<br />
Prozent bereits erledigt).<br />
Bei den Pensionsregelungen<br />
kritisiert der Rechnungshof<br />
Länder und Gemeinden pauschal:<br />
Die Beamtenpensionen<br />
seien zu hoch und weit über<br />
dem Durchschnitt der Bun-<br />
Bis hierher und nicht weiter<br />
desbeamten. Länder und<br />
Gemeinden (die kaum mehr<br />
Beamte haben!) sollen die<br />
Pensionsreform des Bundes<br />
nachvollziehen.<br />
Unterm Strich kritisiert der<br />
Gemeindebund, dass „es niemandem<br />
etwas nützt, wenn<br />
der Rechnungshof hier Luftschlösser<br />
baut, am Ende sind<br />
alle enttäuscht, dass die Ein -<br />
sparungsmöglichkeiten geringer<br />
als angenommen sind.“<br />
www.gemeindebund.at<br />
Tourismus: Muxel für koordinierte Ferienzeiten<br />
EU-Kommission „kennt Problem“<br />
Da die EU-Kommission derzeit<br />
ihre für September<br />
angekündigte Mitteilung zur<br />
Agenda 21 für nachhaltigen<br />
Tourismus vorbereitet, traf<br />
sich Bgm. Ludwig Muxel<br />
(Lech) Anfang Juli mit Kommissar<br />
Günter Verheugens<br />
Kabinettschefin Petra Erler,<br />
um die Anliegen der Arbeits-<br />
Werbesteuer: Ersatzloser Wegfall kommt nicht in Frage<br />
„Ein ersatzloser Wegfall der<br />
Werbesteuer kommt für die<br />
österreichischen Gemeinden<br />
ganz sicher nicht in Frage“,<br />
hielt im Juli Gemeindebund-<br />
Vizepräsident Bgm. Alfred<br />
Riedl (Grafenwörth) fest.<br />
„Man kann nicht nach der<br />
Reihe Steuern abschaffen, an<br />
denen die Gemeinden beteiligt<br />
sind, gleichzeitig den<br />
Gemeinden aber immer neue<br />
Aufgaben aufbürden“, so<br />
Riedl.<br />
Riedl bezog sich mit dieser<br />
Klarstellung auf diverse<br />
Medienberichte, wonach<br />
sowohl Kanzler Gusenbauer,<br />
als auch Vizekanzler und<br />
Finanzminister Molterer signalisiert<br />
hatten, die Werbesteuer<br />
abschaffen zu wollen.<br />
„Wenn jemand an der derzeitigen<br />
Form der Werbesteuer<br />
Veränderungsbedarf sieht,<br />
dann wird er das mit uns bei<br />
den Verhandlungen zum<br />
Finanzausgleich besprechen<br />
gruppe nachhaltiger Tourismus<br />
(TSG) zu erläutern. Der<br />
von Muxel angeregten Koordinierung<br />
der Ferienzeiten<br />
erteilte Erler mangels Zuständigkeit<br />
zwar eine Absage, gab<br />
jedoch zu erkennen, dass sich<br />
die Kommission der Problematik<br />
durchaus bewusst sei.<br />
Für Gemeindebund-Vizepräsident<br />
Bgm. Alfred<br />
Riedl ist „das Maß voll“.<br />
Rechnungshofpräsident Josef<br />
Moser (re.) überreicht Finanzminister<br />
Wilhelm Molterer den<br />
Katalog mit 206 teils veralteten<br />
Vorschlägen.<br />
Interkultureller Dialog<br />
Europarat startet<br />
Programm<br />
Der Europarat und somit auch<br />
der Kongress der Gemeinden<br />
und Regionen (KGRE) starten<br />
ein Programm zum interkulturellen<br />
Dialog. Erleichtert<br />
werden soll v.a. der best-practice<br />
Austausch zwischen Kommunen<br />
mit stark gemischter<br />
Bevölkerung und Lösungsansätze<br />
aufzeigen werden.<br />
Infos beim Brüsseler Büro des<br />
Gemeindebunds unter Tel:<br />
0032-2-2820680<br />
müssen“, so Riedl. „Wir werden<br />
uns solchen Gesprächen nicht verweigern,<br />
wenn man uns klar sagt,<br />
wie man den Gemeinden die<br />
dadurch wegfallenden Einnahmen<br />
ersetzen will“, betonte Riedl. Seit<br />
den 1990er Jahren seien die<br />
Anteile der Gemeinden am<br />
Gesamtsteueraufkommen rückläufig.<br />
Irgendwann sei der Punkt<br />
erreicht, an dem auch die Gemeinden<br />
sagen müssen: „Bis hierher<br />
und nicht weiter! Der Wegfall der<br />
Gemeindeanteile an der Werbesteuer<br />
wäre ein Verlust, den wir<br />
ersatzlos ganz sicher nicht hinnehmen<br />
werden.“<br />
KOMMUNAL 7
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
„Alpbach der Gemeinden“ diskutierte heiße & heikle Fragen<br />
Weg mit Landtagen<br />
Ortschefs zu gutmütig?<br />
Heiß her ging es im steirischen Bad Aussee Mitte Juli. Nicht nur Temperaturen von mehr<br />
als 36 Grad beschäftigten die rund 150 Teilnehmer der 2. Kommunalen Sommergespräche.<br />
Provokante Fragen wie „Brauchen wir die Landtage überhaupt noch?“ knallten ihnen um<br />
die Ohren. Auch als die Feststellung getroffen wurde, dass die Bürgermeister „gutmütige<br />
Dodln“ seien, weil sie diesen Job überhaupt machen, gingen die Emotionen hoch.<br />
KOMMUNAL war bei drei fesselnden und zugleich befruchtenden Tagen dabei.<br />
◆ Mag. Hans Braun<br />
Schon zum zweiten Mal nach 2006 versammelten<br />
sich in Bad Aussee, der „geographischen<br />
Mitte Österreichs“, Kommunalpolitiker,<br />
Wissenschafter und Wirtschaftsgrößen<br />
aus ganz Österreich (siehe<br />
Kasten Seite 14), um über aktuelle kommunale<br />
Zukunftsthemen zu diskutieren.<br />
In einer enspannten Atmosphäre wurden<br />
unbeschwert von Alltagssorgen Themen<br />
besprochen, die ans „Eingemachte“<br />
bei den Gemeinden gingen. Die „Bundesstaatsreform“,<br />
die „Finanzierung<br />
öffentlicher Aufgaben“ und „Kommunale<br />
Manager und Managerinnen gesucht“<br />
waren die komplexen Fragen, die diskutiert<br />
wurden.<br />
8 KOMMUNAL<br />
Als Diskussions- und Arbeitsgrundlage<br />
hatten die Universitätsprofessoren<br />
Dr. Wolfgang Mazal und Dr. Karl Weber<br />
sowie Nationalbank-Ökonom Univ. Doz.<br />
Dr. Heinz Handler Papiere erstellt, die<br />
von den Teilnehmern in Workshops<br />
(unter Leitung der Experten) diskutiert<br />
wurden (siehe auch KOMMUNAL, Ausgaben<br />
4, 5 und 6/2007).<br />
Die drei Experten servierten mit ihren<br />
Vorschlägen also das „Menü“ der Sommergespräche<br />
mit teils existenziell wichtigen,<br />
aber nichtsdesto trotz oft „trockenen“<br />
Themen.<br />
Die Podiumsdiskussionen im Vorfeld der<br />
Workshops mit ihren klugen, erfahre-<br />
Gelöste Stimmung bei der Eröffnung: Gemeindebund-Vizepräsident Bernd Vögerle,<br />
Steiermarks Landeshauptmann Franz Voves, Bad Aussees Bürgermeister Otto Marl mit<br />
Narzissenprinzessin Anke Stadler, Landesrat Christian Buchmann, Gemeindebundpräsident<br />
Helmut Mödlhammer, Kommunalkredit-Generaldirektor Reinhard<br />
Platzer, der Präsident des Steiermärkischen Gemeindebundes, Hermann Kröll und<br />
Gemeindebund-Vizepräsident Alfred Riedl.<br />
nen, realistischen, deftigen, provokanten<br />
und manchmal „politisch nicht korrekten“<br />
Wortmeldungen lieferten den Sommergesprächen<br />
dann „die Beilagen“.<br />
„Heiße Debatten“ in Bad<br />
Aussees heißem Kursaal<br />
Gleich mehrere Faktoren sorgten für<br />
„heiße Debatten“ im Kursaal – und das<br />
geringste war die Luft, die mit Fortschreiten<br />
der Gespräche immer schneidender<br />
und schwüler wurde.<br />
Dazu trug etwa die Feststellung Georg<br />
Lienbachers, des Vorsitzenden der<br />
Arbeitsgruppe zur Staats- und Verwaltungsreform,<br />
bei, dass das Subsidiaritäs -<br />
prinzip in zwei Richtungen geht. Nicht<br />
nur nach unten, sondern auch nach<br />
oben. Entschiedener Widerspruch der<br />
Kommunalpolitiker regte sich, als Lienbacher<br />
die Möglichkeit ansprach, dass es<br />
auch zuviel Bürgernähe geben könnte.<br />
Dass der Bürgermeister eines kleinen<br />
Ortes Aufgaben durch zu große Nähe<br />
mit den betroffenen Bürgern nicht korrekt<br />
lösen könne, dass es also folglich<br />
besser wäre, diese Aufgabe an eine<br />
übergeordnete Stelle zu „delegieren“.<br />
Auch Bernhard Felderer, Präsident des<br />
Staatsschuldenausschusses (er bot in<br />
einem eloquenten Referat ein großteils<br />
positives Bild der kommunalen Finanzen,<br />
Anm.), stieß mit der Feststellung, dass in<br />
den Gemeinden „zu wenig Benchmark“<br />
betrieben würde, auf den Widerspruch
Oben: Drei Tage lang diskutierten rund<br />
150 Teilnehmer bei den 2. Kommunalen<br />
Sommergesprächen im Saal des Kurhauses<br />
Bad Aussee über drängende Probleme<br />
und Fragen der Kommunalpolitik.<br />
Wirtschaftskapitän Josef Taus, Verfassungsjurist<br />
Georg Lienbacher, Headhunterin<br />
Gundi Wentner, Moderator Armin<br />
Wolf, IHS-Professor Bernhard Felderer und<br />
Praktiker Heinz Schaden diskutierten<br />
mit den Teilnehmern über die sozialen,<br />
wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte<br />
der Kommunalpolitik und gaben so den<br />
Workshops wichtige Inputs.<br />
der Gemeindepolitiker. Besonders Salzburgs<br />
Bürgermeister Heinz Schaden, der<br />
mit am Podium saß und dessen Mirabellpark<br />
als Beispiel für kostengünstige<br />
Erledigung von Garteninstandhaltungen<br />
– Private oder durch die Kommune –<br />
herhalten musste, kam in Fahrt.<br />
Bei den Themen Bundesstaatsreform<br />
und Finanzen – die in den Debatte übrigens<br />
kaum zu trennen waren – führte<br />
die Debatten zwar zu Emotionen, aber<br />
kaum zu neuen Argumenten. Während<br />
der drei Tage in Bad Aussee wurde auch<br />
immer wieder das Feststellung getroffen,<br />
dass die Probleme seit zehn, 15 oder 20<br />
Jahren bekannt, sie aber „eine ewige<br />
Diskussion seien“.<br />
Abseits politischer oder pekuniärer Fragen<br />
beschäftigten sich die Teilnehmer<br />
mit einem Problemkreis, der in naher<br />
Zukunft den Gemeinden verstärkt Kopfschmerzen<br />
bereiten wird: „Kommunale<br />
Manger und Managerinnen gesucht“.<br />
Headhunterin Gundi Wentner beklagte,<br />
dass es keine Jobbeschreibung und kein<br />
Anforderungsprofil für das Bürgermeisteramt<br />
gibt. Überdies werde (durch die<br />
Parteien, Anm.) keine moderne Personal -<br />
entwicklung betrieben.<br />
Beide Feststellungen wurden jedenfalls<br />
von den Kommunalpolitikern unabhängig<br />
der Parteifarben entschieden zurückgewiesen.<br />
Wentners zweiter Kritikpunkt war, dass<br />
es in der Kommunalpolitik zu wenig<br />
Frauen gebe und dadurch auf 50 Prozent<br />
des vorhandenen Potenzials verzichtet<br />
werde – analog zur immer noch<br />
vorhandenen Praxis in der Wirtschaft.<br />
Die Repliken von Heinz Schaden („Kommunalpolitik<br />
ist ein klassischer Männerjob“)<br />
und Josef Taus („Das verstärkte<br />
Engagement der Frauen in Wirtschaft<br />
und Politik zerstört die klassische Familienstruktur“)<br />
riefen wiederum den entschiedenen<br />
Widerspruch der zahlreich<br />
anwesenden Bürgermeisterinnen und<br />
Kommunalpolitikerinnen hervor. Kurzfristig<br />
konnte man(n) meinen, in einer<br />
klassischen „Geschlechter-Rollen-Diskussion“<br />
zu sein.<br />
Unter dem Strich lässt sich sagen, dass<br />
ausgehend von den Expertenpapieren<br />
die Diskussionsrunden die idealen<br />
Grundlagen brachten, um mit zusätzlichen<br />
Argumenten versorgt in die Work -<br />
shops zu gehen.<br />
Mehr Mitspracherecht<br />
bei neuen Aufgaben<br />
Prof. Karl Weber hatte es übernommen,<br />
das Thema „Aufgabenverteilung zwi-<br />
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
»<br />
Leider wird vor allem bei<br />
den Finanzausgleichsverhandlungen<br />
das Pferd<br />
vom Schwanz her aufgezäumt<br />
– Finanzierung<br />
immer im Vordergrund,<br />
über Aufgaben wird oft<br />
gar nicht oder zu spät<br />
gesprochen.<br />
Prof. Heinz Handler<br />
über die derzeitige Verhandlungs -<br />
praxis<br />
«<br />
schen Bund-Ländern-Gemeinden“ zu<br />
betreuen. Ausgehend von seinem<br />
Grundlagenpapier wurde festgestellt,<br />
dass die Gemeinden durchaus willens<br />
sind, die ihnen übertragenen Aufgaben<br />
zu erfüllen. Einzige Vorbedingung: Sie<br />
wollen auf die Gestaltung Einfluß nehmen<br />
können – und wehren sich damit<br />
KOMMUNAL 9
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
gegen die immer stärker werdende<br />
Bevormundung durch Bund und Länder.<br />
Neue Aufgaben, insbesondere im<br />
Bereich Bildung und Gesundheit, überfordert<br />
die finanzielle Leistungsfähigkeit<br />
der Kommunen. Sie fordern daher auch<br />
eine dementsprechende Berücksichtigung<br />
im neuen Finanzausgleich.<br />
Einigkeit bestand darin, dass nicht mehr<br />
zeitgemäße Aufgaben aus dem Aufgabenkatalog<br />
der Gemeinden gestrichen<br />
werden sollten – so beispielsweise die<br />
„freiwillige Feilbietung beweglicher<br />
Sachen“. Darunter sind Auktionen der<br />
Gemeinden zu verstehen, wo Bürger<br />
Altausseer Schmankerl’n<br />
10 KOMMUNAL<br />
nicht mehr benötigte Sachen anbieten<br />
können.<br />
Jedenfalls erhalten bleiben sollte der<br />
Kernbestand der hoheitlichen Aufgaben<br />
wie Baurecht, Raumordnung, örtliche<br />
Sicherheit, Feuerwehr und Rettung.<br />
Im privatwirtschaftlichen Bereich, in<br />
dem die Kommunen eine umfassende<br />
zivilrechtliche Kompetenz besitzen, ging<br />
die Meinung dahin, dass die Flexibilität<br />
erhalten bleiben soll.<br />
Zur Steigerung der Effizienz wurde<br />
angeregt, verstärkt in Kooperationen der<br />
Gemeinden zu gehen – bei der anstehenden<br />
Staatsreform soll eine neue<br />
Deftige Holzknechtnocken und<br />
Bundesheer-Reminiszenzen<br />
Ausseer Begrüßung: Dir. Bertram Mayer,<br />
Geschäftsführer des Instituts für kommunales<br />
Management, Bgm. Otto Marl, Gemeindeminister<br />
Günther Platter, Altaussees Bgm. Johann<br />
Grieshofer und Gemeindebund-Chef Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer zünftig in Lederhosen<br />
(ganz oben). Für deftige Kost – und beinahe<br />
einen Feuerwehr einsatz – sorgten die überaus<br />
„feurigen“ Holzhackernocken (oben rechts).<br />
Kameraden beim Bundesheer: Bei der<br />
Begrüßung des Ehrengastes kam – für<br />
viele überraschend – die gemeinsame<br />
Dienstzeit von Gemeindeminister<br />
Günther Platter und Kommunalkreditchef<br />
Reinhard Platzer in den 70-ern bei einem<br />
Tiroler Regiment zu Tage. Hier im Bild mit<br />
Gemeindebund-General Robert Hink (li.)<br />
und Helmut Mödlhammer.<br />
Zu den Klängen des Lupitscher Bläserquartetts<br />
auf dem Altausseer-See (oben)<br />
verkosteten Nicolaus Drimmel (Gemeindebund),<br />
Leopold Fischer und Stefan Vigl<br />
(Kommunalkredit) , Werner Penn (Magistrat<br />
Linz) und Bgm. Ulrike Böker aus Ottensheim<br />
(OÖ) den hervorragenden Zirbenschnaps.<br />
»<br />
Erhalten bleiben sollte<br />
jedenfalls der Kernbestand<br />
der hoheitlichen Aufgaben<br />
wie Baurecht, Raumordnung,<br />
örtliche Sicherheit,<br />
Feuerwehr und Rettung.<br />
Prof. Karl Weber<br />
im Gespräch mit Armin Wolf über eine<br />
mögliche Bereinigung der Gemeindekompetenzen<br />
Kategorie des öffentlich-rechtlichen Vertrages<br />
die Gemeindekooperation erleichtern.<br />
Wer zahlt, schafft an.<br />
Schafft an, wer zahlt?<br />
«<br />
20 Prozent der Gemeindeausgaben<br />
fließen in „wachstumsorientierte Inves -<br />
titionen“, die Gemeinden sind der<br />
stärkste Investor der öffentlichen Hand.<br />
Leider werde – so Prof. Heinz Handler<br />
in „seinem“ Workshop – vor allem bei<br />
den Finanzausgleichsverhandlungen<br />
das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt.<br />
Die Finanzierung stehe immer<br />
im Vordergrund, über die Aufgaben der<br />
Gebietskörperschaften werde oft gar<br />
nicht oder zu spät gesprochen.<br />
Übereinstimmend befürworteten alle<br />
Teilnehmer dieses Workshops den sogenannten<br />
„aufgabenorientierten Finanzausgleich“.<br />
Da aber diese Aufgaben<br />
nicht definiert seien, gebe es erhebliche<br />
Definitionsprobleme.<br />
Schon in jeder Gemeinde könnten die<br />
kommunalen Aufgaben individuell festgelegt<br />
werden. Beispiel: Gehören<br />
Sportplätze oder Kultureinrichtungen<br />
zu diesen Aufgaben?<br />
Auch die Einbindung Privater (Schlagwort<br />
Private Public Partnership) sollte<br />
in einer Aufgabenverteilung zwischen<br />
Bund, Ländern und Gemeinden besprochen<br />
werden. Der Zeitdruck bei Finanzausgleichsverhandlungen<br />
mache dies<br />
unmöglich, die bekannten Probleme<br />
werden von Finanzausgleich zu Finanzausgleich<br />
weiter geschoben. Ein Vorschlag<br />
war, nach dem FAG 2007, der ja<br />
bis Jahresende abgeschlossen sein soll,<br />
eine Arbeitsgruppe zu installieren, die<br />
auf diese Fragen Antworten finden soll.<br />
Die Steuerautonomie der Gemeinden<br />
war ein weiterer Themenkomplex. So<br />
»
»<br />
wurde einer Wiedereinführung der<br />
Getränkesteuer (die freilich aus politischen<br />
Gründen nicht so heißen sollte,<br />
und sich auf Alkoholika beschränke),<br />
nicht widersprochen. Insgesamt wurde<br />
eine größere Steuer-Autonomie der<br />
Gemeinden nicht abgelehnt. Es dürfe<br />
freilich die Steuerbelastung nicht steigen,<br />
Steuerautonomie bedeutet nicht<br />
Steuererhöhungen.<br />
Trotz trauriger Einkommenssituation,<br />
hohem Druck,<br />
wenig Zeit für die Familie<br />
und sozialer Ungerechtig -<br />
keiten übt die Mehrheit der<br />
Bürgermeisterinnen und<br />
Bürgermeister das Amt<br />
immer noch gerne aus.<br />
Prof. Wolfgang Mazal<br />
über die ungebrochene Faszination des<br />
„Bürgermeisters“<br />
Die interkommunale Kooperation (wie<br />
schon bei Abfall- und Wasserverbänden)<br />
wurde überwiegend als wesentliches<br />
Element der Effizienzsteigerung<br />
gesehen. Dabei gebe es aber – unter<br />
anderem – völlig unsinnige rechtliche<br />
und legistische Probleme auch auf<br />
Ebene der Ländergesetze, die dies<br />
behindern statt fördern. Die Kooperation<br />
zwischen benachbarten Gemeinden,<br />
die aber in verschiedenen Bundes-<br />
»<br />
«<br />
ländern liegen, sei nur mit immensem<br />
– rechtlich schwach abgesicherten –<br />
Aufwand möglich.<br />
Krass unterbezahlt und<br />
oft überfordert<br />
Nach den Ergebnissen einer Bürgermeisterbefragung<br />
2006 und der daraus folgenden<br />
Studie von Prof. Wolfgang<br />
Was den Ausgaben-<br />
Brocken Dienstleistungen<br />
betrifft: Die Gemeinden<br />
sollten mit dem Bund über<br />
Auslagerungen reden,<br />
zumal ja ein Teil der<br />
Kosten vom Bund kommt.<br />
«<br />
Prof. Bernhard Felderers<br />
Rat an die Gemeindeverantwortlichen<br />
Mazal (KOMMUNAL berichtete in der<br />
Ausgabe 7&8/August 2006; Anm.) stehen<br />
Bürgermeister in Österreich unter<br />
hoher Belastung und steigendem<br />
Druck, müssen sich aber intensiv engagieren,<br />
haben wenig Zeit für ihr Familienleben,<br />
riskieren Nachteile in ihrer<br />
privaten Karriere, sind sozial unzureichend<br />
abgesichert und werden für all<br />
das im Vergleich zu anderen öffentlichen<br />
Positionen bzw.<br />
zur Privatwirtschaft<br />
auch noch schlecht<br />
bezahlt.<br />
Dennoch bezeichnen<br />
die Bürgermeister<br />
ihre Arbeit als interessant,<br />
der Großteil<br />
übt das Amt immer<br />
noch gerne aus.<br />
Unter den Workshop-<br />
Teilnehmern herrschte<br />
allerdings die<br />
einhellige Meinung,<br />
dass das Thema<br />
Bezahlung tatsächlich<br />
ein trauriges ist –<br />
und zwar auch innerhalb<br />
der Gehalts -<br />
pyramide in den Gemeinden. Wolfgang<br />
Mazal warnte jedenfalls davor, sich<br />
„zurückzulehnen und zu sagen: Seien<br />
wir froh, dass wir Dodln haben, die<br />
diesen Job machen.“<br />
Hinzu kommt eine Überforderung<br />
durch immer neue Zuständigkeiten aufgrund<br />
innerstaatlicher Aufgaben-Neuverteilungen.<br />
Die Vielzahl von Richtlinien,<br />
Gesetzen und Verordnungen<br />
macht es den Bürgermeistern zunehmend<br />
schwerer,<br />
alle Vorgänge im<br />
Amt ordnungsgemäßwahrnehmen<br />
oder kontrollieren<br />
zu können:<br />
Juristische Fachkompetenz<br />
ist<br />
immer stärker<br />
gefragt. Insgesamt<br />
gestaltet sich deshalb<br />
auch die<br />
Nachfolgefrage<br />
problematisch.<br />
Gefordert wurde<br />
von den Work shopteilnehmern eine der<br />
Verantwortlichkeit und den Leistungen<br />
angepasste Bezügepyramide.<br />
Von den Aufsichtsbehörden wünschen<br />
sich die Bürgermeister mehr Kooperation<br />
und Unterstützung. Qualifizierung<br />
und Weiterbildung werden als wesentliche<br />
Komponenten einer ordnungsgemäßen<br />
Wahrnehmung der Funktion<br />
erachtet.<br />
(In den kommenden Ausgaben von<br />
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
Aufgeschnappt<br />
„Helmut, geh’ her do, sunst bin i der<br />
einzige mit an Glasl Bier am Foto ...“<br />
Franz Voves ruft Helmut Mödlhammer<br />
gegen den Ansturm der Fotografen zu Hilfe.<br />
◆◆◆<br />
„Alfred, heut’ steh’n wir schlecht, weil<br />
am Rand können’s uns ausn Bild<br />
wegschneiden ...“<br />
Bernd Vögerle zu Alfred Riedl bei der<br />
Aufstellung zum offiziellen Eröffnungsfoto,<br />
wo die beiden Vizepräsidenten die<br />
Flankenpositionen einnehmen (Seite 8).<br />
◆◆◆<br />
„Österreich ist das Gegenteil eines<br />
De-Regulierungslandes ..“<br />
Prof. Karl Webers messerscharfe Analyse.<br />
◆◆◆<br />
„Man kann sich natürlich auch<br />
zurücklehnen, nichts tun und sagen:<br />
Samma froh, dass ma’ Dodeln haben,<br />
die diesen Job machen ...“<br />
Prof. Wolfgang Mazals provokant gemeinte<br />
Ansage zur sozialen Situation der Bürgermeister<br />
produzierte schallendes Gelächter.<br />
◆◆◆<br />
„Ich schütte etwas Wasser in den<br />
Wein, der ihnen gestern so gut<br />
geschmeckt hat ... “<br />
Mit einem Blick erkennt Prof. Bernhard Felderer<br />
die Situation des zweiten Tages und<br />
holt sich die Aufmerksamkeit.<br />
◆◆◆<br />
„Sie waren ja in dieser Republik schon<br />
fast alles – außer Bundeskanzler.“<br />
Moderator Armin Wolf stellt Josef Taus vor,<br />
dem es daraufhin die Rede verschlug.<br />
◆◆◆<br />
„1300 Euro brutto san a bissl zwenig.<br />
Des sollte schon mehr sein – und des<br />
Budget zerhaut des a nimmer“<br />
Josef Taus trocken, als er die Einkommenslage<br />
des durchschnittlichen Bürgermeister<br />
kommentieren soll.<br />
KOMMUNAL 11
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
Schmankerl von der Blaa-Alm<br />
Eigenwillige Melktechnik und<br />
treffsichere Damen im Dirndl<br />
Gemeindebund-General Robert Hink<br />
geleitet die überaus charmanten Narzissenprinzessinnen<br />
(rechts) auf die Blaa-Alm<br />
zum gemütlichen Abendprogramm,<br />
während seine Gattin Herta die Liebe zum<br />
Armbrustschießen entdeckte – und eine<br />
beeindruckende Trefferqoute erzielte.<br />
12 KOMMUNAL<br />
„Wenigstens a Hörndl kannst ma<br />
lass’n!“ Kommunalkreditchef<br />
Reinhard Platzer urgiert einen<br />
Ankerpunkt, als die Fotografen<br />
auf dieses Foto (links) bestanden.<br />
Und legte eine eigenwillige –<br />
aber durchaus ertragreiche –<br />
Melktechnik an<br />
den Tag, als es<br />
galt, die Kuh<br />
dann auch zu<br />
melken (oben).<br />
Cornelia Schragl von der Kommunalkredit,<br />
die für die perfekte Organisation zu<br />
Recht hoch gelobt wurde, Daniel Kosak<br />
und Nicolaus Drimmel vom Gemeindebund<br />
sowie Georg Lienbacher begrüßen<br />
einen alten Freund der Gemeinden: Salzburgs<br />
LH a. D. Franz Schausberger (rechts)<br />
Das Armbrustschießen war ein Magnet für<br />
große und kleine Jungs: Ernst Schmid, Präsident<br />
des burgenländischen Gemeindevertreterverbandes,<br />
hilft einem der Söhne<br />
von Martin Huber (hinten links), Geschäftsführer<br />
des Salzburger Gemeindebundes,<br />
bei den ersten Schussversuchen.<br />
KOMMUNAL zum 54. Österreichischen<br />
Gemeindetag werden die Ausführungen<br />
und Folgerungen von Prof. Mazals Untersuchungen<br />
ein Hauptthema sein.)<br />
Wege zum Ziel?<br />
Nach der sehr kurzfristigen Absage von<br />
Bundesministerin Andrea Kdolsky<br />
(wichtige Sitzung im Bundesrat, Anm.)<br />
eröffnete Georg Lienbacher, Vorsitzender<br />
der Arbeitsgruppe zur Staats- und<br />
Verwaltungsreform, mit einem Referat<br />
über die Arbeit und Ziele der Arbeitsgruppe<br />
(siehe auch Bericht Seite 15<br />
bzw. die Homepages www.bka.gv.at<br />
und www.gemeindebund.at) den<br />
abschließenden Tag der Kommunalen<br />
Sommergespräche 2007.<br />
Für die Ministerin sprang Bundesrat<br />
und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard<br />
Winterauer am Podium ein. Der<br />
versierte Kommunalpolitiker – er war<br />
19 Jahre Bürgermeister von Bad Goisern<br />
– ließ<br />
sich zu<br />
keiner<br />
Prog nose<br />
über die<br />
aktuellen<br />
FAG Verhandlungenhinreissen,<br />
gab den<br />
Vertretern<br />
der<br />
Gemein-<br />
den aber<br />
ein paar<br />
Gedanken<br />
„zum<br />
Besten“. So<br />
ist aus seiner<br />
Sicht<br />
die Diskussion<br />
über<br />
den aufgabenorien-<br />
»<br />
Die Landtage müssen<br />
sich endlich wieder<br />
ihrer Entscheidungskompetenzenbesinnen,<br />
um ihre Existenz<br />
zu legitimieren.<br />
Univ. Prof. Dr. Lienbacher<br />
spricht sich vehement für den<br />
Erhalt der Landtage aus<br />
«
Reinhard Winterauer, Helmut Mödlhammer, Georg Lienbacher, Moderator Reinhard<br />
Göweil, Moderatorin Erika Bettstein, Reinhard Platzer und Moderator Michael Hann<br />
analysierten die Ergebnisse der Workshops.<br />
tierten Bevölkerungsschlüssel sinnlos,<br />
weil es keine Übereinstimmung geben<br />
könne. Er würde sich auch in Verhandlungen<br />
von den Ländern nicht vertreten<br />
lassen – selbst Vorschläge erarbeiten<br />
und das Heft selbst in die Hand<br />
nehmen, sei die Devise. Dass die Länder<br />
die Gemeinden vertreten, das „ist<br />
»<br />
eine Mär“ (O-<br />
Ton Winterauer).<br />
Vor allem bei<br />
seinen Gedanken zu den Themen<br />
Grundsteuer („Sorgen wir für eine Verbilligung<br />
des Wohnens, dann sind wir<br />
in der öffentlichen Meinung vorne“),<br />
des (Vor)schulbereichs („Die skandinavischen<br />
Länder sind vorne, weil dort<br />
dieses Schulsystem auf die kommunale<br />
Ebene heruntergebrochen ist“) und<br />
Pflegebereich („Hier gibt es Chancen<br />
auf Geld von Bund und Ländern, weil<br />
die das nie allein umsetzen können“)<br />
hatte Winterauer die Zuhörer auf seiner<br />
Seite.<br />
Im übrigen solle man vor allem beim<br />
Thema Schule weniger über das Inhaltliche<br />
diskutieren, sondern eher, was<br />
notwendig ist und was es kostet. Und<br />
weil er in dieser Frage die Meinung des<br />
Bundeskanzlers ganz gut kenne, sei das<br />
dem Bund auch etwas wert.<br />
Abschaffung der Landtage<br />
führt zum Zentralstaat<br />
Der radikalste Vorschlag dieser Schluss -<br />
runde kam jedenfalls von Dr. Michael<br />
Hann, Moderator des Weber-Work -<br />
shops. Er war der Meinung, dass, gründend<br />
auf die Aussagen von Salzburgs<br />
Ex-Landeshaupt-<br />
mann Franz<br />
Schausberger, „wir<br />
die Landtage nicht<br />
mehr brauchen“.<br />
Diese hätten es in<br />
«<br />
den letzten 15 Jahren<br />
verabsäumt,<br />
sich klare Kompetenzen<br />
zu „arrogieren“.<br />
Obwohl es im Auditorium<br />
zu dieser<br />
Idee ein gewisses Raunen gab, wurde<br />
dem doch nicht zugestimmt. „Man muss<br />
endlich auch wieder erkennen, dass wir<br />
mündige Parlamente – vor allem auch<br />
auf Landesebene – brauchen“, merkte<br />
Gemeindebund-Präsident Mödlhammer<br />
an. „Derzeit regiert in den Landtagen<br />
der Klubzwang, viele vergessen, dass sie<br />
ihren Wählern in ihren Wahlkreisen verantwortlich<br />
sind und nicht aus -<br />
schließlich ihren Parteien.“ Auf<br />
Gemeinde ebene müssten auch die Bürgermeister<br />
darüber nachdenken, welche<br />
Bedürfnisse der Bevölkerung überhaupt<br />
erfüllbar sind. „Vielfach nehmen die<br />
Bürger auch ihre Eigenverantwortung<br />
nicht wahr, sie glauben, dass die wichtigen<br />
Dinge wie Kinderbetreuung,<br />
Schule, Gesundheit und Pflege aus -<br />
schließlich von der öffentlichen Hand<br />
erledigt werden müssen und das nach<br />
Möglichkeit auch kostenlos.“ Hier gebe<br />
es auch jede Menge Hausaufgaben für<br />
die Bürgermeister, sich von der Erwar-<br />
Vorschläge selbst erarbeiten<br />
und das Heft in die<br />
Hand nehmen. Denn dass<br />
die Länder die Gemeinden<br />
vertreten, ist eine Mär.<br />
Reinhard Winterauer<br />
und sein Rat an die Gemeinden<br />
Kommunale Sommergespräche<br />
Aufgeschnappt<br />
„Dass die öffentliche Hand immer<br />
zuwenig Geld hat, halte ich für ungeheuer<br />
positiv. Schrecklich wäre es,<br />
wenn sie mehr hätte.“<br />
Josef Taus bringt die Diskussion um die<br />
Finanzen auf einen Punkt.<br />
◆◆◆<br />
Das ist doch das Wesen der Demokratie:<br />
jeder Bürger kann Bundespräsident<br />
werden, er muss nur 35 Jahre alt<br />
und darf nicht vorbestraft sein. Sonst<br />
muss er nichts können.“<br />
Armin Wolf auf die Klage Gundi Wentners,<br />
dass es für den Bürgermeisterjob<br />
weder Stellenbeschreibung noch sonstige<br />
Anforderungskriterien gibt.<br />
◆◆◆<br />
„Er muss schon mit den Leuten können.<br />
Wenn die über einen Bürgermeis -<br />
ter sagen, jetzt seh’ ich des G’sicht scho<br />
wieder, dann ist das keine gute Voraussetzung.<br />
Aber meistens hat er ja dann<br />
das Glück, dass er’s nicht sehr lange<br />
sein darf, weil er abgewählt wird.“<br />
Josef Taus präzisiert die Grundanforderungen<br />
für den Bürgermeisterposten.<br />
◆◆◆<br />
„Das ist wie mit einem Schwamm:<br />
wenn man zusammendrückt, kommt<br />
das heraus, was wirklich drinnen ist.“<br />
Heinz Schaden auf die Frage Armin<br />
Wolfs, ob denn ein Bürgermeister ein<br />
„Wunderwuzzi“ sein soll.<br />
◆◆◆<br />
„Beim Geld bin i konservativ.“<br />
derselbe zur Frage, ob „seine“ Stadt Salzburg<br />
mit dem Geld locker umgehe.<br />
◆◆◆<br />
„Samma se ehrlich: De Debatte findet<br />
im elitären Funktionärskreis statt –<br />
des interessiert die Bürgerinnen und<br />
Bürger überhaupt net. De sogn auf<br />
guat Salzkammerisch, zu dem hab’m<br />
ma die Hansln g’wöhlt, damit sa se<br />
do zurechtfinden.“<br />
Reinhard Winterauer auf die Frage, was<br />
er sich von den aktuellen FAG-Verhandlungen<br />
erwartet.<br />
◆◆◆<br />
„Das ist derzeit wie beim Kinderspiel die<br />
„Reise nach Jerusalem“ – einer bleibt<br />
über, und der muss dann zahlen.“<br />
Georg Lienbacher auf die Frage, welche<br />
Aufgaben die Gemeinden besorgen sollten.<br />
KOMMUNAL 13
Kommunale Sommergespräche 2007<br />
tungshaltung der Bevölkerung nicht<br />
permanent unter Druck setzen zu lassen.<br />
Mit großer Vehemenz sprach sich hingegen<br />
Georg Lienbacher gegen eine<br />
Abschaffung der Landtage aus: „Das<br />
käme einer Abschaffung der Länder<br />
gleich und wäre damit die Verwirklichung<br />
eines Zentralstaates. Das will vermutlich<br />
keiner, ich halte das auch aus<br />
der historischen<br />
Entwicklung heraus<br />
für unwahrscheinlich.<br />
Die Landtage<br />
müssen sich aber<br />
endlich wieder<br />
ihrer Entscheidungskompetenzen<br />
besinnen, um ihre<br />
Existenz zu legitimieren.<br />
Es sollte<br />
nicht so sein, dass<br />
die Landtage nur<br />
noch dazu da sind,<br />
um Gesetze, die auf<br />
EU-Ebene oder<br />
nationaler Ebene<br />
entstehen, einfach<br />
durchwinken, um<br />
sie im eigenen Bundesland<br />
in Kraft zu<br />
setzen.“<br />
Es blieb Reinhard<br />
Platzer, Generaldirektor<br />
der Kommunalkredit,überlassen,<br />
die Emotionen<br />
aus der Diskussion<br />
zu nehmen. Er<br />
überlege als „einfacher<br />
Wirtschafter“<br />
immer, wie man<br />
Dinge einfach organisieren<br />
könne.<br />
Weil kompliziert<br />
werde es von ganz<br />
alleine.<br />
Und aus seiner<br />
Sicht sollte die<br />
interkommunale Zusammenarbeit<br />
ermöglicht und vereinfacht werden.<br />
Die Entscheidung liege sowieso auf Seiten<br />
des Bürgermeisters, ob er ein Vorhaben<br />
mit einer anderen Gemeide<br />
angeht. Aber es mache jedenfalls in vielen<br />
Bereichen Sinn.<br />
Der Tenor sowohl der Workshops als<br />
auch der Diskussionen auf den Punkt<br />
gebracht:<br />
Die Aufgaben für Gemeinden nehmen<br />
zu, der Kompetenz-Wirrwarr zwischen<br />
Bund, Ländern und Gemeinden wird<br />
immer problematischer, und viele Bürgermeister<br />
sehen sich mit den Anforderungen,<br />
die an dieses Amt gestellt werden,<br />
gelegentlich auch überfordert.<br />
14 KOMMUNAL<br />
»<br />
Es ist verkehrt, wenn<br />
die EU 43 Milliarden<br />
Euro für die Agrarwirtschaft<br />
ausgibt, aber<br />
nur sieben Milliarden<br />
für die Forschung.<br />
Prof. Dr. Lothar Späth<br />
ehemals Ministerpräsident von<br />
Baden Württemberg plädiert für<br />
mehr „Bodenhaftung“ in Europa<br />
Europa vom Kopf wieder<br />
auf die Füße stellen<br />
Abschließendes Highlight der Kommunalen<br />
Sommergespräche 2007: Ein Vortrag<br />
des ehemaligen Ministerpräsidenten<br />
des Landes Baden Württemberg Prof. Dr.<br />
Lothar Späth zum Thema „Strategie<br />
Europa – ein Föderalismus-Modell?“ Er<br />
präsentierte seine Außensicht zur Diskussion<br />
der Aufgabenverteilung.<br />
„Ich bin ein<br />
begeisterter Europäer.<br />
Europa ist jedoch Teil<br />
einer Entwicklung, die<br />
einem Zeitplan unterliegt.<br />
Ein Gebilde, das<br />
kulturell zusammenwachsen<br />
muss und<br />
Spielregeln hat“, sagte<br />
Späth. Es sei wichtig,<br />
bei der europäischen<br />
Entwicklung ganz oben<br />
zu beginnen. Und zwar<br />
auf der politischen<br />
Ebene. „Alle haben ein<br />
bisschen geglaubt, dass<br />
die UN die Weltregierung<br />
ist und Amerika<br />
die Exekutive. Das hat<br />
sich seit dem Irakkrieg<br />
grundlegend verändert.“<br />
Es sei wichtig, in<br />
die Bevölkerung reinzuhören.<br />
„Ich habe das<br />
Gefühl, dass der Glaube<br />
an die Weltregierung<br />
verloren gegangen ist.“<br />
Späth hob den Bereich<br />
«<br />
Umwelt als Musterbeispiel<br />
hervor. „Die<br />
Europäer gehen von<br />
ihren Vorstellungen der<br />
Stabilität von Ökonomie<br />
und Ökologie nicht<br />
ab, und das ist sehr<br />
gut.“<br />
Späth äußerte jedoch<br />
auch weitere, sehr kritische,<br />
Gedanken: „Es ist verkehrt, wenn<br />
die EU 43 Milliarden Euro für die Agrarwirtschaft<br />
ausgibt, aber nur sieben Milliarden<br />
für die Forschung. Diese Relation<br />
stimmt einfach nicht, wir müssen<br />
Europa wieder vom Kopf auf die Füße<br />
stellen, um mehr Bodenhaftung zu erreichen.“<br />
Unmittelbar nach Späths Vortrag endeten<br />
die hochinteressanten „Kommunalen<br />
Sommergespräche 2007“. Österreichs<br />
kommunale Landschaft kann sich aber<br />
schon auf eine Fortsetzung freuen: Im<br />
Sommer des kommenden Jahres sollen<br />
die Sommergespräche erneut, wiederum<br />
in Bad Aussee, der „geographischen<br />
Mitte Österreichs“, stattfinden.<br />
Die Teilnehmer<br />
Wie das „Who is who“ der österreichischen<br />
Politik liest sich die Teilnehmerliste.<br />
Innen- „und Gemeinde“-minister Günther<br />
Platter, Steiermarks LH Franz Voves, der<br />
ehemalige Salzburger LH Franz Schausberger,<br />
Landesrat Christian Buchmann<br />
(Stmk.), SPÖ-Bundesgeschäftsführer und<br />
langjähriger Bürgermeister von Bad Goisern,<br />
Reinhard Winterauer sowie zahlreiche<br />
Vertreter von Fachabteilungen aus verschiedenen<br />
Ministerien und der Länder.<br />
Als spezieller Referent kam der ehemalige<br />
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg,<br />
Lothar Späth.<br />
Auch die Expertenebene war prominent<br />
vertreten: die Universitätsprofessoren<br />
Wolfgang Mazal (Wien) und Karl Weber<br />
(Innsbruck) sowie Nationalbank-Ökonom<br />
Heinz Handler erstellten die Diskussionsgrundlagen,<br />
Georg Lienbacher (Vorsitzender<br />
der Arbeitsgruppe zur Staats- und<br />
Verwaltungsreform) sowie Bernhard Felderer<br />
(Präsident des Staatsschuldenausschusses)<br />
referierten.<br />
Überaus prominent vertreten war auch<br />
die Wirtschaft mit Kommunalkredit-Generaldirektor<br />
und Veranstalter Reinhard<br />
Platzer, dem Industriellen Josef Taus,<br />
Hans Hofinger (Genossenschaftsverband),<br />
Ferdinand Eberle (TIWAG), um<br />
nur einige zu nennen.<br />
Und der zweite Veranstalter der Sommergespräche,<br />
Gemeindebund-Präsident Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer führte natürlich<br />
nahzu das gesamte Präsidium an. Die<br />
Vizepräsidenten Alfred Riedl und Bernd<br />
Vögerle, Generalsekretär Robert Hink,<br />
die Präsidenten Hermann Kröll (Steiermark),<br />
Hubert Rauch (Tirol), Ernst<br />
Schmid (Bgld.) und Franz Steininger<br />
(OÖ) sowie zahlreiche Landesgeschäftsführer<br />
und Experten waren anwesend.<br />
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister<br />
aus allen Teilen Österreichs rundeten die<br />
Schar der Teilnehmner nicht nur ab, sie<br />
brachten ihren Teil ein zu den überaus<br />
fruchtbaren Gesprächen. Stellvertretend<br />
für die seien Heinz Schaden aus Salzburg<br />
und Regina Schrittwieser aus Krieglach<br />
in der Steiermark genannt.<br />
Die „Kommunalen Sommergespräche“<br />
sind eine gemeinsame<br />
Veranstaltung des Österreichischen<br />
Gemeindebundes und der Kommunalkredit<br />
Austria AG auf Anregung<br />
des verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden<br />
des Staatsschuldenausschusses,<br />
Prof. Helmut Frisch.<br />
Alle Berichte und Unterlagen und<br />
Ergebnisse der Workshops sind<br />
im Detail auf den Homepages<br />
www.gemeindebund.at und<br />
www.kommunalnet.at zum<br />
Download bereit gestellt.
Wenn die ersten Vorschläge der Expertengruppe<br />
zur Staats- und Verwaltungsreform<br />
umgesetzt werden, dann sind<br />
auch Österreichs Gemeinden massiv von<br />
diesen Veränderungen betroffen. Auch<br />
Gemeinden unter 20.000 Einwohner<br />
können künftig unter die Kontrolle der<br />
Landes-Rechnungshöfe fallen, die<br />
Gemeindeaufsichtsbehörden würden<br />
damit de facto wegfallen.<br />
Die im Regierungsprogramm angekündigte<br />
Expertengruppe, bestehend aus<br />
den Universitätsprofessoren<br />
Georg Lienbacher<br />
und Andreas Khol<br />
sowie Volksanwalt<br />
Peter Kostelka hat Ende<br />
Juli 2007 das erste von<br />
drei Paketen zur<br />
Staatsreform vorgelegt.<br />
Der Leiter der Expertengruppe,<br />
Georg Lienbacher,<br />
bezeichnete die<br />
vorgelegten Ergebnisse<br />
als die „größte Verfassungsbereinigung<br />
der<br />
2. Republik.“<br />
Verfassung ist nicht<br />
gleich Verfassung<br />
Das österreichische Verfassungsrecht<br />
soll einheitlicher und überschaubarer<br />
werden. In Österreich ist Verfassung<br />
nicht gleich Verfassung: Außerhalb der<br />
eigentlichen Bundesverfassung existieren<br />
zahllose Verfassungsbestimmungen,<br />
die mit Zweidrittelmehrheit in einfache<br />
Gesetze hineingeschrieben wurden –<br />
teilweise, um sie aus politischen Gründen<br />
dem Zugriff des Verfassungsgerichtshofes<br />
zu entziehen, teilweise aber<br />
auch aus technischen Gründen. Über<br />
1000 dieser Bestimmungen sollen nun<br />
gestrichen werden. Damit einher gehen<br />
einige technische Verfassungsänderungen:<br />
Etwa die Möglichkeit, weisungsfreie<br />
Behörden künftig per einfachem<br />
Gesetzesbeschluss zu schaffen (bisher<br />
war dafür eine Zweidrittelmehrheit<br />
nötig).<br />
Rechnungshöfe sollen auch<br />
kleine Gemeinden prüfen<br />
Die derzeit nicht absetzbaren<br />
Volksanwälte können<br />
den Plänen zufolge<br />
künftig abgewählt werden<br />
– und zwar mit<br />
Zweidrittelmehrheit<br />
vom Nationalrat. Die<br />
selbe Regelung soll auch<br />
für den Rechnungshofpräsidenten<br />
gelten, der<br />
derzeit mit einfacher<br />
Mehrheit abgesetzt werden<br />
kann. Erweitert<br />
werden sollen die Prüfkompetenzen:<br />
Die Volksanwälte<br />
sollen auch ausgegliederte Einheiten<br />
wie die ÖBB prüfen dürfen.<br />
Art. 127a B-VG, nach dem der Bundesrechnungshof<br />
nur für die Prüfung der<br />
Gemeinden über 20.000 Einwohner<br />
zuständig ist, wurde nicht angetastet.<br />
Allerdings können die Länder nach<br />
dem Entwurf ihre Landesrechnungshöfe<br />
ermächtigen, auch Gemeinden<br />
unter 20.000 Einwohner zu kontrollieren.<br />
Weitere Forderungen des Rechnungshofs<br />
(zum Beispiel generelle Kontrolle<br />
kleiner Gemeinden, Kontrollkompetenz<br />
für Firmen mit 25 Prozent<br />
Staatsanteil) werden nicht erfüllt. Auch<br />
die Verlagerung des Menschenrechts-<br />
Recht & Verwaltung<br />
Staatsreform: „Größte Verfassungsbereinigung der 2. Republik“<br />
Die Gemeinden sind<br />
massiv betroffen<br />
1000 Verfassungsbestimmungen sollen wegfallen, rund 70 Behörden und ähnliche Einrichtungen<br />
überflüssig werden. Zudem sollen Landesrechnungshöfe auch Gemeinden<br />
unter 20.000 Einwohner prüfen können. Dies sind die ersten Ergebnisse einer Expertengruppe<br />
zur Bereinigung und Vereinfachung der österreichischen Bundesverfassung.<br />
Die Länder können<br />
nach dem Entwurf ihre<br />
Landesrechnungshöfe<br />
ermächtigen, auch<br />
Gemeinden unter<br />
20.000 Einwohner<br />
zu kontrollieren.<br />
Foto: © HBF/WENZEL Andy<br />
beirats aus dem Innenministerium in<br />
die Volksanwaltschaft kommt nicht.<br />
Zehn Verwaltungsgerichtshöfe<br />
sollen kommen<br />
Wer sich gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden<br />
wehrt, soll sich künftig<br />
an „Verwaltungsgerichte“ der Länder<br />
und des Bundes wenden können. Bisher<br />
ist dafür entweder die übergeord-<br />
Peter Kostelka, Georg Lienbacher und<br />
Andreas Khol stellen die Pläne zur<br />
„größten Verfassungsbereinigung der<br />
2. Republik“ vor.<br />
nete, ebenfalls weisungsgebundene<br />
Verwaltungsebene zuständig (z.B. entscheidet<br />
das Amt der Landesregierung<br />
über Beschwerden gegen Bescheide der<br />
Bezirkshauptmannschaften), oder aber<br />
gerichtsähnliche Sonderbehörden wie<br />
der unabhängige Bundesasylsenat oder<br />
der unabhängige Finanzsenat. Letztere<br />
sollen künftig in den neuen Verwaltungsgerichten<br />
aufgehen – etwa 70<br />
derartige Einrichtungen sollen damit<br />
überflüssig werden. Außerdem dient<br />
die Reform der Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes,<br />
der künftig seltener<br />
angerufen werden kann. Für die<br />
KOMMUNAL 15
Recht & Verwaltung<br />
Gemeinden würde das nach dem Entwurf<br />
bedeuten, dass das bisher nur kassatorische<br />
Verfahren bei der Aufsichtsbehörde<br />
ebenfalls durch ein meritorisches<br />
Verfahren bei einem Landesverwaltungsgericht<br />
ersetzt wird.<br />
Justizanwalt im Einsatz<br />
Ein eigener Justizanwalt soll sich künftig<br />
um Missstände an Gerichten kümmern<br />
– etwa wenn ein Richter ein Verfahren<br />
mutwillig verschleppt. Gewählt<br />
wird der Justizanwalt den Plänen<br />
zufolge vom Nationalrat, und zwar aus<br />
einem Dreiervorschlag des Obersten<br />
Gerichtshofes (OGH). Der Justizanwalt<br />
muss Richter sein, seine Amtszeit soll<br />
zwölf Jahre dauern. Seine Kompetenzen:<br />
Disziplinarverfahren einleiten,<br />
einen Fristsetzungsantrag stellen und<br />
Empfehlungen an das zuständige Ministerium<br />
abgeben. Von der Kontrolle<br />
ausgenommen sind freilich die Urteile<br />
Verwaltungsreform<br />
Landesverwaltungs gerichte<br />
Nicht das Gelbe vom Ei<br />
Gegen Landesverwaltungsgerichte spricht<br />
sich Gemeindebund-Vizepräsident Bgm.<br />
Bernd Vögerle (Gerasdorf) aus. Ein Problem<br />
der Rechtssicherheit sieht Vögerle<br />
hinter der Absicht der<br />
Expertengruppe Staatsund<br />
Verwaltungsreform,<br />
derartige Gerichte einzurichten,<br />
die die derzeitige<br />
Berufungsinstanz<br />
des Landes ersetzen sollen.<br />
Es sei nämlich zu<br />
befürchten, dass Verfahren<br />
vor dem Verwaltungsgerichtaufwendige<br />
Kosten verursachen<br />
und länger dauern.<br />
„Derzeit werden 95 Prozent<br />
der Bescheide der Gemeinde als einwandfrei<br />
akzeptiert und nur in rund fünf<br />
Prozent der Fälle wird dagegen Einspruch<br />
erhoben“, so Vögerle. Künftig werde man<br />
aber einen Anwalt brauchen, was sich als<br />
Hürde im Zugang zum Recht vor allem für<br />
jene erweisen werde, die keine Rechtsschutzversicherung<br />
haben.<br />
Lob spendet Vögerle der Expertengruppe,<br />
zu der kommunale Vertreter nicht eingeladen<br />
worden waren, für den Vorschlag, die<br />
„interkommunale Zusammenarbeit von<br />
Gemeinden“ auf eine verfassungsrechtliche<br />
Grundlage zu stellen. Das entspreche einer<br />
langjährigen Forderung des Österreichischen<br />
Gemeindebundes.<br />
16 KOMMUNAL<br />
der Gerichte, die weiterhin nur im normalen<br />
Instanzenzug angefochten werden<br />
können.<br />
„Nichtterritoriale“ Selbstverwaltung<br />
abgesichert<br />
Die „nichtterritoriale Selbstverwaltung“<br />
wird verfassungsrechtlich abgesichert,<br />
für die Wirtschafts- und Arbeiterkammer<br />
sowie für die Landwirtschaftskammer<br />
gibt es eine explizite verfassungsrechtliche<br />
Bestandsgarantie. Das Weisungsrecht<br />
des Justizministers über die<br />
Staatsanwaltschaft wird beibehalten.<br />
Allerdings wird ein ständiger Ausschuss<br />
des Nationalrats zur Kontrolle des Weisungsrechts<br />
eingerichtet.<br />
Im Herbst kommt ein<br />
zweites Paket<br />
Über den Sommer will die Arbeitsgruppe<br />
nun ein zweites Paket schnüren<br />
und im Herbst präsentieren. Enthalten<br />
soll es unter anderem einen neuen<br />
Grundrechtskatalog, der die zersplitterten<br />
Grundrechtstexte (zum Beispiel<br />
Menschenrechtskonvention, Staatsgrundgesetz)<br />
zusammenführen soll.<br />
Außerdem geplant: Die Zusammenführung<br />
der Sozialbehörden von Bund<br />
und Ländern („One-Stop-Shop-Prinzip“)<br />
sowie der Schulbehörden von<br />
Bund und Ländern. Dadurch sollen<br />
dann auch Einsparungen möglich werden,<br />
wie Kostelka betont. Geklärt werden<br />
muss auch, wie die komplizierte<br />
Verteilung der Staatsaufgaben auf<br />
Bund, Länder und Gemeinden vereinfacht<br />
werden kann.<br />
Information<br />
Jeder kann zum<br />
Entwurf Stellung<br />
nehmen<br />
Die Begutachtungsfrist dauert<br />
insgesamt acht Wochen (bis<br />
Ende September). Alle Bürgerinnen<br />
und Bürger, selbstverständlich<br />
auch Gemeinden, können<br />
Stellungnahmen und Kommentare<br />
zu diesem Entwurf abgeben.<br />
Im Falle der Gemeinden sind<br />
diese Stellungnahmen, ausschließlich<br />
elektronisch, an folgende<br />
drei E-Mail-Adressen zugleich zu<br />
richten:<br />
◆ oesterreichischer@<br />
gemeindebund.gv.at<br />
◆ v@bka.gv.at<br />
◆ begutachtungsverfahren@<br />
parlament.gv.at<br />
Grundzüge der Selbstverwaltung<br />
finden sich außer bei Gemeinden<br />
bei zahlreichen öffentlich-rechtlichen<br />
Genossenschaften (Jägerschaften,<br />
Agrargemeinschaften, Wassergenossenschaften<br />
u. a.), einzelne Ansätze auch bei<br />
einzelnen Formen der sozialpartnerschaftlichen<br />
Kooperationsverwaltung,<br />
wie den Sozialversicherungsträgern und<br />
den Marktordnungsfonds. (siehe hiezu<br />
Bernd Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht,<br />
Seite 164 f).<br />
Bedenkliche Entwicklung<br />
Die in ihrer Intensität nach verschieden<br />
ausgeprägten Formen der Selbstverwaltung<br />
scheinen nunmehr in Österreich in<br />
Gefahr zu sein. So ortet z.B. der Präsident<br />
der österreichischen Rechtsanwälte,<br />
Dr. Benn-Ibler, dass die Selbstverwaltung<br />
der Rechtsanwälte in Europa ins Gerede<br />
gekommen ist. Ausgehend von England<br />
unter den strengen Augen der Generaldirektion<br />
Binnenmarkt und Wettbewerb in<br />
der EU werde in einigen europäischen<br />
Ländern versucht, diese Selbstverwaltung<br />
so in den Griff zu bekommen, dass<br />
sie entweder überhaupt durch Organisationen,<br />
die in höherem Maße staatlichem<br />
Einfluss unterliegen, ersetzt wird oder<br />
die anwaltlichen Einrichtungen der<br />
Selbstverwaltung zwar belassen, aber<br />
solchen Organisationen mit Staatseinfluss<br />
unterstellt werden (siehe Österreichisches<br />
Anwaltsblatt – 06/2007, S.281).<br />
Im Hinblick auf die Selbstverwaltung der<br />
Jägerschaft ist auch die im Bezirk Neunkirchen<br />
(NÖ) die von der Bezirkshauptmannschaft<br />
erlassene Verordnung über<br />
die flächendeckende Grünvorlage bei<br />
Rotwild bedenklich. Abgesehen davon,<br />
dass meines Erachtens die gesetzlichen<br />
Grundlagen für diese Verordnung im<br />
Gegenstandsfall nicht ausreichen, stellt<br />
diese Verpflichtung letztlich ein Misstrauensvotum<br />
gegenüber der Jägerschaft und<br />
im weitesten Sinne ein Eingriff in die<br />
Selbstverwaltung der Jägerschaft dar.<br />
Auch die Überlegungen von Gesundheitsministerin<br />
Kdolsky, wonach die<br />
Sozialversicherungsträger nicht mehr<br />
das Geld zu vergeben hätten, sondern<br />
lediglich Servicestellen sein sollen,<br />
schlägt in dieselbe Kerbe.<br />
„Aufs Korn genommen?“<br />
Höchst bedenklich ist aber, dass man<br />
auch die gemeindliche Selbstverwaltung,<br />
die in der österreichischen Ausformung in<br />
ganz Europa beispielhaft ist, offenbar aufs<br />
Korn genommen hat. Laut Rechnungshofbericht<br />
bestehe bei den Aufsichtsmaßnahmen<br />
eine Diskrepanz zwischen den möglichen<br />
ökonomischen und rechtlichen
Ist denn die Selbstverwaltung in Österreich in Gefahr?<br />
◆ Dr. Roman Häußl<br />
Auswirkungen kommunalen Handelns<br />
einerseits und der beschränkten aufsichtsbehördlichenRechtskontrolle<br />
andererseits. Daher<br />
sollten im Bereich der<br />
Rechtskontrolle Mindesterfordernisse<br />
bei wirtschaftlich<br />
wichtigen Entscheidungen<br />
erstellt sowie fahrlässige<br />
oder vorsätzliche<br />
Organhandlungen zu<br />
Lasten der Gemeinden<br />
sanktioniert werden können.<br />
(Reihe NÖ<br />
2004/2S.18 Abs. 9.2,<br />
zuletzt Reihe NÖ 2006/3,<br />
Seite 3 Abs.1)<br />
Betrachtet man die in der<br />
NÖ Gemeindeordnung<br />
1973 sowie in den Stadtrechten<br />
auf Grund der<br />
Österreichischen Bundesverfassung<br />
vorgesehenen<br />
Aufsichtsmittel, so stellt<br />
man fest, dass es neben<br />
der Auskunfts- und Anzei-<br />
gepflicht, der Verordnungsprüfung,<br />
der Überprüfung<br />
der Gemeindegebarung,<br />
der Genehmigungspflicht<br />
bestimmter<br />
von den Gemeinden zu<br />
treffenden Maßnahmen,<br />
der Abhilfe bei Nichterfüllung<br />
von Verpflichtungen,<br />
der Prüfung der Gesetzmäßigkeit<br />
von Beschlüssen,<br />
der Prüfung der<br />
Gesetzmäßigkeit von<br />
Bescheiden, wie letztlich<br />
der Auflösung des<br />
Gemeinderates und des Gemeindevorstandes<br />
und – soweit es nicht Statutar-<br />
städte betrifft – der Vorstellungsmöglichkeit<br />
gegen letztinstanzliche Bescheide der<br />
Gemeinden, eine Fülle<br />
von Aufsichtsmitteln<br />
gibt, die bei entsprechender<br />
Anwendung<br />
durchaus garantieren,<br />
dass die Gemeinden<br />
ihren Auftrag nach<br />
gesetzmäßigem Handeln<br />
erfüllen. Dass die<br />
Aufsichtmitteln nicht<br />
immer effizient angewandt<br />
werden, hat<br />
ihre Ursache in politischen<br />
Konstellationen,<br />
nicht aber im Fehlen<br />
von Aufsichtsmitteln.<br />
Während also nach<br />
Auffassung des ÖsterreichischenRechnungshofes<br />
die Aufsichtmittel<br />
wenig effizient<br />
sind, vermeint<br />
z.B. Univ.Prof. Dr. Karl<br />
Weber, Leiter des Insti-<br />
tutes für öffentliches<br />
Recht, Staats- und Verwaltungslehre<br />
an der<br />
Universität Innsbruck,<br />
dass alle derzeit bestehendenverfassungsrechtlichenMöglichkeiten<br />
der Beschneidung<br />
der Gemeindeautonomie<br />
kritisch zu<br />
hinterfragen sind.<br />
Dazu zählen zwangsweiseGemeindeauflösungen<br />
bzw. Gemeindezusammenschlüsse<br />
ebenso wie die Bildung von Zwangsverbänden<br />
nach Artikel 116a B-VG. Auch<br />
Recht & Verwaltung<br />
Wehret den Anfängen<br />
Als ausgeprägteste und heute verfassungsrechtlich verankerte Form steht die „territorale<br />
Selbstverwaltung“ der Gemeinden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Vordergrund.<br />
Das Anliegen der „Selbstverwaltung“ begegnet uns als „ein politisches Schlagwort,<br />
mit dem das Bürgertum seine Freiheitsansprüche gegen die staatliche Bürokratie<br />
anmeldete“. Diese Errungenschaft gilt es zu schützen.<br />
Die gemeindliche<br />
Selbstverwaltung<br />
bedarf einer staatlichen<br />
Kontrolle. Die<br />
derzeit bestehenden<br />
Aufsichtsmittel sollten<br />
aber bei konkreter<br />
Anwendung durchaus<br />
ausreichen.<br />
sollte es den Ländern nicht mehr so ohne<br />
weiteres möglich sein, in ihren Gemeindeordnungen<br />
über den Artikel 119a B-VG<br />
angeordneten Aufsichtsbefugnisse neue<br />
Instrumente der Gemeindeaufsicht zu<br />
schaffen.<br />
Reaktion fällig<br />
Dass die gemeindliche Selbstverwaltung<br />
einer staatlichen Kontrolle bedarf, sei<br />
unbestritten. Ich glaube aber, dass die<br />
derzeit bestehenden Aufsichtsmittel bei<br />
konkreter Anwendung durchaus ausreichen,<br />
um den Staatsbürger vor allfälliger<br />
Willkür der Gemeinden zu schützen. So<br />
gesehen wird es Aufgabe des Österreichischen<br />
Gemeindebundes als bundesweite<br />
Interessensvertretung der Gemeinden<br />
sein, dem Sprichwort „wehret den<br />
Anfängen“ folgend entsprechende<br />
Schritte zum Schutz der Gemeindeautonomie<br />
zu setzen. Dies insbesondere im<br />
Hinblick auf die diskutierte Verfassung<br />
der Europäischen Union bzw. der geplanten<br />
Erneuerung des EU-Vertrages.<br />
◆ wirkl.Hofrat i. R. Prof. Dr. Roman<br />
Häußl ist Experte für Gemeinderecht<br />
in der Kanzlei Nistelberger<br />
KOMMUNAL 17
Nicht nur Kärnten, Klagenfurt im Speziellen, freut sich auf den Gemeindetag: Das Klagenfurt-Panorama vom Wörthersee aus.<br />
Nur noch knapp fünf Wochen bis zum 54. Gemeindetag 2007<br />
Kärnten freut sich<br />
auf 2000 Besucher<br />
Die Vorbereitungen für den 54. Österreichischen Gemeindetag laufen im Kärntner<br />
Gemeindebund seit Anfang des Jahres auf Hochtouren. Umso erfreulicher ist die Tatsache,<br />
dass viele Delegierte dem Aufruf gefolgt sind und gerne nach Klagenfurt kommen.<br />
„Wir freuen uns, dass der Gemeindetag<br />
in Kärnten schon im Vorfeld auf so<br />
reges Interesse stößt und sich zahlrei-<br />
»<br />
che GemeindevertreterInnen angemeldet<br />
haben. Wir werden unser Bestes<br />
geben, die Erwartungen, die nach den<br />
letzten Gemeindetagen in Wien und<br />
zuvor im Burgenland, sicher hoch<br />
gesteckt sind, zu erfüllen“, so Bgm.<br />
Hans Ferlitsch, Präsident des Kärntner<br />
Gemeindebundes.<br />
Knapp 2000 KommunalpolitikerInnen<br />
und Gemeindefunktionäre haben sich<br />
vom inhaltlichen, politischen und<br />
gesellschaftlichen Programm des dies-<br />
18 KOMMUNAL<br />
Knapp 2000<br />
Gemeinde politiker und<br />
-funktionäre haben sich<br />
vom Programm des<br />
Gemeindetages<br />
angesprochen gefühlt<br />
und sich angemeldet.<br />
Bgm. Hans Ferlitsch<br />
Präsident des Kärntner<br />
Gemeindebundes<br />
«<br />
jährigen Gemeindetages angesprochen<br />
gefühlt und sich für die Veranstaltung<br />
angemeldet. Kein Wunder, denn die<br />
Rednerliste könnte kaum prominenter<br />
sein, das Thema „Daseinsvorsorge<br />
im ländlichen Raum“<br />
kaum interessanter und das Rahmenprogramm<br />
kaum vielseitiger<br />
und müheloser für die Teilnehmer -<br />
Innen.<br />
Außerdem stellt der Gemeindetag<br />
jedes Jahr die geeignete Gelegenheit<br />
dar, sich mit KollegInnen aus<br />
nah und fern inhaltlich auszutauschen,<br />
Bekanntschaften aufzufrischen<br />
oder zu initiieren. An der<br />
größten kommunalpolitischen Veranstaltung<br />
des Jahres wird auch<br />
heuer wieder Bundespräsident<br />
Dr. Heinz Fischer teilnehmen und<br />
Grußworte an die Gäste richten. Zugegen<br />
sind auch Mitglieder der Bundesregierung<br />
die einerseits am Donnerstag<br />
bei der Fachtagung einen inhaltlichen<br />
Beitrag leisten (Impulsreferat von<br />
„Lebensminister“ Josef Pröll) und andererseits<br />
bei der Hauptveranstaltung am<br />
Freitag die Festreden komplettieren.<br />
Die gesellschaftlichen Hauptprogrammpunkte<br />
werden das „Fest der Kärntner<br />
Regionen“, welches am Donnerstag ab<br />
10 Uhr am Vorplatz des Messegeländes<br />
veranstaltet wird und die Galaabendveranstaltung<br />
unter dem Motto „Kärnten<br />
im Alpen-Adria-Raum“, sein.<br />
Es wird ein vielseitiges und interessantes<br />
Programm geboten, so dass Kärnten<br />
bis zum nächsten Gemeindetag in neun<br />
Jahren in positiver Erinnerung bei den<br />
Delegierten Österreichs bleibt.<br />
Organisatorische Hinweise<br />
◆ Registratur<br />
Bringen Sie für die Registratur<br />
unbedingt die Ihnen zugesandte<br />
Anmeldebestätigung für sich<br />
und Ihre Begleitpersonen mit.<br />
Damit erhalten Sie ab Donnerstag,<br />
27. September, 8.00 Uhr,<br />
im Messeeingangsfoyer Teilnehmerpass,<br />
Tagungsunterlagen<br />
und Tagungsgeschenk.<br />
◆ Shuttle-Service<br />
Ab Donnerstagvormittag, wird<br />
zu allen Programmpunkten und<br />
Unterkünften ein kostenloser<br />
Bus-Shuttle zur Verfügung stehen.<br />
Die Abfahrtszeiten finden<br />
Sie unmittelbar vor der Veranstaltung<br />
auf der Homepage<br />
(www.gemeindetag.at) und<br />
vor Ort am Gemeindetag.
Das Programm des<br />
Gemeindetages<br />
Donnerstag,<br />
27. September<br />
9.30 Uhr<br />
Registratur im Eingangsfoyer des<br />
Messegeländes Klagenfurt<br />
11.00 Uhr<br />
Eröffnung des Österreichischen<br />
Gemeindetages 2007 und der<br />
Kommunalmesse im Kommunalcorner<br />
der Halle 3<br />
11.30 Uhr<br />
„Fest der Kärntner Regionen“ am<br />
Messegelände<br />
ab 13.00 Uhr<br />
Fachtagung „Daseinsvorsorge im ländlichen Raum“ im<br />
Kommunalcorner der KOMMUNALMESSE, Halle 3<br />
◆ Impulsreferat von „Lebensminister“ Josef Pröll<br />
◆ Podiumsdiskussion mit Josef Pröll, Dr. Gaby Schaunig,<br />
LHStv. von Kärnten, Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer<br />
Österreich (angefragt), Rudolf Hundstorfer,<br />
Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer, Präsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
◆ Preisverleihung „Innovativste Gemeinde Österreichs<br />
2007“ (siehe auch Bericht rechts)<br />
18.30 Uhr<br />
Galaveranstaltung „Kärnten im<br />
Alpen-Adria-Raum“ mit Abendessen<br />
in der Messearena (Halle 5)<br />
Freitag,<br />
28. September<br />
9.00 Uhr<br />
Empfang des Bundespräsidenten<br />
im Messezentrum<br />
9.30 Uhr<br />
Offizieller Festakt zum 54. Österreichischen<br />
Gemeindetag in der Messearena<br />
(Halle 5) mit<br />
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer,<br />
Innenminister Günther Platter,<br />
Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer, Städtebund-Präsident<br />
Bgm. Dr. Michael Häupl und Kärntens<br />
Landeshauptmann Dr. Jörg Haider<br />
ab 11.30 Uhr<br />
Imbiss und Ausklang<br />
Innovativste Gemeinde 2007 am Gemeindetag<br />
50 Gemeinden kämpfen<br />
um Innovationspreis<br />
Die Einreichfrist ist<br />
abgelaufen, in wenigen<br />
Wochen wird die Siegergemeinde<br />
am<br />
Gemeindetag in Klagenfurt<br />
als „Innovativste<br />
Gemeinde 2007“ ausgezeich-<br />
net. Der<br />
gemeinsameWettbewerb<br />
von<br />
Gemeindebund,Wirtschaftsblatt<br />
und<br />
Kommunalkredit Austria<br />
hat auch heuer wieder<br />
zahlreiche interessante<br />
Einreichungen<br />
gebracht.<br />
Güssing (2004), Schenkenfelden<br />
(2005) und<br />
Amstetten (2006). Drei<br />
Gemeinden aus drei<br />
verschiedenen Bundesländern<br />
wurden bisher<br />
als „Innovativste<br />
Gemeinde“ ausgezeichnet. Alle drei<br />
Gemeinden, da sind sich die jeweiligen<br />
Bürgermeister einig, haben von der<br />
Auszeichnung ungeheuer profitiert.<br />
Güssing etwa gilt nach wie vor als<br />
„Mekka“ der erneuerbaren Energie.<br />
Journalisten, Fernsehteams und Interessenten<br />
aus ganz Europa besuchen<br />
immer wieder die burgenländische<br />
Kleinstadt, um sich zeigen zu lassen,<br />
wie man eine Gemeinde völlig energieautark<br />
macht. Auch die Projekte in<br />
54. Österreichischer Gemeindetag<br />
Amstetten war 2006 der Sieger beim Gemeindebund-Wettbewerb<br />
„Innovativste Gemeinde des Jahres“.<br />
Schenkenfelden (OÖ) und Amstetten<br />
(NÖ) haben große Aufmerksamkeit<br />
erregt. Der Bundespräsident persönlich<br />
besuchte Amstetten, um sich über das<br />
Programm „Amstetten 2010+: Zukunft<br />
aktiv gestalten“ zu informieren.<br />
Auch für den Wettbewerb 2007 wurde<br />
wieder eine Reihe spannender und sehr<br />
origineller Projekte eingereicht. Der<br />
„Mühlviertler Alm-Server“ etwa. Oder<br />
die Initiative von St. Johann im Pongau<br />
gegen das Koma-Saufen von Jugendlichen.<br />
Auch das Projekt „Drei Schwestern<br />
im Weinviertel“ macht neugierig.<br />
„Ich bin schon sehr gespannt, wer dieses<br />
Jahr den Sieg davon tragen wird“,<br />
so Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer. Die Preisverleihung<br />
findet heuer, schon zum zweiten Mal,<br />
vor großem Publikum statt. Im Rahmen<br />
des Gemeindetages 2007 in Klagenfurt<br />
werden die Siegergemeinden aufs<br />
Podium gebeten. Mediale Aufmerksamkeit<br />
inklusive.<br />
KOMMUNAL 19
KOMMUNALMESSE 2007<br />
Die KOMMUNALMESSE – Ein Mega-Event wurde zum Mega-Renner<br />
Ausverkauft!<br />
Die KOMMUNALMESSE von 27. bis 28.September in Klagenfurt ist das Top-Ereignis für<br />
Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für Gemeinden wichtig sind. Die Wirtschaft<br />
hat dieses Angebot so begeistert aufgenommen, dass die Messe seit Ende Juli<br />
ausverkauft ist, ja sogar eine Warteliste existiert. Mehr als 130 Firmen aus dem In- und<br />
Ausland zeigen auf rund 6500 m2 Ausstellungsfläche alles was Kommunen brauchen.<br />
Nicht nur die offensichtliche Bedeutung<br />
der Messe als direkte Schnittstelle zwischen<br />
Gemeinden und Wirtschaft kommt<br />
klar zutage. Auch das Thema „Daseinsvorsorge“<br />
des 54. Österreichischen<br />
Gemeindetagess trifft den Nerv. Der Run<br />
auf die Fachtagung am Donnerstag sagt<br />
alles. Ürspünglich wurde mit rund 800<br />
Teilnehmern gerechnet und die mobilen<br />
Tribünen auch darauf hin ausgelegt. Tat-<br />
»<br />
sache ist allerdings, dass der derzeitige<br />
Stand der Anmeldungen bei 1600 Teilnehmern<br />
liegt. Nicht nur eine gewaltige<br />
organisatorische Herausforderung, sondern<br />
auch ein Beweis, wie richtig der<br />
Kärntner Gemeindebund mit der Wahl<br />
dieses Themas lag. Und um die Bedeutung<br />
der KOMMUNALMESSE zu unterstreichen,<br />
hat sich KOMMUNAL bei den<br />
Ausstellern umgehört.<br />
Das sagen die Aussteller<br />
Österreichs Gemeinden sind wichtige<br />
Kunden für die Wirtschaft. Daher ist es<br />
für jedes Unternehmen, das Waren<br />
oder Dienstleistungen für Gemeinden<br />
anbietet, eine Selbstverständlichkeit,<br />
20 KOMMUNAL<br />
Die KOMMUNALMESSE ist<br />
immer eine gute Gelegenheit,<br />
unsere Zielgruppe, die Städte<br />
und Gemeinden, ansprechen zu<br />
können sowie den Kontakt zu<br />
den Entscheidungsträgern zu<br />
vertiefen.<br />
«<br />
Franz Mandl<br />
Geschäftsführer der gemdat Niederösterreich<br />
auf der KOMMUNALMESSE präsent zu<br />
sein. Das bestätigt auch der Geschäftsführer<br />
der gemdat Niederösterreich,<br />
Franz Mandl. „Die KOMMUNALMESSE<br />
ist immer eine gute Gelegenheit,<br />
unsere Zielgruppe, die Städte und<br />
Gemeinden, ansprechen zu können<br />
sowie den Kontakt zu den Entscheidungsträgern<br />
zu vertiefen.“ Heuer will<br />
die gemdat die Messe nutzen, um die<br />
neuesten Leistungs-<br />
merkmale von KIM in<br />
den Bereichen des<br />
elektronischen Datenaustausches<br />
zu präsentieren.<br />
„Die Einbindung<br />
zentraler<br />
Register in unsere<br />
Anwendungen ist<br />
ebenso ein Thema,<br />
wie auch der K.I.M.-<br />
ELAK, die barrierefreieGemeindehomepage<br />
sowie geografischeInformationssysteme.“<br />
Digitale<br />
Stadt- und Ortspläne sowie die Bürgerportal-Lösung<br />
ergänzen das Leistungsangebot<br />
der gemdat NÖ.<br />
Sinn für Qualität<br />
Auf der Messe kann man in angenehmer<br />
Atmosphäre mit den Kunden viele<br />
Dinge besprechen und dabei Produktneuheiten<br />
präsentieren. „Die KOMMU-<br />
NALMESSE ist die einzige Plattform,<br />
wo man Gemeindevertreter gezielt<br />
ansprechen kann“, sagt Franz Staudinger<br />
von der Firma RUKAPOL Arbeitsschutzartikel.<br />
„Wir waren bereits im<br />
vergangenen Jahr auf der Messe präsent<br />
und über das große Interesse der<br />
Besucher überrascht.“ In den Monaten<br />
nach der Messe konnte das Unternehmen<br />
eine deutliche Steigerung des<br />
Umsatzes mit Produkten für den Kommunalbedarf<br />
verzeichnen. In Zukunft<br />
will sich RUKAPOL verstärkt dieser<br />
Zielgruppe widmen. Staudinger: „Die<br />
Kommunen sind für uns enorm wichtig.<br />
In den letzten Jahren konnten wir<br />
unsere Geschäftstätigkeit in diesem<br />
Bereich kontinuierlich ausbauen. Für<br />
uns ist besonders wichtig, dass die<br />
Gemeinden und ihre Vertreter hochwertige<br />
Waren bevorzugen, und einen<br />
Sinn für Qualität haben. Gezielte<br />
Bedafserhebung und gemeinsame Produktfindung<br />
bzw. -entwicklung sind<br />
»<br />
Die KOMMUNALMESSE ist<br />
die einzige Plattform, wo<br />
man Gemeindevertreter<br />
gezielt ansprechen kann.<br />
Wir waren bereits im<br />
vergangenen Jahr auf der<br />
Messe präsent und über<br />
das große Interesse der<br />
Besucher überrascht.<br />
Franz Staudinger<br />
RUKAPOL Arbeitsschutzartikel<br />
«
Bereits 1998 gab es bei Gemeindetag und KOMMUNALMESSE<br />
in Kärnten eine Podiumsdiskussion – damals eine absolute<br />
Novität. und schon damals stürmten die Gemeindevertreter<br />
die Tribünen (rechts).<br />
wichtige Faktoren, um einerseits die<br />
Zufriedenheit der Mitarbeiter und<br />
andererseits die Lebensdauer der Produkte<br />
zu erhöhen. Dies steigert die Leistungsfähigkeit<br />
und senkt die Kosten,<br />
was dem Gemeindebudget zu Gute<br />
kommt.“<br />
Ideale Plattform zur<br />
Präsentation<br />
Viele Aussteller sind heuer erstmals auf<br />
der KOMMUNALMESSE vertreten.<br />
„Durch die Zeitschrift KOMMUNAL<br />
sind wir auf die KOMMUNALMESSE<br />
»<br />
Wir wollen in die anderen<br />
Bundesländer expandieren,<br />
und die KOMMUNALMESSE<br />
scheint uns ideal zu sein, um<br />
auf unsere Produkte aufmerksam<br />
zu machen.<br />
Norbert Hörner<br />
WET Wassertechnik<br />
«<br />
aufmerksam<br />
geworden und<br />
haben beschlossen,<br />
uns erstmals<br />
in diesem<br />
Rahmen zu präsentieren“,<br />
sagt<br />
Ing. Norbert<br />
Hörner von<br />
WET Wassertechnik.<br />
Denn die Gemeinden und<br />
Abwasserverbände sind die wichtigsten<br />
Kunden des Unternehmens. „Mit der<br />
Polyurea-Beschichtungstechnik bieten<br />
wir ein vollkommen neues Produkt, das<br />
wir den Kommunen vorstellen wollen.“<br />
Foto: Boltz<br />
KOMMUNALMESSE 2007<br />
Bisher war WET nur im Süden Österreichs<br />
aktiv. „Jetzt möchten wir in die<br />
anderen Bundesländer expandieren,<br />
und die KOMMUNALMESSE scheint<br />
uns ideal zu sein, um auf unsere Produkte<br />
aufmerksam zu machen“, so Hörner.<br />
Urkundenmappen auf<br />
der Messe bedrucken<br />
Auch die Firma Unibind Austria GmbH<br />
ist heuer erstmalig auf der KOMMU-<br />
NALMESSE vertreten. „2006 gab<br />
es großartige Erfolge mit Business -<br />
Books mit einer Steigerung von 380<br />
Prozent“ berichtet Mag.(FH) Doris<br />
Eipeldauer, Productmanagerin<br />
Business Books bei Unbind. „Jetzt<br />
KOMMUNAL 21
KOMMUNALMESSE 2007<br />
bieten wir auch allen Gemeinden die<br />
Möglichkeit, Ihre Ehrenurkunden persönlich<br />
zu gestalten.“ Bereits ab einer<br />
Stückzahl von fünf Urkundenmappen<br />
erhalten Gemeinden einen individuellen<br />
Vier-Farb-Druck mit Gemeindewappen,<br />
Logo, Foto oder Namen. Zu jeder<br />
Ehrung und zu jedem Anlass sofort<br />
parat – ob für Heirats-<br />
oder Gebursturkunden,Zertifikate<br />
oder besondereGlückwünsche.<br />
Das Messe-<br />
Highlight: Die Urkundenmappen werden<br />
direkt auf der Messe vierfärbig<br />
bedruckt. Alle Messebesucher können<br />
auf Stand Nr. 314a dabei zusehen.<br />
Professionelle<br />
Medienbeobachtung<br />
Ein neuartiges Service, das vor allem<br />
für Tourismus-Gemeinden interessant<br />
ist, bietet die Firma Observer an. „Wir<br />
beobachten 2300 österreichische Printmedien<br />
sowie Radio, TV und Internet<br />
und stellen unseren Kunden dann Clippings<br />
zur Verfügung“, sagt Mag. Florian<br />
Laszlo. „Gemeinden sollten wissen, was<br />
in den Medien über sie berichtet wird.<br />
Das gilt vor allem für Gemeinden, die<br />
vom Fremdenverkehr leben, da gerade<br />
für diese Orte ein gutes Image unbedingt<br />
wichtig ist.“<br />
Aber auch für andere Kommunen sei<br />
Medienbeobachtung enorm wichtig.<br />
Wenn sich etwa eine Gemeinde als<br />
Wirtschaftsstandort positionieren<br />
möchte, ist es natürlich unerlässlich,<br />
dass sie auch in den Medien als solcher<br />
wahrgenommen wird. „Oft passiert es<br />
auch, dass ein Ort z.B. mit einem Mord<br />
oder einem besonders tragischen Unfall<br />
in die Schlagzeilen kommt“, berichtet<br />
Laszlo. „Den Gemeindeverantwortlichen<br />
fällt es dann manchmal gar nicht<br />
gleich auf, dass monatelang nur mehr<br />
in diesem Zusammenhang über die<br />
Gemeinde berichtet wird, das wird oft<br />
erst anhand unserer Clippings<br />
22 KOMMUNAL<br />
»<br />
2006 gab es großartige<br />
Erfolge mit<br />
BusinessBooks mit<br />
einer Steigerung von<br />
380 Prozent.<br />
Mag.(FH) Doris Eipeldauer<br />
Productmanagerin BusinessBooks<br />
bei Unbind<br />
bewusst.“ Wenn<br />
man das Problem<br />
einmal erkannt hat,<br />
kann mit professioneller<br />
PR gegengesteuert<br />
werden.<br />
Auf der KOMMU-<br />
NALMESSE wird<br />
Observer<br />
drei<br />
zufriedene<br />
Kunden<br />
als Best-<br />
«<br />
pracise-<br />
Beispiele<br />
präsentieren:<br />
Die<br />
Industriestadt<br />
Linz, den<br />
Schiort<br />
Ischgl und die<br />
Gemeinde Bad Tatzmannsdorf,<br />
die sich<br />
im Hinblick auf die<br />
Fußball-Europamei-<br />
»<br />
sterschaft nicht nur als Thermenstandort,<br />
sondern auch als idealer Platz für<br />
Fußball-Trainingslager präsentieren<br />
will.<br />
Attraktiver Lebensraum<br />
für Familien<br />
Die Familien- und Berufsmanagement<br />
GesmbH macht auf der KOMMUNAL-<br />
MESSE auf ihr Audit „familien- und<br />
kinderfreundliche Gemeinde“ aufmerksam.<br />
Ziel des Audits ist es, Österreichs<br />
Kommunen zu einem attraktiven<br />
Lebensraum für die nachwachsende<br />
Generation und deren Eltern zu<br />
machen. „Nur Gemeinden, in denen<br />
sich Familien und Kinder wohl fühlen<br />
haben eine Zukunft“, stellt Geschäftführerin<br />
Irene Slama klar. „Interessierte<br />
Besucher der Messe können anhand<br />
konkreter Beispiele sehen, was man tun<br />
muss, damit sich Familien im Ort wohl<br />
fühlen“, so Slama.<br />
»<br />
Gemeinden sollten<br />
wissen, was in den<br />
Medien über sie berichtet<br />
wird. Das gilt vor allem<br />
für Gemeinden, die vom<br />
Fremdenverkehr leben,<br />
da gerade für diese Orte<br />
ein gutes Image<br />
unbedingt wichtig ist.<br />
Mag. Florian Laszlo<br />
Observer<br />
Interessierte Besucher der<br />
Messe können anhand konkreter<br />
Beispiele sehen, was<br />
man tun muss, damit sich<br />
Familien im Ort wohl fühlen.<br />
Irene Slama<br />
Geschäftführerin der Familien- und<br />
Berufsmanagement GesmbH<br />
«<br />
«
Der Gemeindebund feiert sein 60jähriges Bestehen<br />
Jubiläum<br />
60 Jahre erfolgreiche<br />
Interessensvertretung<br />
Die Geschichte des Österreichischen Gemeindebundes ist seit nunmehr sechs Jahrzehnten<br />
eine Geschichte des Erfolges. Im November feiert der Gemeindebund sein rundes<br />
Jubiläum mit einem Festakt im Parlament.<br />
Bereits in der Ersten Republik gab es<br />
Bemühungen, auch für die kleinen und<br />
mittleren Landgemeinden eine gemeinsame<br />
Vertretung zu schaffen. Ihren Ausgang<br />
nahmen sie von Oberösterreich;<br />
Motor war Minister a.D. Florian Födermayer,<br />
seit 1928 Bürgermeister von<br />
Kronstorf (Bezirk Linz-Land). Auf seine<br />
Initiative wurde 1936 der Oberösterreichische<br />
Landgemeindebund gegründet<br />
und Födermayer selbst zum<br />
Obmann gewählt. Die Intentionen<br />
Födermayers gingen weit über die<br />
oberösterreichischen Landesgrenzen hinaus,<br />
ihm schwebte bereits eine österreichweite<br />
Vertretung der Land- und<br />
Marktgemeinden vor. Entsprechende<br />
Kontakte wurden geknüpft, aber die<br />
politischen Verhältnisse machten diesen<br />
Bemühungen rasch ein Ende: Ab März<br />
1938 existierte Österreich nicht mehr.<br />
Die Pioniere<br />
Nach Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs nahm<br />
Minister a.D. Födermayer<br />
seinen Kampf<br />
um einen Zusammenschluss<br />
der Landgemeinden<br />
wieder auf.<br />
Beflügelt wurde er<br />
nicht zuletzt durch<br />
die laufenden Verhandlungen<br />
über den<br />
neuen Finanzausgleich,<br />
in denen sich<br />
1946 bereits die<br />
Installierung des<br />
abgestuften Bevölkerungsschlüssels<br />
abzeichnete, also die<br />
eklatante Benachteiligung<br />
der kleinen und<br />
mittleren Gemeinden.<br />
Schon die Intentionen<br />
Födermayers (Bild) gingen<br />
weit über die oberösterreichischen<br />
Landes -<br />
grenzen hinaus, ihm<br />
schwebte bereits eine<br />
österreichweite Vertretung<br />
der Land- und<br />
Marktgemeinden vor.<br />
Die Geburtsstunde des Gemeindebundes<br />
schlug am 16. November 1947 im Palais<br />
Todesco in der Wiener Kärntnerstraße.<br />
Der Österreichische Landgemeindenbund<br />
wurde konstituiert – auf Vereinsbasis<br />
mit freiwilliger Mitgliedschaft. Bei<br />
dem sperrigen Titel blieb es allerdings<br />
nicht lange. Nach vielen Diskussionen<br />
entschied man sich im Jänner 1948 für<br />
den Namen Österreichischer Gemeindebund.<br />
Der Vorschlag kam vom damaligen<br />
Staatssekretär im Innenministerium und<br />
späteren ersten Verteidigungsminister<br />
der Republik, Ferdinand Graf.<br />
Landesorganisationen gab es zum Zeitpunkt<br />
der Gemeindebund-Gründung in<br />
drei Bundesländern: in Oberösterreich,<br />
Salzburg und Tirol. In den übrigen Ländern<br />
wurden sie in den folgenden<br />
Monaten aufgebaut. Dabei war man sich<br />
im Klaren, dass der Gemeindebund nur<br />
als überparteiliche<br />
Interessenvertretung<br />
Stärke entfalten<br />
könnte. Überparteilich<br />
waren auch die<br />
Landesverbände –<br />
mit zwei Ausnahmen:<br />
Niederösterreich, das<br />
Bundesland mit den<br />
meisten Gemeinden,<br />
und Burgenland, wo<br />
bereits Gemeindevertreterverbände<br />
der<br />
beiden Großparteien<br />
im Aufbau waren.<br />
Dieser Prozess war<br />
nicht mehr umkehrbar,<br />
vor allem auch<br />
auf Grund der besonderen<br />
Bedingungen<br />
in der Besatzungszeit:<br />
In den Gemeinden<br />
waren provisorische<br />
Bürgermeister<br />
und Gemeinderäte eingesetzt, Gemeinderatswahlen<br />
fanden erst 1949 und<br />
1950 statt. Das bedeutete, dass in der<br />
sowjetischen Besatzungszone die Kommunisten<br />
ein Drittel der Gemeindemandatare<br />
stellten und auch in einem<br />
gemeinsamen Landesverband großen<br />
Einfluss gehabt hätten. Die Folge: Bis<br />
heute hat der Österreichische Gemeindebund<br />
in acht Bundesländern insgesamt<br />
zehn Landesverbände.<br />
Die Präsidenten<br />
An der Spitze des neu gegründeten<br />
Gemeindebundes stand zunächst ein Provisorischer<br />
Vorstand, zum Obmann wurde<br />
der steirische Landesrat und spätere Landeshauptmann<br />
(1948 bis 1971) Josef<br />
Krainer bestellt. Bei der konstituierenden<br />
Generalversammlung im Rahmen des 1.<br />
Gemeindetages wurde einstimmig der<br />
Pionier der kommunalen Interessenvertretung,<br />
Minister a.D. Florian Födermayer<br />
zum Obmann – später: Präsident –<br />
gewählt. Er war der erste von bisher insgesamt<br />
fünf Präsidenten des Österreichischen<br />
Gemeindebundes:<br />
◆ Minister a.D. Florian Födermayer, Oktober<br />
1948 bis Dezember 1957, aus<br />
Kronstorf (Oberösterreich)<br />
◆ NRAbg. Ernst Grundemann-Falkenberg,<br />
Dezember 1957 bis Jänner 1971, aus<br />
Reichenthal (Oberösterreich)<br />
◆ Landtagspräsident Ferdinand Reiter,<br />
Jänner 1971 bis Februar 1987, aus<br />
Zistersdorf (Niederösterreich)<br />
◆ Landtagspräsident Mag. Franz Romeder,<br />
Februar 1987 bis Februar 1999,<br />
Schweiggers (Niederösterreich)<br />
◆ LAbg.a.D. Bgm. Helmut Mödlhammer<br />
aus Hallwang (Salzburg), seit Februar<br />
1999<br />
KOMMUNAL 23
Kommunale Wirtschaft<br />
Daseinsvorsorge – In kleinen Schritten vorwärts?<br />
Ist „öffentlich“ gleich<br />
„nicht rentabel“?<br />
Die allgemeine und diskriminierungsfreie Zugänglichkeit von Dienstleistungen von allgemeinem<br />
wirtschaftlichem Interesse ist eines der Kennzeichen des europäischen<br />
Sozialmodells und unterscheidet Europa von anderen großen Wirtschaftsräumen (USA,<br />
Südostasien, Japan). Ob das in Gefahr ist, zeigt KOMMUNAL.<br />
◆ Dr. Caspar Einem<br />
Europas spezifische Versorgungskonzeption<br />
ist ständig durch die Binnenmarktlogik<br />
der EU und die darauf aufbauende<br />
Judikatur des Europäischen Gerichtshofs<br />
(EuGH) gefährdet.<br />
Derzeit ist die entscheidende Rechtsgrundlage<br />
Artikel 16 des Vertrages über<br />
die Europäische Gemeinschaft (EGV). Er<br />
ist geradezu kennzeichnend für die Zerrissenheit<br />
des europäischen Rechts zwischen<br />
Daseinsvorsorge und Wettbewerbsorientierung<br />
und bietet daher keinen<br />
hinreichenden Schutz für den Bestand<br />
der Daseinsvorsorgeleistungen in der EU<br />
und in Österreich.<br />
Worin besteht die Wettbewerbsorientierung<br />
und warum ist sie problematisch?<br />
Dort, wo Güter und Dienstleistungen privatwirtschaftlich<br />
erbracht und über den<br />
Markt verkauft werden, ist zweifellos<br />
geregelter und fairer Wettbewerb im<br />
Interesse der Konsumenten, namentlich<br />
der schwächeren unter ihnen. Der Wettbewerb<br />
bringt es aber mit sich, dass die<br />
Versorgung der wirtschaftlich schwäche-<br />
◆ Dr. Caspar<br />
Einem ist Präsident des Verbandes der<br />
Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft<br />
Österreichs (VÖWG)<br />
24 KOMMUNAL<br />
ren oder der regional entfernteren<br />
Abnehmer oftmals nicht rentabel ist. Sie<br />
laufen dann Gefahr, gar nicht versorgt zu<br />
werden. Das ist der Grund, warum demokratisch<br />
legitimiert Gebietkörperschaften<br />
derartige Leistungen entweder selbst<br />
erbringen oder bestimmte Leistungsträger<br />
mit der Erbringung beauftragen, um<br />
sicher zu stellen, dass eben alle Bürgerinnen<br />
und Bürger zu vertretbaren Preisen<br />
und diskriminierungsfrei versorgt werden.<br />
Wo ist das Problem der<br />
Daseinsvorsorge?<br />
Das Problem für die Daseinsvorsorge<br />
besteht darin, dass im Gegensatz zum<br />
Buchstaben der<br />
Europäischen Verträge,<br />
der festlegt,<br />
dass die EU gegenüber<br />
den unterschiedlichenEigentumsformen<br />
neutral ist,<br />
tatsächlich stets der<br />
Verdacht gehegt wird,<br />
dass Leistungen, die<br />
öffentlich erbracht<br />
und/oder finanziert<br />
werden, nicht gleich<br />
effizient sein können,<br />
wie privat und im<br />
Wettbewerb<br />
erbrachte. Und dieser<br />
Verdacht drückt sich<br />
in der Judikatur des<br />
EuGH aus und engt den Spielraum für<br />
die Daseinsvorsorge immer mehr ein.<br />
Im sog. Verfassungskonvent (2002/03)<br />
Das Problem für die<br />
Daseinsvorsorge besteht<br />
darin, dass ... tatsächlich<br />
stets der Verdacht gehegt<br />
wird, dass Leistungen, die<br />
öffentlich erbracht<br />
und/oder finanziert werden,<br />
nicht gleich effizient sein<br />
können, wie privat und im<br />
Wettbewerb erbrachte.<br />
wurde versucht, „die allgemeine und diskriminierungsfreie<br />
Zugänglichkeit von<br />
Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichem)<br />
Interesse“ unter die Ziele<br />
der Union (Artikel I 3 des Verfassungsvertrages)<br />
einzureihen. Dieser Versuch ist am<br />
Präsidenten des Konvents und vermutlich<br />
am britischen Widerstand gescheitert.<br />
Gelungen ist allerdings eine Bestimmung<br />
in Teil III des Verfassungsvertrages unter<br />
den „Allgemein anwendbaren Bestimmungen“,<br />
die es erlaubt hätte, eine<br />
gesetzliche Abgrenzung zwischen Wettbewerbsgebot<br />
auf der einen und Daseinsvorsorgegebot<br />
auf der anderen Seite vorzunehmen.<br />
Nur so hätte man dem EuGH<br />
Grenzen setzen können. In der Regierungskonferenz<br />
ist dann noch eine weitere<br />
Verbesserung gelungen, indem die<br />
Zuständigkeit der<br />
Mitgliedstaaten,<br />
„diese Dienste im Ein-<br />
klang mit der Verfassung<br />
zur Verfügung<br />
zu stellen, in Auftrag<br />
zu geben und zu<br />
finanzieren“, auch in<br />
diesem Artikel (Artikel<br />
III 122) festgelegt<br />
wurde. Diese Bestimmung,<br />
insbesondere<br />
wenn sie im Zusammenhang<br />
mit Artikel I<br />
5 gelesen wird, der<br />
die Achtung der<br />
Union für die verfassungsrechtlicheStruktur<br />
der Mitgliedstaaten<br />
„einschließlich der regionalen und<br />
kommunalen Selbstverwaltung“ zum<br />
Gegenstand hat und mit Artikel II 96, der
Kommunale Wirtschaft<br />
Der Wettbewerb bringt es mit sich, dass die Versorgung der wirtschaftlich schwächeren oder der regional entfernteren Abnehmer<br />
oftmals nicht rentabel ist. Sie laufen dann Gefahr, gar nicht versorgt zu werden.<br />
die allgemeine Zugänglichkeit der Leistungen<br />
der Daseinsvorsorge als Grundrecht<br />
formuliert, hätte einen Schritt vorwärts<br />
bedeutet. Aber der Verfassungsvertrag<br />
blieb in den Volksabstimmungen in<br />
Frankreich und in den Niederlanden hängen.<br />
Womit ist zu rechnen?<br />
Derzeit tagt wieder eine Regierungskonferenz<br />
und versucht zu retten, was inhaltlich<br />
vom Verfassungsvertrag zu retten ist.<br />
Die Grundrechtscharta wird zwar künftig<br />
nicht Teil des Grundlagenvertrages sein,<br />
aber in einem gesonderten Protokoll festgehalten<br />
und rechtsverbindlich werden.<br />
Der heutige Artikel II 96 des Verfassungsvertrages<br />
wird also überleben.<br />
Artikel I 5, der erstmals die regionale und<br />
kommunale Selbstverwaltung berücksichtigt,<br />
wird ebenfalls, wenn auch an anderer<br />
Stelle überleben. Und Artikel 16 EGV<br />
wird den Inhalt des<br />
Artikels III 122 des<br />
Verfassungsvertra-<br />
ges bekommen und<br />
durch ein Protokoll<br />
ergänzt werden,<br />
das den Artikel<br />
selbst verbindlich<br />
auslegt. Darin wird<br />
in Artikel 2 festgehalten,<br />
was bereits<br />
heute anerkannte<br />
Rechtslage ist, dass<br />
nichtwirtschaftliche<br />
Dienste von allgemeinem<br />
Interesse<br />
ausschließlich<br />
durch die Mitglied-<br />
Die wirtschaftlich<br />
schwächeren oder regional<br />
entfernteren Konsumenten<br />
sind der Grund, warum<br />
demokratisch legitimiert<br />
Gebietkörperschaften<br />
Leistungen der Daseinsvorsorge<br />
selbst erbringen oder<br />
bestimmte Leistungsträger<br />
mit der Erbringung<br />
beauftragen.<br />
staaten zu gestalten sind. Das löst in den<br />
meisten Fällen das Problem noch nicht.<br />
Artikel 1 versucht eine Lösung für die<br />
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem<br />
Interesse, um die der Kampf – hier<br />
privatwirtschaftliche Erbringung im Wettbewerb,<br />
da öffentliche oder öffentlich<br />
beauftragte Erbringung im Versorgungsinteresse<br />
– tobt. Die Bestimmung lautet:<br />
„ Artikel 1<br />
Zu den gemeinsamen Werten der Union in<br />
Bezug auf Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem<br />
Interesse im Sinne von Artikel<br />
16 des EG-Vertrages zählen<br />
insbesondere:<br />
die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum<br />
der nationalen, regionalen und<br />
lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste<br />
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse<br />
auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut<br />
wie möglich entsprechende Weise zu erbringen,<br />
in Auftrag zu geben und zu organisieren<br />
sind;<br />
die Verschiedenartigkeit<br />
der jeweiligen Dienstleistungen<br />
von allgemeinem<br />
wirtschaftlichem Interesse<br />
und die Unterschiede<br />
bei den Bedürfnissen und<br />
Präferenzen der Nutzer,<br />
die aus unterschiedlichen<br />
geografischen, sozialen<br />
oder kulturellen Gegebenheiten<br />
folgen können;<br />
ein hohes Niveau in<br />
Bezug auf Qualität,<br />
Sicherheit und Bezahlbarkeit,Gleichbehandlung<br />
und Förderung des<br />
universellen Zugangs<br />
und der Nutzerrechte.“<br />
Kommt diese Kombination von Regeln, so<br />
ist das zweifellos eine Verbesserung<br />
gegenüber der heutigen Rechtslage,<br />
wenn auch keine entscheidende. Es wird<br />
auch weiter nötig sein, wachsam zu bleiben<br />
gegenüber Initiativen der Europäischen<br />
Kommission, die weiterhin ihre<br />
Binnenmarktorientierung behalten und<br />
allenfalls noch heuer Vorschläge unterbreiten<br />
wird, wie die Dienstleistungen<br />
von allgemeinem gesundheitlichen Interesse<br />
geregelt werden sollen oder wie die<br />
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem<br />
Interesse im Rahmen der<br />
Binnenmarktstrategie behandelt werden<br />
sollen. Hier bietet der CEEP eine geeignete<br />
Plattform für frühzeitiges Handeln<br />
im Interesse der Daseinsvorsorge.<br />
Was aber auch nötig bleibt, ist jene nationalen<br />
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen,<br />
die die Leistungen der Daseinsvorsorge<br />
erst einigermaßen EuGH-sicher machen.<br />
Dazu zählt insbesondere die Gewährleistung<br />
der „Betrauung“ der Unternehmen<br />
mit derartigen Dienstleistungen durch<br />
einen Rechtsakt (vgl. Artikel 86 Abs. 2<br />
EGV und die Judikatur des EuGH) und<br />
die Wahl einer geeigneten Rechtsform<br />
des ausgegliederten Unternehmens im<br />
Falle der sog. Inhouse-Vergabe. Nach derzeitiger<br />
Judikatur des EuGH wird dabei<br />
wohl nur eine Lösung mit einer im<br />
100prozentigen Eigentum der öffentlichen<br />
Hand stehenden Gesellschaft mit<br />
beschränkter Haftung in Betracht kommen.<br />
Zu diesem Themenkomplex hat der<br />
VÖWG eine Grundlagenstudie erarbeitet,<br />
die seinen Mitgliedern ab September<br />
2007 zur Verfügung steht.<br />
KOMMUNAL 25
Recht & Verwaltung<br />
Mietvertragsklausel: Klarheit durch die OGH-Entscheidung vom März<br />
Bei wem liegt nun die<br />
Erhaltungspflicht?<br />
Inhalt der OGH-Entscheidung sind Vertragsklauseln über die Erhaltungspflicht für den<br />
Mietgegenstand. Im Großen und Ganzen ging es hier vornehmlich um Vertragsformblätter<br />
für den Abschluss von Mietverträgen, die in den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes<br />
MRG fallen. KOMMUNAL untersucht die Auswirkungen auf die Gemeinden.<br />
◆ Gerhard Stabentheiner<br />
In diesem Rechtsstreit vor dem Obersten<br />
gerichtshof (OGH) standen sich die Bundeskammer<br />
für Arbeiter und Angestellte<br />
als Verbandsklägerin – und die Fachgruppe<br />
Wien der Immobilien – und Vermögenstreuhänder<br />
als Beklagte gegenüber.<br />
Die im Verfahren zur 2. Verbandsklage<br />
als Klausel 2 bezeichnete (für den<br />
Vollanwendungsbereich des Mietrechts-<br />
Gesetz (MRG) vorgesehene) Vertragsbestimmung<br />
lautet:<br />
„Der Mieter hat den Mietgegenstand und<br />
die für den Mietgegenstand bestimmten<br />
Einrichtungen und Geräte wie im Besonderen<br />
die Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-,<br />
Beheizungs- und Sanitären<br />
Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräte und<br />
Öfen zu warten, sowie insoweit instand zu<br />
halten und zu erneuern (insbesondere auch<br />
die Erneuerung von Warmwasser-/ Heizgeräten<br />
und dergleichen), als es sich nicht<br />
um erste Schäden des Hauses handelt. Die<br />
Wartungs- und Instandhaltungspflicht<br />
erstreckt sich auch auf vorhandene Antennenanlagen.“<br />
◆ KR Gerhard Stabentheiner<br />
ist Mietrechtsexperte des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
26 KOMMUNAL<br />
Zumindest bei Unternehmer- Verbraucher-<br />
Verträgen wurde die Überwälzung<br />
der Erhaltungspflicht für den bedungenen<br />
Gebrauch des Mietgegenstandes auf<br />
den Mieter für unwirksam erklärt. Die<br />
Ablehnung der<br />
obzitierten Klausel<br />
2 wird letztlich auf<br />
§ 9 Abs. 1 KschG<br />
zurückgeführt.<br />
Offenbar nur für<br />
Mietverträge<br />
außerhalb des<br />
Anwendungsbereichs<br />
des<br />
Konsumentenschutzgesetzes<br />
wird in der Entscheidungfestgehalten,<br />
dass es<br />
jedenfalls außerhalb<br />
des Vollanwendungsbereichs<br />
des MRG<br />
grundsätzlich zulässig sei, die Pflicht zur<br />
Instandhaltung des Mietgegenstandes auf<br />
den Mieter zu überwälzen.<br />
Zum besseren Verständnis werden in den<br />
nächsten Absätzen der § 9 Abs. 1 Konsumentenschutz-Gesetz<br />
(KschG), der § 3<br />
Abs. 1 MRG (Erhaltungspflicht des Vermieters),<br />
sowie der § 8 Abs. 1 MRG<br />
(Benützungsrechte und Pflichten des<br />
Hauptmieters) und der § 1096 des Allgemeinen<br />
Bürgerlichen Gesetzbuches<br />
(ABGB) (wechselseitige Rechte: Überlassung,<br />
Erhaltung, Benützung) wiedergegeben.<br />
◆ § 9 Abs.1 KschG<br />
Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers<br />
dürfen nur durch Vereinbarungen<br />
Gehen Mängel über die<br />
gewöhnlichen (und vom<br />
Vermieter hinzunehmenden)<br />
Gebrauchsspuren hinaus, ... ,<br />
wandelt sich die Obliegenheit<br />
des Mieters zum pfleg -<br />
lichen Gebrauch des Mietgegenstandes<br />
in eine entsprechende<br />
Verpflichtung um.<br />
beschränkt werden, nach denen<br />
1. sich der Unternehmer bei der Gattungsschuld<br />
von den Ansprüchen auf Aufhebung<br />
des Vertrages oder auf angemessene Preisminderung<br />
dadurch befreien kann, dass er<br />
in angemessener Frist<br />
die mangelhafte gegen<br />
eine mängelfreie austauscht.<br />
◆ § 3 Abs. 1 MRG<br />
Der Vermieter hat<br />
nach Maßgabe der<br />
rechtlichen, wirtschaftlichen<br />
und technischen<br />
Gegebenheiten und<br />
Möglichkeiten dafür zu<br />
sorgen, dass das Haus,<br />
die Mietgegenstände<br />
und der gemeinsamen<br />
Benützung der Bewohner<br />
des Hauses dienenden<br />
Anlagen im jeweils<br />
ortsüblichen Standard<br />
erhalten werden. Im übrigen bleibt<br />
§ 1096 des allgemein bürgerlichen Gesetzbuches<br />
unberührt.<br />
◆ § 8 Abs. 1 MRG<br />
Der Hauptmieter ist berechtigt, den Mietgegenstand<br />
dem Vertrag gemäß zu gebrauchen<br />
und zu benützen. Er hat den Mietgegenstand<br />
und die für den Mietgegenstand<br />
bestimmten Einrichtungen, wie im besonderen<br />
die Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-,<br />
Beheizungs- (einschließlich von<br />
zentralen Wärmeversorgungsanlagen) und<br />
sanitären Anlagen so zu warten und,<br />
soweit es sich nicht um die Behebung von<br />
ernsten Schäden handelt, so instand zu<br />
halten, dass dem Vermieter und den ande-
en Mietern des Hauses kein Nachteil<br />
erwächst. Wird die Behebung von ernsten<br />
Schäden des Hauses nötig, so ist der Hauptmieter<br />
bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet,<br />
dem Vermieter ohne Verzug<br />
Anzeige zu machen.<br />
◆ § 1096 ABGB<br />
1. Vermieter und Verpächter sind verpflichtet,<br />
das Bestandstück auf eigene Kosten und<br />
brauchbarem Stande zu übergeben und zu<br />
erhalten und die Bestandinhaber in den<br />
bedungenen Gebrauche und Genusse nicht<br />
zu stören. Ist das Bestandstück bei der<br />
Übergabe derart mangelhaft oder wird es<br />
während der Bestandzeit ohne Schuld des<br />
Bestandnehmers derart mangelhaft, dass es<br />
zu dem bedungenen Gebrauche nicht taugt,<br />
so ist der Bestandnehmer für die Dauer in<br />
dem Maße der Unbrauchbarkeit von der<br />
Entrichtung des Zinses befreit. Auf diese<br />
Befreiung kann bei der Miete unbeweglicher<br />
Sachen im Voraus nicht verzichtet<br />
werden.<br />
2. Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen<br />
der Wirtschaftsgebäude nur<br />
insoweit selbst zu tragen, als sie mit den<br />
Materialien des Gutes und den Diensten,<br />
die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu<br />
fordern berechtigt ist, bestritten werden<br />
können.<br />
Verpflichtung zum<br />
pfleglichen Gebrauch<br />
Es gibt einen den Sorgfaltspflichten entsprechenden<br />
und von vornherein den<br />
Mieter treffenden Verantwortungsbereich.<br />
Unter diesem ist etwa die Pflege<br />
und Reinigung des Mietgegenstandes<br />
und dessen Einrichtungen (Böden,<br />
Wände, Innenfenster, Türen, Sanitäranlagen,<br />
Ver- und Entsorgungseinrichtungen,<br />
mitvermietetes Mobilar, die Beseitigung<br />
von Abnützungen und geringfügigen<br />
Gebrauchsschäden wie z.B. lockere und<br />
gesprungene Fliesen, beschädigte Sessell-<br />
eisten, defekte Armaturen und vieles<br />
andere mehr) zu subsummieren. Zumal<br />
ein derartig pfleglicher Gebrauch von<br />
vornherein nicht den Vermieter trifft,<br />
muss er von ihm auch nicht eigens abbedungen<br />
werden. Wegen der in den angeführten<br />
Bereichen bestehenden Mängel<br />
und Beeinträchtigungen stehen dem<br />
Mieter gegen den Vermieter auch keinerlei<br />
Mietzinsminderungsansprüche,<br />
Ansprüche auf Durchsetzung der Mängelbeseitigung<br />
oder gar im Fall der Vornahme<br />
der Mängelbeseitigung durch den<br />
Mieter Ersatzansprüche zu. Im Gegenteil.<br />
Gehen Mängel über die gewöhnlichen<br />
(und vom Vermieter hinzunehmenden)<br />
Gebrauchsspuren hinaus bzw. sind<br />
Pflege- Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen<br />
zur Abwehr von Nachteilen<br />
des Vermieters (Eigentümers) bzw. der<br />
anderen Mieter des Hauses vonnöten,<br />
(wie z.B. die Instandhaltung der oberflächlichen<br />
Teile der Elektroinstallationen<br />
durch etwa Austausch von Glühbirnen<br />
und Sicherungen und die Erneuerung<br />
von gebrochenen und ausgeleierter<br />
Lichtschalter und Steckdosen) und vieles<br />
andere mehr, wandelt sich die Obliegenheit<br />
des Mieters zum pfleglichen<br />
Gebrauch des Mietgegenstandes in eine<br />
entsprechende<br />
Verpflichtung um<br />
und stehen dem<br />
Vermieter somit<br />
Möglichkeiten zur<br />
Durchsetzung dieser<br />
Verpflichtung<br />
oder auch zur<br />
Aufkündigung<br />
bzw. Auflösung<br />
des Mietverhältnisses<br />
wegen<br />
erheblich nachteiligen<br />
Gebrauchs<br />
offen.<br />
Der Mieter wird<br />
daher im EigeninteresseWartungs-<br />
Es gilt unbeantwortet,<br />
ob und unter welchen<br />
Voraussetzungen der Mieter<br />
den Ersatz allfälliger<br />
Erhaltungsaufwendungen<br />
in diesem Zwischenbereich<br />
vom Vermieter verlangen<br />
kann. Hier scheinen noch<br />
klärende Worte des<br />
Gesetzgebers angebracht.<br />
Recht & Verwaltung<br />
maßnahmen setzen und es ist anzuraten,<br />
diese auch zu dokumentieren.<br />
Reparatur oder Austausch<br />
der Heiztherme<br />
Eine Abbedingung der den Vermieter im<br />
Vollanwendungsbereich des MRG allenfalls<br />
treffenden Erhaltungspflichten gem.<br />
§ 1096 Abs. 1, Satz1 ABGB ist hingegen<br />
selbst dann als zulässig zu erachten,<br />
wenn man hinsichtlich deren Nichtüberwälzbarkeit<br />
den neuesten OGH-Entscheidungen<br />
folgen sollte. Im Falle einer solchen<br />
Abbedingung stehen dem Mieter bei<br />
Vorliegen entsprechender Mängel (z.b.<br />
Defekt einer mitvermieteten Heiztherme)<br />
gegenüber dem Vermieter zwar Mietzinsminderungsansprüche,<br />
nicht aber darüber<br />
hinausgehende Leistungsansprüche,<br />
gerichtet auf Durchsetzung der Erhaltungsmaßnahmen<br />
(z.B. Reparatur oder<br />
Austausch der Heiztherme) bzw. Geldersatz<br />
für bereits selbst getätigte Erhaltungsaufwendungen<br />
zu. Die dem Mieter<br />
zustehende Mietzinsminderung ist auf die<br />
Dauer und das Ausmaß der mit dem<br />
Mangel verbundenen Beeinträchtigung<br />
des bedungenen Gebrauchs beschränkt:<br />
Beseitigt der Mieter den Mangel selbst,<br />
wird damit auch der Mietzinsminderungsanspruch<br />
beendet, zumal ab diesem<br />
Zeitpunkt keine Beeinträchtigung des<br />
bedungenen Gebrauchs vorliegt.<br />
Schlussbemerkung<br />
Zahlreiche Fragen bleiben nach der nunmehrigen<br />
Klausel-Entscheidung offen. So<br />
etwa ob im Vollanwendungsbereich des<br />
MRG zwischen der zwingenden Erhaltungspflicht<br />
des Vermieters nach § 3 MRG<br />
und der sehr eingeschränkten Wartungsund<br />
Instandhaltungspflicht des Mieters<br />
nach § 8 Abs.1 MRG nun der dispositive §<br />
1096 ABGB gelte oder aber ein gesetzlich<br />
ungeregelter Bereich verbleibt. Weiters<br />
gilt unbeantwortet, ob<br />
und bejahendenfalls<br />
wann und unter welchen<br />
Voraussetzungen<br />
der Mieter den Ersatz<br />
allfälliger Erhaltungsaufwendungen<br />
in diesem<br />
Zwischenbereich<br />
vom Vermieter verlangen<br />
kann. Hier scheinen<br />
noch klärende<br />
Worte des Gesetzgebers<br />
angebracht.<br />
(Quellen: Mag. Kothbauer,<br />
Dr. Staben -<br />
theiner)<br />
KOMMUNAL 27
Recht & Verwaltung<br />
Gesundheitsgefährdung bei der Wasserversorgung<br />
Doppelte Haftungsfalle<br />
Bleirohre<br />
Sowohl bei der Trinkwasserversorgung als auch als Vermieterin kann die Gemeinde Haftungsansprüchen<br />
wegen der Gesundheitsgefährdung durch bleihaltige Wasserrohre<br />
ausgesetzt sein. In welchen Fallkonstellationen wurde diese Haftung bereits schlagend,<br />
wo ergeben sich zusätzliche Gefährdungspotenziale?<br />
◆ a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Vonkilch<br />
In einer Entscheidung des OGH (OGH<br />
4. 4. 2006, 1 Ob 256/05m) wurde<br />
jüngst die Haftung einer Gemeinde<br />
bejaht, wenn sie es im Rahmen der<br />
öffentlichen Trinkwasserversorgung<br />
unterlässt, für die Abwehr jener<br />
Gesundheitsgefahren zu sorgen, die<br />
von Bleileitungen ausgehen<br />
können. Im Folgenden<br />
werden<br />
zunächst die Kernaussagen<br />
der Entscheidung<br />
sowie die aus<br />
ihr resultierenden<br />
finanziellen Konsequenzen<br />
dargestellt.<br />
Dass diese Konsequenzen<br />
die konkrete<br />
Gemeinde im Anlass -<br />
fall nicht in vollem<br />
Umfang getroffen<br />
haben, resultierte bloß aus den<br />
Umständen des Einzelfalls: der OGH<br />
bejahte bezüglich des von der Klägerin<br />
geltend gemachten Schmerzengelds<br />
◆ A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas<br />
Vonkilch ist am Institut für Zivilrecht<br />
der Universität Wien tätig.<br />
28 KOMMUNAL<br />
Abzuraten ist einer<br />
Gemeinde von einem<br />
Zuwarten mit der<br />
Aufarbeitung der<br />
Bleirohr-Problematik in<br />
ihren Miethäusern.<br />
das Zustandekommen eines Vergleichs ,<br />
der sich für die beklagte Gemeinde im<br />
nachhinein als sehr günstig herausstellte.<br />
Konkret waren von der<br />
Gemeinde aufgrund des Vergleichs nur<br />
ca. 7300 Euro an Schmerzensgeld zu<br />
leisten, und nicht – wie von der Klägerin<br />
(dem Grunde nach<br />
grundsätzlich wohl<br />
berechtigt, aber auf-<br />
grund des Vergleichs<br />
„zu spät“) in weiterer<br />
Folge geltend gemacht<br />
– ca. 138.000 Euro.<br />
Darüber hinaus kann in<br />
Hinblick auf die Thematik<br />
„Bleirohre“ nicht<br />
allein schon deswegen<br />
Entwarnung gegeben<br />
werden, weil das<br />
öffentliche Wasserversorgungsnetz<br />
bereits dem Stand der<br />
Technik angepasst wurde. Im Hinblick<br />
auf die weit verbreitete Rolle von<br />
Gemeinden als private Wohnungsvermieter<br />
ist es nämlich keineswegs ausgeschlossen,<br />
dass es aufgrund des Inkrafttretens<br />
der Wohnrechtsnovelle 2006<br />
(WRN 2006) mit 1. 10. 2006, zu einem<br />
zweiten Akt des (auch finanziellen)<br />
Dramas „Die Gemeinde und das Bleirohr“<br />
kommt. So fungiert etwa die<br />
Gemeinde Wien als Vermieterin von ca.<br />
220.000 Gemeindewohnungen.<br />
Haftung wegen mangelhafter<br />
Wasserversorgung<br />
Im Anlassfall war Folgendes passiert:<br />
Aufgrund des Vorhandenseins eines<br />
fünf bis sechs Meter langen Bleirohrs<br />
unmittelbar vor dem Haus der Klägerin<br />
(aber immer noch im Bereich der<br />
öffentlichen Wasserleitung), dessen Existenz<br />
der Gemeinde seit 1952 bekannt<br />
war, kam es nach Entnahmepausen zu<br />
einer Bleibelastung des Trinkwassers<br />
im Haus der Klägerin im Umfang von<br />
60 bis 110 Mikrogramm pro Liter 1 . Aus<br />
diesem Grund hatte sich die Klägerin<br />
1 Zum Vergleich: Die WHO meint, dass nur<br />
ein Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter<br />
alle Bevölkerungsgruppen sicher vor Gesundheitsschäden<br />
schützt. Sie geht dabei von<br />
einem ca. 5 kg schweren Säugling aus, der<br />
durchschnittlich pro Tag einen dreiviertel<br />
Liter Wasser trinkt. Dieser Grenzwert liegt<br />
auch der EU-Trinkwasserrichtlinie vom 16.<br />
10. 1997 zugrunde. In Umsetzung dieser<br />
Richtlinie muss Österreich den Grenzwert ab<br />
1. 12. 2003 auf 25 Mikrogramm pro Liter<br />
und ab 1. 12. 2013 auf den WHO-Wert von<br />
10 Mikrogramm pro Liter senken. Gemäß § 3<br />
Abs 1 der Trinkwasserverordnung vom 21. 8.<br />
2001, BGBl II 2001/304, muss Wasser geeignet<br />
sein, ohne Gefährdung der menschlichen<br />
Gesundheit getrunken oder verwendet zu<br />
werden, und den in Anhang I Teil A und B<br />
festgelegten Mindestanforderungen entsprechen.<br />
Teil A Anhang I sieht für Blei ebenfalls<br />
einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro<br />
Liter vor. Aus Anmerkung 4 ergibt sich, dass<br />
dieser Wert spätestens ab 1. 12. 2013 einzuhalten<br />
ist, er bis 1. 12. 2003 50 Mikrogramm<br />
pro Liter und für den Zeitraum 1. 12. 2003<br />
bis 1. 12. 2013 25 Mikrogramm pro Liter<br />
beträgt. Gemäß Anmerkung 3 ist die Probe in<br />
der Weise zu entnehmen, dass sie für die<br />
durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme<br />
repräsentativ ist.
Die meisten Gemeinden legen bereits seit<br />
längerem Augenmerk darauf, bei öffentlichen<br />
Wasserleitungen die Gefahr einer<br />
Bleikontaminierung zu beseitigen. Allerdings<br />
kann auch in anderen Zusammenhang<br />
die Gemeinden eine „bleierne“<br />
Haftung treffen. Nämlich dann,<br />
wenn sie als Vermieter von Wohnbauten<br />
aktiv sind.<br />
dann über die Jahre (erst 1994 wurde<br />
das Bleirohr entfernt) mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
eine Bleivergiftung zugezogen,<br />
wodurch sie von 1969 bis zum<br />
Jahr 2000 98 Tage starke, 1420 Tage<br />
mittelstarke und 106 Tage leichte körperliche<br />
Schmerzen zu erdulden hatte,<br />
mit denen auch eine<br />
psychische Belastung<br />
verbunden war.<br />
Da einerseits nach<br />
den maßgeblichen<br />
Verwaltungsvorschriften<br />
(konkret<br />
dem Kärntner<br />
Gemeindewasserversorgungsgesetz)<br />
eine<br />
Pflicht der Gemeinde<br />
bestanden hatte, die<br />
Gemeindewasserversorgungsanlageentsprechend<br />
den Anforderungen<br />
der<br />
Gesundheit nach<br />
dem jeweiligen<br />
Stand der Technik zu<br />
planen, zu errichten,<br />
zu erhalten und zu<br />
betreiben, und da<br />
andererseits seit 1986 in Österreich im<br />
Allgemeinen bekannt war, dass wegen<br />
der Gefahr gesundheitsschädlicher Konzentrationen<br />
von Blei im Trinkwasser<br />
das Belassen von Bleileitungen nicht<br />
mehr dem Stand der Technik entspricht<br />
(und im Übrigen auch der Wassermeister<br />
der beklagten Gemeinde im Besonderen<br />
Bedenken gegenüber einer weiteren<br />
Belassung des fraglichen Bleirohrs<br />
geäußert hatte), gelangte der<br />
OGH zu einer grundsätzlichen Haftung<br />
der Gemeinde gegenüber der Klägerin<br />
nach dem Amtshaftungsgesetz (AHG).<br />
Der Klägerin wurde es nicht zum Verhängnis,<br />
dass sie ihre Klage erst im<br />
August 1996 eingebracht hatte, da<br />
§ 6 AHG eine zehnjährige Verjährungsfrist<br />
vorsieht und diese gewahrt wurde.<br />
Nicht thematisiert wurde vom OGH ob<br />
es der Klägerin als ein Ersatz minderndes<br />
Mitverschulden angelastet werden<br />
kann, dass sie es unterlassen hat, die<br />
Bleibelastung des Trinkwassers nach<br />
den Entnahmepausen durch ein Abrinnenlassen<br />
des so genannten „Stagnationswassers“<br />
zu reduzieren.<br />
Haftung der Gemeinde<br />
als Vermieterin<br />
Mag es nun auch so sein, dass der<br />
Sachverhalt der Entscheidung insofern<br />
atypisch ist, als die meisten Gemeinden<br />
bereits seit längerem Augenmerk darauf<br />
legen, bei öffentlichen Wasserlei-<br />
Recht & Verwaltung<br />
tungen die Gefahr einer Bleikontaminierung<br />
zu beseitigen, so sollte nicht<br />
übersehen werden, dass Gemeinden<br />
auch in anderem Kontext eine „bleierne“<br />
Haftung treffen kann:<br />
Viele Gemeinden sind auch im Bereich<br />
des kommunalen Wohnbaus als Vermieter<br />
aktiv, und<br />
es erscheint keineswegsausgeschlossen,<br />
dass<br />
Viele Gemeinden sind<br />
im Bereich des kommunalen<br />
Wohnbaus als Vermieter<br />
aktiv, und es erscheint keineswegs<br />
ausgeschlossen,<br />
dass zumindest manche<br />
dieser Baulichkeiten zu<br />
einer Zeit errichtet wurden,<br />
als die Verwendung von<br />
Bleirohren beim Wohnbau<br />
noch gang und gäbe war.<br />
zumindest manche<br />
dieser Baulichkeiten<br />
zu einer Zeit<br />
errichtet wurden,<br />
als die Verwendung<br />
von Bleirohren<br />
beim Wohnbau<br />
noch gang<br />
und gäbe war 2 .<br />
Diesbezüglich war<br />
dann bereits in der<br />
Vergangenheit zu<br />
berücksichtigen,<br />
dass im Anwendungsbereich<br />
des<br />
Mietrechtsgesetzes<br />
(MRG) die allgemeinen<br />
Teile der<br />
Liegenschaft (vor allem die Steigleitungen<br />
und die Zuleitungen zu mehreren<br />
Objekten) vom Vermieter stets in zeitgemäßem<br />
und nicht gesundheitsgefährdendem<br />
Zustand zu erhalten waren.<br />
Ungeachtet des Nichtbestehens einer<br />
Erhaltungspflicht des Vermieters die<br />
Wasserleitungen der einzelnen Mietobjekte<br />
betreffend konnte im Einzelfall<br />
immer noch argumentiert werden, dass<br />
den Vermieter, der über die Existenz<br />
von Bleirohren in seinen Gebäuden in<br />
Kenntnis war (oder zumindest in<br />
Kenntnis sein musste), gegenüber seinen<br />
Mietern zumindest eine diesbezügliche<br />
Warnpflicht getroffen hat. Die<br />
Mieter konnten dann versuchen durch<br />
Ablaufen des Stagnationswassers die<br />
Bleibelastung zu reduzieren. Wenn dies<br />
nicht möglich war konnten sie zur Vermeidung<br />
von Gesundheitsschäden ihre<br />
Trinkwasserversorgung ganz generell<br />
„auslagern“.<br />
Auch Altverträge betroffen<br />
Vor allem sollte von einer vermietenden<br />
Gemeinde bedacht werden, dass vom<br />
Gesetzgeber im Rahmen der WRN<br />
2 Nach einer Studie beträgt etwa der Anteil<br />
an Hauswasserleitungen aus Blei in Wien bei<br />
vor 1914 errichteten Häusern rund 40 Prozent,<br />
bei Häusern aus der Zeit von 1914 bis<br />
1945 immerhin noch rund 3,5 Prozent. Erst<br />
seit 1960 wurden bei der Errichtung von<br />
Häusern Bleileitungen nicht mehr verwendet.<br />
KOMMUNAL 29
Recht & Verwaltung<br />
2006 ganz bewusst die Erhaltungspflichten<br />
des Vermieters im Vollanwendungsbereich<br />
des MRG um die<br />
Beseitigung von vom Mietgegenstand<br />
ausgehenden erheblichen<br />
Gesundheitsgefahren erweitert<br />
wurden und dass der diesbezügliche<br />
Fokus des Gesetzgebers besonders<br />
auf der Bleirohr-Problematik<br />
lag.<br />
Im Detail sei noch Folgendes hervorgehoben:<br />
Die neu geschaffene<br />
Erhaltungspflicht erfasst, wiewohl<br />
im Gesetzwerdungsprozess durchaus<br />
auch noch gegensätzlich diskutiert,<br />
auch „Altverträge“, das heißt<br />
Ein Tipp für die Gemeinden: Um die mit einem Austausch der problematischen Rohre<br />
verbundenen erheblichen Kosten zu vermeiden, ist die Immobilienpraxis vielfach dazu<br />
übergegangen, die vorhandenen Bleirohre bloß innenseitig mit einem Granulatbelag<br />
auszukleiden<br />
solche Verträge, die vor dem Inkrafttreten<br />
der WRN 2006 am 1. 10. 2006<br />
abgeschlossen wurden. Dementsprechend<br />
wäre es nicht ausreichend, wenn<br />
sich eine Gemeinde dem Problem „Blei<br />
im Trinkwasser“ erst anlässlich der<br />
Neuvergabe eines Objekts zuwendet.<br />
Abzuraten ist einer Gemeinde auch von<br />
Abzuraten ist einer Gemeinde auch von einem<br />
Zuwarten mit der Aufarbeitung der Bleirohr-Problematik<br />
in ihren Miethäusern, bis die Mieter von sich<br />
aus die Bleikontamination ihres Trinkwassers an<br />
die Gemeinde herantragen und als Mängel rügen.<br />
einem Zuwarten mit der Aufarbeitung<br />
der Bleirohr-Problematik in ihren Miethäusern,<br />
bis die Mieter von sich aus die<br />
Bleikontamination ihres Trinkwassers<br />
an die Gemeinde herantragen und als<br />
Mängel rügen. Denn die herrschende<br />
Ansicht zu der durch die WRN 2006<br />
geschaffene Rechtslage die Erhaltungs-<br />
30 KOMMUNAL<br />
pflichten des Vermieters betreffend<br />
dürfte dahin gehen, dass jedenfalls seit<br />
dem 1. 10. 2006 eine entsprechende<br />
Nachforschungspflicht des Vermieters<br />
besteht. Der Vermieter ist – nicht<br />
zuletzt auch zur Vermeidung strafrechtlicher<br />
Konsequenzen! – angehalten,<br />
sich im zumutbaren Umfang über den<br />
Zustand der von ihm in<br />
Bestand gegebenen<br />
Objekte zu informieren<br />
und dann gegebenenfalls<br />
auch für eine<br />
Beseitigung der<br />
Gesundheitsgefahr zu<br />
sorgen.<br />
In haftungsrechtlicher<br />
Sicht zu relativieren ist<br />
weiters die vom<br />
Gesetzgeber der WRN<br />
2006 verfügte Beschränkung der<br />
Durchsetzbarkeit der Erhaltungspflicht<br />
des Vermieters bei vom Mietobjekt ausgehender<br />
erheblicher Gesundheitsgefahr<br />
dadurch, dass diese Gesundheitsgefahr<br />
nicht durch andere zumutbare<br />
Maßnahmen des Mieters beseitigt werden<br />
kann. Mag auch der Gesetzgeber in<br />
diesem Zusammenhang primär das<br />
Abrinnenlassen des „Stagnationswassers“<br />
vor Augen gehabt haben, so darf<br />
doch nicht übersehen werden, dass<br />
selbst der allfällige Ausschluss einer<br />
Erhaltungspflicht des Vermieters ihn<br />
noch keineswegs automatisch von der<br />
Pflicht entbindet, sich zumindest über<br />
den gesundheitsgefährdenden Zustand<br />
der von ihm in Bestand gegebenen<br />
Objekte in Kenntnis zu setzen (und<br />
dann die Mieter gegebenenfalls auch<br />
mit entsprechenden Informationen zu<br />
versorgen).<br />
Für den Fall, dass eine Gemeinde nun<br />
in der Tat auch in ihrer Rolle als Vermieterin<br />
mit dem Problem „Blei im<br />
Wasser“ konfrontiert sein sollte, sei<br />
abschließend noch folgender praktischer<br />
Hinweis gestattet: Um die mit<br />
einem Austausch der problematischen<br />
Rohre verbundenen erheblichen Kosten<br />
zu vermeiden, ist die Immobilienpraxis<br />
vielfach dazu übergegangen, die vorhandenen<br />
Bleirohre bloß innenseitig<br />
mit einem Granulatbelag auszukleiden.<br />
Dabei wäre jedenfalls darauf zu achten,<br />
dass dieser Granulatbelag nicht etwa<br />
Weichmacher (Phthalate) in gesundheitsgefährdendem<br />
Ausmaß enthält.<br />
Denn sonst bisse sich ja die sprichwörtliche<br />
Katze in den Schwanz.<br />
Fact-Box: RFG<br />
„Haftungsfalle<br />
Bleirohre“<br />
Mehr zum Thema „Haftungsfalle<br />
Bleirohre“ finden Sie im Heft<br />
2/2007 der RFG.<br />
Recht & Finanzen für Gemeinden<br />
(RFG) ist eine Kooperation zwischen<br />
dem Österreichischer<br />
Gemeindebund, Kommunalkredit,<br />
kommunalconsult, Leitner + Leitner,<br />
RPW NÖ GBG und dem Verlag<br />
MANZ.<br />
Abopreis:<br />
Jahresabonnement (vier Ausgaben)<br />
2007 für Mitglieder des Österreichischen<br />
Gemeindebundes € 95,– inkl.<br />
Versand (anstelle € 115,–).<br />
Einzelheft € 34,50.<br />
MANZ Bestellservice:<br />
Tel: 01/531 61-100<br />
Fax: 01/531 61-455<br />
E-Mail: bestellen@manz.at<br />
Das aktuelle Inhaltsverzeichnis finden<br />
Sie unter www.manz.at/rfg.
20 Millionen Euro Schaden durch Sachbeschädigungen<br />
Umfrage<br />
Gemeinden kämpfen<br />
gegen Vandalismus<br />
Vandalismus ist zunehmend ein Problem in österreichischen Gemeinden: Jährlich dürften<br />
die Kosten zur Schadensbehebung bei zerstörten Telefonzellen, beschmierten Hauswänden<br />
oder beschädigten Haltestellen mit 20 Millionen Euro zu Buche schlagen.<br />
Rund zwei Drittel der Kommunen wurden<br />
von Attacken durch Vandalen<br />
betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt<br />
eine aktuelle Online-Umfrage der Plattform<br />
Kommunalnet.at, an der sich 197<br />
Gemeinden beteiligten.<br />
Fast 60 Prozent der Gemeinden<br />
bezeichnen Vandalismus als aktuelles<br />
Thema. 58 Prozent dieser Gruppe<br />
sahen sich nicht ausreichend vor vandalistischen<br />
Übergriffen geschützt.<br />
Gleich 73 Prozent gaben an, dass ihrer<br />
Meinung nach Videoüberwachung das<br />
Sicherheitsempfinden in der Gemeinde<br />
heben würde. Etwas mehr als die<br />
Hälfte der befragten Orte hielt den Einsatz<br />
von privaten Sicherheitsdienstlei-<br />
Hilfe durch private Sicherheitsfirmen<br />
Immer mehr Gemeinden nehmen die<br />
Sicherheit selbst in die Hand. In der<br />
niederösterreichischen Gemeinde<br />
Wolkersdorf hat man sich entschlossen,<br />
eine private Sicherheitsfirma zu<br />
engagieren. Bürgermeister Norbert<br />
Heurteur: „Wir haben vor allem für<br />
die Wochenenden, an denen vermehrt<br />
Feste und andere Veranstaltungen<br />
stattfinden, einen Sicherheitsdienst<br />
beauftragt. Es geht darum, präventiv<br />
stern für ein geeignetes Mittel zur<br />
Gewährleistung von Ruhe und Ordnung.<br />
„Ziel der Zerstörer sind nicht nur<br />
Straßenbeleuchtungen, Parkanlagen,<br />
Verkehrszeichen und diverse Hinweisschilder,<br />
sondern auch Kinderspielplätze<br />
und Friedhöfe“, sagt Gemeindebundpräsident<br />
Helmut Mödlhammer.<br />
Große Schäden würden auch durch<br />
Spray- und Schmieraktionen an kommunalen<br />
Gebäuden verursacht.<br />
Gerade in mittleren Gemeinden mit<br />
einer Einwohnerzahl zwischen 1000<br />
und 4000 gehörten beschädigte Haltestellen,<br />
beschmierte Hauswände oder<br />
zerstörte Telefonzellen mittlerweile<br />
tätig zu sein. In den Parkanlagen und<br />
im Umkreis der Feste muss darauf<br />
geschaut werden, dass betrunkene<br />
Besucher keine Vandalenakte setzen“.<br />
Allerdings betont man in Wolkersdorf,<br />
dass man keine „Hilfspolizei“ will.<br />
„Die Sicherheitskräfte sollen die Polizei<br />
nicht ersetzen, sondern bei strafbaren<br />
Handlungen sofort die Exekutive<br />
verständigen“, stellt Bürgermeister<br />
Heurteur fest.<br />
Fast 60 Prozent der<br />
befragten Gemeinden<br />
bezeichnen Vandalismus<br />
als aktuelles<br />
Thema. Oft sähe<br />
man sich bereits<br />
gezwungen, die<br />
Überwachung mit<br />
privaten Kontrolldienstendurchzuführen,<br />
was allerdings<br />
eine enorme<br />
Belastung in finanzieller<br />
Hinsicht bedeute<br />
zum Ortsbild. Oft sähe man sich bereits<br />
gezwungen, die Überwachung mit privaten<br />
Kontrolldiensten durchzuführen,<br />
was allerdings eine enorme Belastung<br />
in finanzieller Hinsicht bedeute. Generell<br />
müsse es Aufgabe der Polizei sein,<br />
die Sicherheit<br />
zu<br />
gewährlei-<br />
sten, so<br />
Mödlhammer.<br />
Ein wichtiges<br />
Anliegen sei<br />
die Information<br />
der Bürger<br />
über die<br />
Folgen von<br />
Vandalismus.<br />
Viele Jugendliche<br />
bzw.<br />
deren Eltern seien sich nicht über die<br />
rechtlichen Auswirkungen bei Beschädigung<br />
öffentlichen Eigentums<br />
bewusst. Eine „besoffene Geschichte“<br />
oder eine vermeintliche „Gaudi“ würden<br />
häufig vor dem Richter mit einer<br />
Verurteilung enden, betont der<br />
Gemeindebundpräsident.<br />
Gerade in mittleren<br />
Gemeinden gehörten<br />
beschädigte Haltestellen,<br />
beschmierte Hauswände<br />
oder zerstörte<br />
Telefonzellen mittlerweile<br />
zum Ortsbild.<br />
KOMMUNAL 31
Europa<br />
Im Mai 2007 feierte der<br />
Kongress der Gemeinden<br />
und Regionen und mit ihm<br />
der Europarat den 50. Jahrestag<br />
„Local and regional<br />
Democracy“<br />
Der Europarat – eine Organisation im Dienst der Bürger<br />
Gemeinsame Werte<br />
sichern den Frieden<br />
Europas Wandel von den machtbewussten Nationalstaaten, wo der Soldat und der<br />
Diplomat eine Einheit bildeten, ist heute fast abgeschlossen. Bei fast allen Ländern<br />
nimmt das Wohlfahrtsdenken einen bedeutenden Platz ein. Der Europarat mit Sitz in<br />
Strassburg ist eine jener Organisationen, die diese „neue (Außen-)politik“ in besonderer<br />
Weise pflegen.<br />
◆Dr. Wendelin Ettmayer<br />
Betrachtet man die internationalen<br />
Beziehungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts,<br />
so sieht man eine geteilte<br />
Welt: während ein Teil der Staaten eine<br />
traditionelle Außenpolitik auf der Basis<br />
von Realpolitik und Machtpolitik ver-<br />
◆ Dr. Wendelin Ettmayer ist<br />
Österreichischer Botschafter beim<br />
Europarat in Strassburg<br />
32 KOMMUNAL<br />
folgt, wurde für andere die Förderung<br />
der persönlichen Wohlfahrt ihrer Bürger<br />
die Legitimation des außenpolitischen<br />
Handelns. Jahrhunderte lang war<br />
Außenpolitik Machtpolitik. Ziel war die<br />
Erhaltung der Souveränität und der<br />
Macht des Staates. „Groß“ in der<br />
Geschichte war, wer eroberte und seine<br />
Macht vergrößerte. Mittel dazu waren<br />
Realpolitik und Krieg. Der Soldat und<br />
der Diplomat bildeten eine Einheit.<br />
Demgegenüber nimmt heute bei vielen<br />
Ländern auch das Wohlfahrtsdenken<br />
einen bedeutenden Platz bei der Gestaltung<br />
der internationalen Beziehungen<br />
ein. Ihre Ziele der Außenpolitik stehen<br />
im Dienst der Menschen: der Kampf<br />
gegen Armut, Hunger und Aids; die Entwicklung<br />
der Weltbevölkerung genauso<br />
wie die Welternährung; Entwicklungshilfe<br />
und Umweltschutz; Menschenrechte,<br />
Frauenemanzipation und das<br />
Wohl der Kinder. Zu jenen Organisationen,<br />
die diese „Neue Außenpolitik“ in<br />
besonderer Weise pflegen, gehört der<br />
Europarat mit Sitz in Strassburg.<br />
Friedensordnung war<br />
seit Gründung das Ziel<br />
Der 1949 gegründete Europarat hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, auf unserem Kontinent<br />
eine Friedensordnung durch gemeinsame<br />
Werte zu schaffen. In diesem Sinne<br />
geht es dem Europarat um die Verwirklichung<br />
der Menschenrechte, um den Ausbau<br />
der Demokratie und um die Verankerung<br />
der Rechtsstaatlichkeit in seinen<br />
Mitgliedsländern.<br />
Der Europarat brachte damit eine neue<br />
Dimension in die internationalen Beziehungen.<br />
Waren diese früher darauf ausgerichtet,<br />
die Macht des eigenen Landes<br />
Copyright: Council of Europe/Sandro Weltin
zu stärken, so ist es Ziel des Europarates,<br />
die persönliche Wohlfahrt der Bürger<br />
durch die Verwirklichung der gemeinsamen<br />
Werte zu fördern. Es ist daher wohl<br />
nicht übertrieben festzustellen, dass dem<br />
Europarat die Verwirklichung von zwei<br />
Revolutionen im Bereich der internationalen<br />
Beziehungen gelungen ist: war<br />
früher die Souveränität der Staaten das<br />
bestimmende Element, so hat im Rahmen<br />
des Europarates der einzelne Bürger<br />
über den nationalen Rahmen hinaus die<br />
Möglichkeit, seine Rechte durchzusetzen.<br />
Vorrechte, die die längste Zeit den Staaten<br />
vorbehalten waren, wurden durch<br />
den Europarat Rechte des Einzelnen. In<br />
diesem Sinne kann jeder Bürger eines<br />
Mitgliedslandes sein Recht beim Europäischen<br />
Gerichtshof für Menschenrechte<br />
durchsetzen. Damit sind, und das ist eine<br />
weitere Revolution, wesentliche Bereiche,<br />
wie Menschenrechte oder Minderheitenschutz,<br />
nicht mehr innere Angelegenheit<br />
eines Staates, sie wurden vielmehr<br />
in die Kompetenz der Staatengemeinschaft<br />
übertragen.<br />
Die 47 Mit-<br />
glieder des<br />
Europarates<br />
müssen<br />
sich in diesem<br />
Sinne<br />
der<br />
gemeinsamenKontrolleunterwerfen.<br />
In diesem<br />
Sinne geht es dem Europarat natürlich<br />
auch um die Förderung des Bewusstseins<br />
der gemeinsamen kulturellen Identität<br />
auf unserem Kontinent in ihrer gesamten<br />
Vielfalt sowie um die Intensivierung der<br />
Zusammenarbeit in diesem Bereich. Der<br />
Europarat ist bemüht, Lösungen für die<br />
gesellschaftlichen Probleme der Menschen<br />
zu finden. So tritt er gegen die Diskriminierung<br />
von Minderheiten auf,<br />
gegen den Fremdenhass, gegen Intoleranz,<br />
gegen die Umweltverschmutzung,<br />
gegen die weitere Verbreitung von AIDS,<br />
gegen den Drogenhandel, gegen den Terrorismus<br />
und gegen das organisierte Verbrechen.<br />
In einigen dieser Bereiche wurden<br />
im Rahmen des Europarates Konventionen<br />
ausgearbeitet, die in den einzelnen<br />
Mitgliedsländern Rechtsverbindlichkeit<br />
erlangt haben. Durch die Förderung<br />
von politischen und<br />
verfassungsrechtlichen Reformen will der<br />
Europarat die Demokratie in seinen Mitgliedsländern<br />
stärken.<br />
Es geht dem Europarat<br />
um die Verwirklichung der<br />
Menschenrechte, um den<br />
Ausbau der Demokratie<br />
und um die Verankerung<br />
der Rechtsstaatlichkeit in<br />
seinen Mitgliedsländern.<br />
➢➢weiter auf Seite 34<br />
Mit Europa<br />
auf du und du<br />
Beim Europäischen Rat Ende Juni 2007<br />
konnten sich die Staats- und Regierungschefs<br />
auf ein Verhandlungsmandat für<br />
eine Regierungskonferenz zur Änderung<br />
der bestehenden Verträge einigen.<br />
Was die Form betrifft, so wird es keinen<br />
Verfassungsvertrag mehr geben, sondern<br />
einen Reformvertrag, der eine einheitliche<br />
Rechtsgrundlage der Union mit zwei Verträgen<br />
schafft: Ein geänderter Vertrag<br />
über die Europäische Union (VEU) – er<br />
wird im Wesentlichen Bestimmungen<br />
über die Grundsätze und Organe, verstärkte<br />
Zusammenarbeit, Gemeinsame<br />
Außen- und Sicherheitspolitik enthalten –<br />
und ein Vertrag über die Arbeitsweise der<br />
Union, der eine überarbeitete Fassung des<br />
Vertrages über die Gründung der Europäischen<br />
Gemeinschaft sein wird.<br />
Obwohl es zu einer gravierenden Änderung<br />
der Form gekommen ist, bleiben<br />
doch ca. 95 Prozent der Substanz des Verfassungsvertrages<br />
erhalten.<br />
◆ Symbole:<br />
Verzicht auf die Nennung von Flagge und<br />
Hymne als Symbole der EU.<br />
◆ Mehrheitsentscheidungen:<br />
Der Anwendungsbereich der qualifizierten<br />
Mehrheit und der Mitentscheidung<br />
des europäischen Parlaments wurde deutlich<br />
ausgeweitet. Durch die Festlegung<br />
des Mitentscheidungsverfahrens als<br />
Regelverfahren wird das Europäische Parlament<br />
zum gleichberechtigten Gesetzgeber<br />
neben dem Rat.<br />
◆ Doppelte Mehrheit<br />
Das Prinzip der doppelten Mehrheit wird<br />
erst ab 2014 in Kraft treten. Eine Mehrheit<br />
ist erreicht, wenn 55 Prozent der<br />
Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung<br />
vereinen, zustimmen.<br />
◆ Rechte für nationale Parlamente<br />
Nationale Parlamente können künftig<br />
innerhalb von acht Wochen gegen beabsichtigte<br />
Rechtsakte der EU Einspruch<br />
erheben, falls sie meinen, nationale<br />
Zuständigkeiten seien verletzt. Die EU-<br />
Europa<br />
Substanz des Verfassungsvertrages blieb erhalten<br />
Vom Verfassungs- zum<br />
Reformvertrag<br />
Kommission muss ihre Gesetzesvorschläge<br />
dann überprüfen und stichhaltig<br />
begründen, wenn das mehr als die Hälfte<br />
der nationalen Parlamente verlangen.<br />
◆ Amt des Hohen Repräsentanten der<br />
Union für Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Die Bezeichnung EU-Außenminister<br />
wurde aufgegeben. Der EU-Außenminister<br />
darf nicht so heißen, ist aber Vorsitzender<br />
des EU-Außenministerrates und<br />
leitet den Europäischen auswärtigen<br />
Dienst, der aufgebaut werden soll.<br />
◆ Kleinere Kommission<br />
Ab 2014 sinkt die Zahl der EU-Kommissare<br />
auf zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten.<br />
Bei 27 Mitgliedstaaten wären das 18<br />
Kommissare. Ein Rotationsprinzip, das<br />
noch ausgehandelt wird, soll sicherstellen,<br />
dass im Laufe der Zeit alle Staaten<br />
gleiche Chancen haben, ein Kommissionsmitglied<br />
zu stellen.<br />
◆ EU-Präsident<br />
Der Europäische Rat erhält einen Vorsitzenden,<br />
der zweieinhalb Jahre im Amt<br />
bleibt.<br />
◆ Grundrechtscharta<br />
Die im Jahre 2000 beschlossene Grundrechtscharta<br />
wird rechtsverbindlich. Sie<br />
taucht im Vertragsentwurf aber nicht<br />
mehr als Text auf, sondern nur in einem<br />
Verweis.<br />
◆ Austritt<br />
Der Vertrag räumt EU-Mitgliedern erstmals<br />
die Möglichkeit ein, freiwillig aus<br />
dem Bündnis auszutreten.<br />
DI Karl Georg Doutlik<br />
Leiter der Vertretung der<br />
Europäischen Kommission<br />
in Österreich<br />
(Siehe auch die „erste Analyse der Reform<br />
des Verfassungsvertrag“ aus kommunaler<br />
Sicht auf der Folgeseite)<br />
KOMMUNAL 33
Europa<br />
Besondere Rolle des KGRE<br />
Eine besondere Rolle im Rahmen des<br />
Europarates spielt der KGRE, der „Kongress<br />
der Gemeinden und Regionen“.<br />
Seit seinen Anfängen hat der Europarat<br />
der Demokratie auf Gemeinde- bzw.<br />
Länderebene einen besonderen Stellenwert<br />
eingeräumt. Der Grundgedanke<br />
dabei ist, dass die Freiheit gerade durch<br />
starke Kommunen und eine aktive<br />
Nachbarschaftspolitik gewährleistet<br />
wird. Nach den Vorstellungen des Europarates<br />
hat die kommunale Selbstverwaltung<br />
die Bedürfnisse aller Europäer<br />
zu berücksichtigen,<br />
ob in<br />
Stadt oder<br />
Land, ob in<br />
zentralen<br />
Regionen oder<br />
Grenzgebieten.<br />
In diesem<br />
Sinne ist der<br />
Kongress die<br />
„Stimme der<br />
Gemeinden<br />
und Regionen<br />
Europas“ und<br />
bietet den<br />
gewählten Vertretern<br />
eine<br />
Plattform, um<br />
Erfahrungen<br />
auszutauschen<br />
und Probleme<br />
zu lösen.<br />
Insgesamt<br />
kann man wohl sagen, dass es dem<br />
Europarat gelungen ist, im Bereich der<br />
Menschenrechte, der Minderheiten, im<br />
sozialen Bereich, und hinsichtlich des<br />
kulturellen Erbes ein System einerseits<br />
zum Schutz der Bürger aufzubauen,<br />
wobei auch die Möglichkeit geschaffen<br />
wurde, diesen aktiv dabei einzubinden.<br />
Die Liste von Errungenschaften des<br />
Europarats auf dem Gebiete der Rechtsstaatlichkeit<br />
zum Wohle des einzelnen<br />
Bürgers ließe sich noch um zahllose<br />
Punkte ergänzen. Weitere Bereiche wie<br />
Fragen des Schutzes persönlicher<br />
Daten, Regeln über die Errichtung und<br />
den Betrieb von Gefängnissen, Fragen<br />
der Bioethik wie auch die Einhaltung<br />
der Menschenrechte bei der Bekämpfung<br />
des Terrorismus werden vom Europarat<br />
abgedeckt. All die angeführten<br />
Aktivitäten und Konventionen sind<br />
schlagender Beweis dafür, dass sich das<br />
Hauptaugenmerk des Systems der internationalen<br />
Zusammenarbeit der Staaten<br />
in den letzten Jahrzehnten immer stärker<br />
auf die Rechte des Einzelnen hin<br />
ausgerichtet hat.<br />
Nach den<br />
Vorstellungen des<br />
Europarates hat die<br />
kommunale Selbstverwaltung<br />
die<br />
Bedürfnisse aller<br />
Europäer zu berücksichtigen,<br />
ob in<br />
Stadt oder Land, ob<br />
in zentralen<br />
Regionen oder<br />
Grenzgebieten.<br />
34 KOMMUNAL<br />
Analyse des Reformvertragsentwurfs<br />
Wichtigste<br />
Forderungen<br />
umgesetzt<br />
Einer erste kommunalen Analyse des Vertragsentwurfes, die<br />
von den Partnerverbänden Deutscher Städte- und Gemeindebund<br />
(DStGB) und vom Österreichischen Gemeindebund<br />
in Brüssel erstellt wurde, kommt zu einem positiven Ende.<br />
KOMMUNAL präsentiert die wichtigsten Punkte.<br />
◆ Uwe Zimmermann & Daniela Fraiss<br />
◆ Achtung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts<br />
Nach dem vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 2<br />
soll eine ausdrückliche Anerkennung des<br />
kommunalen Selbstverwaltungsrechtes<br />
erfolgen. Der Europäische Reformvertrag<br />
wäre damit das erste Rechtsdokument<br />
der EU, das zur Wahrung des kommunalen<br />
Selbstverwaltungsrechtes beiträgt.<br />
◆ Subsidiaritätskontrolle<br />
Nach dem vorgeschlagenen Art. 5 Abs. 3<br />
des Europäischen Reformvertrages soll<br />
die Subsidiaritätskontrolle<br />
ausdrücklich auf<br />
die lokale Ebene ausgedehnt<br />
werden. Dies<br />
bedeutet, dass die EU<br />
nur noch dann handeln<br />
soll, wenn das zu<br />
erreichende Ziel nicht<br />
besser auf der nationalen,<br />
regionalen<br />
oder der kommunalen<br />
Ebene erreicht und<br />
verwirklicht werden<br />
kann. Dies ist<br />
Bestandteil der verbessertenEU-Subsidiaritätskontrolle.<br />
Nicht zuletzt wird den<br />
nationalen Parlamenten (in Österreich<br />
dem Nationalrat und dem Bundesrat)<br />
eine erweiterte Mitwirkung bei der EU-<br />
Subsidiaritätskontrolle zukommen. Diese<br />
Rolle wird im Übrigen in einem Vertrags-<br />
Der Europäische<br />
Reformvertrag wäre<br />
damit das erste Rechtsdokument<br />
der EU, das<br />
zur Wahrung des kommunalenSelbstverwaltungsrechtes<br />
beiträgt.<br />
protokoll zur Rolle der nationalen Parlamente<br />
weiter ausgeführt.<br />
Zudem soll die EU verpflichtet werden,<br />
bei Gesetzesentscheidungen die Kostenfolgen<br />
für die Kommunen, die Wirtschaft<br />
und den Bürger vorher abzuschätzen<br />
und zu minimieren.<br />
◆ Anhörungsrecht in Brüssel<br />
In dem vorgeschlagenen Art. 8b zur partizipativen<br />
Demokratie in der EU ist vorgesehen,<br />
ein Mitwirkungsrecht<br />
(Anhörung) der repräsentativen Verbände<br />
bei allen Aktivitäten<br />
der Europäischen<br />
Union abzusichern. Die<br />
EU-Institutionen werden<br />
verpflichtet, einen offenen,<br />
transparenten und<br />
regelmäßigen Dialog mit<br />
den repräsentativen Verbänden<br />
und mit der Zivilgesellschaft<br />
zu führen.<br />
Dies ist aus kommunaler<br />
Sicht zu begrüßen, denn<br />
eine partizipative Einbindung<br />
der repräsentativen<br />
kommunalen Spitzenverbände<br />
in Europa wird<br />
sich damit auch auf eine Vertragsgrundlage<br />
berufen können.<br />
◆ Ausschuss der Regionen<br />
Betreffend den Ausschuss der regionalen<br />
und lokalen Gebietskörperschaften der
Art. 158 sieht vor, dass insbesondere den ländlichen Gebieten in der Europäischen<br />
Union besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.<br />
Europäischen Union (Ausschuss der<br />
Regionen, AdR) ist vor allem hervorzuheben,<br />
dass nach dem vorgeschlagenen<br />
Protokoll über die Prinzipien der Subsidiarität<br />
und der Verhältnismäßigkeit der<br />
Ausschuss der Regionen ein eigenes Klagerecht<br />
erhalten soll, um vor dem<br />
Europäischen Gerichtshof im Namen der<br />
Kommunen und Regionen Verstöße<br />
gegen die Prinzipien der Subsidiarität<br />
und der Verhältnismäßigkeit geltend<br />
machen zu können. Hierdurch soll nicht<br />
zuletzt den sozialen, demographischen<br />
und wirtschaftlichen Entwicklungen in<br />
der EU auch in der Zusammensetzung<br />
des AdR-Plenums Rechnung getragen<br />
werden. Zudem dürfte sich hieraus eine<br />
Debatte darüber ergeben, ob die Größe<br />
verschiedener nationaler Delegationen<br />
nicht angepasst werden müsste. Denkbar<br />
wäre auch eine Diskussion über die<br />
innere Zusammensetzung der nationalen<br />
Delegationen, da es derzeit, im Gegensatz<br />
zum Europarat, keine Regelung über<br />
die innere Mandatsverteilung zwischen<br />
regionalen und kommunalen Vertretern<br />
gibt. Dies führt dazu, dass die kommunale<br />
Ebene in manchen nationalen Delegationen<br />
unterrepräsentiert ist.<br />
◆ Daseinsvorsorge<br />
Zum Thema Daseinsvorsorge ist ein<br />
neuer Art. 14 des Europäischen Reformvertrages<br />
vorgesehen, der im Wesentlichen<br />
den Art. III – 122 des EU-Verfassungsvertragentwurfes<br />
übernimmt. In<br />
dieser Bestimmung ist, unter Bezugnahme<br />
auf das Prinzip der Subsidiarität,<br />
eine neue EU-Gesetzgebungskompetenz<br />
vorgesehen, um die Prinzipien und<br />
Bedingungen der Organisation, Erbringung<br />
und Finanzierung der Dienste der<br />
Daseinsvorsorge zu regeln. Weiterhin ist<br />
ein Vertragsprotokoll zur Daseinsvorsorge<br />
vorgesehen, in dem die nationale,<br />
regionale und nicht zuletzt kommunale<br />
Hoheit bei der Daseinsvorsorge betont<br />
und unterstrichen wird. Dennoch soll<br />
eine neue EU-Gesetzgebungsbefugnis in<br />
diesem Bereich eingeführt werden. Mit<br />
dem DStGB verabschiedete der Gemeindebund<br />
am gemeinsamen Europatag in<br />
Luxemburg 2006 jedoch eine Erklärung,<br />
wonach eine EU-Gesetzgebungskompetenz<br />
für Dienste von allgemeinem Interesse<br />
abgelehnt wird. Der DStGB behält<br />
diesen Standpunkt weiter bei, andere<br />
kommunale Spitzenverbände (z.B. auch<br />
der Österreichische Städtebund) sind<br />
jedoch der Auffassung, dass eine Rahmenrichtlinie<br />
zu Dienstleistungen von<br />
allgemeinem Interesse für Rechtssicherheit<br />
sorgen und die Position der Kommunen<br />
stärken könnte. Die Gretchenfrage<br />
bleibt die nach dem Inhalt dieser allfälligen<br />
Rahmenrichtlinie. Da er sowohl positiv<br />
als auch negativ für die Kommunen<br />
ausfallen<br />
kann, gibt es<br />
auch inner-<br />
halb des<br />
RGRE keine<br />
einheitliche<br />
Linie. Die Kritiker<br />
einer<br />
Gesetzgebungskompetenz<br />
führen<br />
insbesondere<br />
die Entwicklungen der letzten Jahre an,<br />
welche eher in Richtung Stärkung des<br />
Binnenmarkts gingen als zur Verteidigung<br />
kommunaler Rechte beitrugen.<br />
◆ Ländlicher Raum<br />
Bezüglich der ländlichen Räume wird ein<br />
modifizierter Art. 158 vorgeschlagen.<br />
Dieser sieht vor, dass insbesondere den<br />
Europa<br />
ländlichen Gebieten in der Europäischen<br />
Union besondere Aufmerksamkeit<br />
geschenkt werden muss. Gleiches gilt im<br />
Übrigen für Regionen, die einem industriellen<br />
Strukturwandel, geographischen<br />
Benachteiligungen oder demographischen<br />
Wandlungsprozessen unterliegen<br />
oder in sich in Randlagen befinden.<br />
◆ Tourismus<br />
Art. 6 des Reformvertrags übernimmt die<br />
bereits im Verfassungsvertrag enthaltene<br />
Koordinierungskompetenz der Union für<br />
den Tourismus. D.h. Maßnahmen der<br />
Mitgliedstaaten mit europäischer Zielsetzung,<br />
wie die Koordinierung der Ferienzeiten,<br />
könnten durch die Union unterstützt<br />
oder koordiniert werden.<br />
Resümee<br />
Zusammenfassend kann damit festgehalten<br />
werden, dass in dem vorgelegten<br />
Entwurf eines Europäischen Reformvertrages<br />
alle wichtigen Forderungen und<br />
Erwartungen umgesetzt sind, die der<br />
Deutsche Städte- und Gemeindebund<br />
und der Österreichische Gemeindebund<br />
an die institutionelle Reform der EU for-<br />
Hervorzuheben sind auch die Erweiterung der<br />
Subsidiaritätskontrolle und die Stärkung des Ausschusses<br />
der Regionen. Für Diskussionsstoff wird die Regelung der<br />
öffentlichen Daseinsvorsorge sorgen, da diese Frage auch<br />
unter den Mitgliedstaaten umstritten ist.<br />
◆ Uwe Zimmermann ist Referats leiter<br />
Europa/Internationales beim<br />
Deutschen Städte- und Gemeindebund<br />
muliert haben. Hervorzuheben sind vor<br />
allem die Achtung des kommunalen<br />
Selbstverwaltungsrechtes, die Erweiterung<br />
der Subsidiaritätskontrolle und die<br />
Stärkung des Ausschusses der Regionen.<br />
Für Diskussionsstoff wird allerdings die<br />
Regelung der öffentlichen Daseinsvorsorge<br />
sorgen, da diese Frage auch unter<br />
den Mitgliedstaaten umstritten ist.<br />
◆ Mag. Daniela Fraiss ist Leiterin des<br />
Brüsseler Büros des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
KOMMUNAL 35
Europa<br />
Gesucht: Bewerbungen für AdR-Netzwerk zur Subsidiaritätskontrolle<br />
Europa wird in den Kommunen und<br />
Regionen geschaffen<br />
Der Europäische Rat bestätigte es eben<br />
erst wieder: Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit<br />
wer den bei der Reform der<br />
europäischen Institutionen zentrale<br />
Grundsätze sein. Mit Unterstützung<br />
durch den Europäischen Rat bereitet der<br />
Ausschuss der Regionen (AdR) den Weg<br />
für eine konkrete und wirksame Anwendung<br />
dieser Grundsätze der politischen<br />
Governance. Er ruft die Regionen, Städte<br />
und andere interessierte Gebietskörperschaften<br />
dazu auf, sich den 49 Partnern,<br />
die bereits im Netzwerk zur Kontrolle dieser<br />
politischen Grundsätze aktiv sind,<br />
anzuschließen.<br />
In dem Mandat, das der Europäische Rat<br />
auf seiner jüngsten Tagung der Regierungskonferenz<br />
zur Reform der Institutionen<br />
der Europäischen Union erteilt hat,<br />
wird die Bedeutung des Subsidiaritäts -<br />
prinzips deutlich hervorgehoben. In seinen<br />
Schlussfolgerungen entspricht der<br />
Europäische Rat somit einem formellen<br />
Antrag des AdR, nach dessen Auffassung<br />
Anfang Juni 2007 fanden in der Republik<br />
Moldau Kommunalwahlen statt.<br />
Sowohl Stadt-, Bezirks als auch Gemeinderäte<br />
sowie Bürgermeister wurden<br />
gewählt.<br />
Landesweit haben 52,34 Prozent der<br />
Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht<br />
Gebrauch gemacht. In der Hauptstadt-<br />
Chisinau haben das 37,17 Prozent getan,<br />
was ausreicht für die Gültigkeit der<br />
Wahlen. Mitte Juni wurden dass in 474<br />
Ortschaften inklusive Chisinau Stichwahlen<br />
abgehalten.<br />
Bei den Bürgermeisterwahlen in Chisinau<br />
erreichte Iordan Veaceslav (Partei<br />
der Kommunisten der Republik Moldau)<br />
die meisten Stimmen in der ersten<br />
Runde (27,62 Prozent – das ist etwas<br />
mehr als der liberale Kandidat Chirtoaca<br />
Dorin bekam, nämlich 24,37 Prozent).<br />
Die Stichwahlen am 17. Juni konnte<br />
aber der Liberal Dorin mit 61,17 Prozent<br />
der Stimmen eindeutig für sich entscheiden.<br />
Veaceslav erreichte hier nur<br />
38,83 Prozent.<br />
In den Wahlen zum Stadtrat von Chi-<br />
36 KOMMUNAL<br />
das Subsidiaritäts prinzip nur dann die<br />
Demokratie fördern und die Politik verbessern<br />
kann, wenn alle vier Ebenen, d.h.<br />
die europäische, die nationale, die regionale<br />
und die lokale Ebene, eingebunden<br />
werden. Mit dem<br />
Ziel, zu einer besseren<br />
Anwendung des<br />
Subsidiaritätsprinzips<br />
und des Grundsatzes<br />
der Verhältnismäßigkeit<br />
beizutragen,<br />
hatte der AdR in seiner<br />
vom derzeitigen<br />
Ausschusspräsidenten<br />
Michel Delebarre<br />
(F/SPE) erarbeiteten<br />
Stellungnahme „Bessere<br />
Rechtsetzung<br />
2004“ vom Oktober<br />
2005 beschlossen,<br />
ein Netzwerk von lokalen und regionalen<br />
Gebietskörper schaften ins Leben zu<br />
rufen.<br />
Kommunalwahlen in der Republik Moldau<br />
Kommunisten sind stärkste Partei<br />
sinau gingen die drei folgenden Parteien<br />
als die Stärksten hervor und zwar:<br />
◆ Die „Partei der Kommunisten der<br />
Republik Moldau“ mit 26,47 Prozent der<br />
Stimmen, die<br />
◆ „Moldova Noastra (Our Moldova)“-<br />
Allianz mit 12,18 Prozent und die<br />
◆ „Humanistenpartei von Moldau“ mit<br />
3,51 Prozent.<br />
Die landesweiten Wahlergebnisse zeigen,<br />
dass die „Partei der Kommunisten der<br />
Republik Moldau“ in allen Bezirks- und<br />
Gemeinderäten die besten Ergebnisse<br />
erreichte (34,18 Prozent) sowie auch in<br />
den Stadträten (32,71 Prozent), gefolgt<br />
von der „Moldova Noastra“-Allianz<br />
(16,77 Prozent und 17,35 Prozent) und<br />
der „Demokratischen Partei Moldaus“<br />
(9,73 Prozent und 11,11 Prozent).<br />
Der Anteil an Mandaten dieser Parteien<br />
ist noch wesentlich höher aufgrund der<br />
für Kleinparteien bestehenden Sperrklausel<br />
von sechs Prozent.<br />
Weitere Informationen finden Sie auf<br />
www.alegeri.md/en/<br />
Durch das Netzwerk<br />
zur Subsidiaritätskontrolle<br />
werden Städte und<br />
Regionen die Möglichkeit<br />
haben, die Legitimität der<br />
europäischen Politik bei<br />
der Bevölkerung zu<br />
stärken.<br />
Die 49 derzeit registrierten Partner haben<br />
europäische Legislativvorschläge aus den<br />
Bereichen Umwelt und Bildung in ihren<br />
politi schen Instanzen behandelt und ihre<br />
Standpunkte dem AdR sowie den anderen<br />
Partnern des<br />
Netzwerkes übermittelt.<br />
Durch das inzwi-<br />
schen in Betrieb<br />
genommene AdR-<br />
Netzwerk zur Subsidiaritätskontrolle<br />
und<br />
die entsprechende<br />
Webseite können die<br />
politischen Instanzen<br />
der Regionen und<br />
lokalen Gebiets -<br />
körper schaften, die in<br />
70 Prozent der Fälle<br />
für die Umsetzung<br />
der europäischen<br />
Rechtsvorschriften zuständig sind, die<br />
Legislativvorschläge der Europäischen<br />
Kommission direkt erhalten und sich<br />
mehr Gehör zu verschaffen.<br />
Nach den Worten von Michel Delebarre<br />
wird „Europa […] in den Regionen und<br />
Städten geschaffen. Durch das Netzwerk<br />
zur Subsidiaritätskontrolle werden sie die<br />
Möglichkeit haben, Beiträge zur europäischen<br />
Debatte zu leisten und somit die<br />
Legitimität der europäischen Politik bei<br />
der Bevölkerung zu stärken“.<br />
Das Netzwerk bietet insbesondere:<br />
◆ den Gebietskörperschaften und ihren<br />
politischen Strukturen die Möglichkeit,<br />
politische Debatten über die Europäische<br />
Union und deren Vor schläge zu führen;<br />
◆ die Möglichkeit, die politische Arbeit<br />
des Ausschusses der Regionen zu unterstützen;<br />
◆ ein Forum für den Austausch zwischen<br />
den Partnern des Netzwerkes, dem Ausschuss<br />
der Regionen und der Europäischen<br />
Kommission;<br />
◆ die Möglichkeit, der Anwendung des<br />
Subsidiaritätsprinzips konkrete Gestalt zu<br />
verleihen.<br />
Nähere Informationen<br />
Bewerbungen zur Teilnahme an dem<br />
Netzwerk können über die interaktive<br />
Webseite an den AdR gerichtet<br />
werden:<br />
http://subsidiarity.cor.europa.eu<br />
Derzeit registrierte Netzwerk-Partner:<br />
http://www.cor.europa.eu/de/<br />
activities/sub_net.htm
Making it happen: Die Regionen machen’s möglich<br />
Mehr Wachstum und<br />
Beschäftigung<br />
Mit der Anmeldung sichern Sie sich die<br />
Teilnahme an der bisher größten Veranstaltung<br />
dieser Art, die unter dem Motto<br />
„Making it happen – Regions and Cities<br />
deliver Growth and Jobs“ (Mehr Wachs-<br />
tum und Beschäftigung – die Regionen<br />
machen’s möglich) steht. In diesem Jahr<br />
ist die Rekordzahl von 212 Partnerregionen<br />
und –städten aus 33 Ländern vertreten<br />
ist, davon 36 Städte oder Stadtregionen,<br />
unter denen wiederum 16 europäische<br />
Hauptstädte sind. Zu den Open<br />
Days mit ihren 150 Seminaren und<br />
Workshops werden bis zu 5000 Besucher<br />
erwartet.<br />
Die für Regionalpolitik zuständige Kommissarin<br />
Danuta Hübner: „Wie in den<br />
Vorjahren werden die Open Days 2007<br />
Experten der EU, der Mitgliedstaaten,<br />
der Regionen und der Kommunen die<br />
Möglichkeit bieten, Fragen der Regionalentwicklung<br />
zu erörtern, neue Ideen vorzustellen<br />
und zu prüfen, ob und wie wir<br />
bessere Ergebnisse erzielen können. Ich<br />
freue mich auf diese Veranstaltung, bei<br />
der wir uns in anregenden Gesprächen<br />
mit Experten und Praktikern auf dem<br />
Gebiet der Regionalpolitik mit der Frage<br />
befassen können, wie wir unser Ziel, die<br />
Anhebung des Lebensstandards in allen<br />
Regionen und Städten der EU, verwirklichen<br />
können.“<br />
Michel Delebarre, Präsident des Ausschusses<br />
der Regionen, Bürgermeister<br />
und Abgeordneter von Dünkirchen<br />
(Frankreich), erklärte: „Seit den ersten<br />
Open Days im Jahr 2003 ist die Veranstaltung<br />
zu einer einzigartigen europäischen<br />
Plattform für Kommunikation, Diskussion<br />
und Networking zwischen Regionen<br />
und anderen Akteuren im Bereich<br />
Europa<br />
Mehr Wachstum und Beschäftigung ist das Motto der „Open Days 2007“. Es ist einer<br />
der größten Events seiner Art in Brüssel, von sich Regionen und Kommunen rund 500<br />
Besuchern präsentieren. Darum: Jetzt anmelden für die „Open Days 2007 – Europäische<br />
Woche der Regionen und Städte“ vom 8. bis 11. Oktober in Brüssel.<br />
»<br />
Wie in den Vorjahren<br />
werden wir Fragen<br />
der Regionalentwicklung<br />
erörtern,<br />
neue Ideen vorstellen<br />
und prüfen, ob<br />
und wie wir bessere<br />
Ergebnisse erzielen<br />
können.<br />
Danuta Hüber<br />
EU-Kommissarin für<br />
Regionalentwicklung<br />
«<br />
» Lassen Sie uns dafür sorgen,<br />
dass unsere Regionen<br />
nicht nur wettbewerbsfähiger<br />
werden, sondern<br />
einander auch gegenseitig<br />
besser unterstützen, wenn<br />
es darum geht, neues<br />
Potenzial zu erschließen.<br />
«<br />
Michel Delebarre<br />
Präsident des Ausschusses der Regionen<br />
und Bürgermeister von Dünkirchen (F)<br />
der Regional- und Kohäsionspolitik<br />
geworden. Lassen Sie uns dafür sorgen,<br />
dass unsere Regionen nicht nur wettbewerbsfähiger<br />
werden, sondern einander<br />
auch gegenseitig besser unterstützen,<br />
wenn es darum geht, Behörden und Privatsektor<br />
neues Potenzial zu<br />
erschließen.“<br />
Das Motto „Making it happen“ (Die<br />
Regionen machen’s möglich), unter dem<br />
die diesjährigen Open Days stehen, passt<br />
zu den 450 eben angelaufenen nationalen,<br />
regionalen und grenzüberschreitenden<br />
Entwicklungsprogrammen und der<br />
Bereitstellung von 500 Milliarden Euro<br />
aus öffentlichen und privaten Quellen für<br />
Investitionen in den nächsten sieben Jahren.<br />
Die Open Days bieten Seminare zu<br />
fünf Themenbereichen:<br />
◆ Investoren gewinnen (Attracting investors):<br />
Regionen und Städte zeigen,<br />
wie es funktioniert.<br />
◆ Nähe nutzen (Proximity matters): Cluster<br />
und regionale Entwicklung.<br />
◆ Sinnvoll investieren (Investing it<br />
wisely): Öffentlich-private Partnerschaften<br />
und Financial Engineering.<br />
◆ Grenzen überwinden (Crossing borders):<br />
Networking und Best Practice<br />
zur Unterstützung von Wachstum und<br />
Beschäftigung.<br />
◆ Ergebnisse kontrollieren (Checking<br />
delivery): Wie die Programme durchgeführt<br />
werden.<br />
Informationen und Anmeldung<br />
www.opendays.europa.eu<br />
Weitere Informationen zur europäischen<br />
Regionalpolitik finden Sie unter :<br />
http://ec.europa.eu/regional_policy/<br />
index_de.htm<br />
KOMMUNAL 37
Aus dem Auschuss der Regionen<br />
Europa auf lokaler und regionaler Ebene vermitteln<br />
Wie wird Europa<br />
kommuniziert?<br />
Die Bloomfield-Studie: Mehr als 150 regionale und lokale Gebietskörperschaften aus 24<br />
Mitgliedstaaten wurden gefragt, wie sie die Europäische Union vor Ort vermitteln. Die<br />
Ergebnisse zeigen, dass sich die Gebietskörperschaften besonders gut eignen, um den<br />
Bürgern die Vorteile des „Projekts Europa“ aufzuzeigen.<br />
Die vom Europäischen Forschungszentrum<br />
der Universität Birmingham (UK)<br />
durchgeführte Studie wurde auf dem<br />
Forum „Europa auf lokaler und regionaler<br />
Ebene vermitteln“ vorgestellt, das der<br />
Ausschuss der Regionen Anfang Juni<br />
2007 veranstaltet hat. Drei Fragen an<br />
Jon Bloomfield vom Europäischen Forschungszentrum<br />
in Birmingham zum<br />
Themenkreis „Die Städte und Regionen<br />
»<br />
setzen sich in Brüssel immer entschlossener<br />
für ihre Belange ein“<br />
Wie werden die Städte und Regionen<br />
über Europa informiert?<br />
Bloomfield: Die lokalen und regionalen<br />
Gebietskörperschaften verfolgen einen<br />
traditionellen Kommunikationsstil, d.h.<br />
ausgehend von Brüssel vermitteln sie die<br />
Informationen von oben nach unten. So<br />
fungierten die meisten Verantwortlichen<br />
für Europaangelegenheiten in den lokalen<br />
und regionalen Gebietskörperschaften<br />
und die Vertretungen der Regionen<br />
in Brüssel vor allem als Kanäle zur Informationsverbreitung,<br />
indem sie wichtige<br />
Informationen aus Brüssel an die zustän-<br />
38 KOMMUNAL<br />
Die lokalen und regionalen<br />
Gebietskörperschaften und der<br />
AdR stehen vor der Heraus -<br />
forderung, diese Konzepte, die<br />
den meisten EU-Bürgern heute<br />
zu abstrakt erscheinen, mit<br />
Leben und Inhalt zu füllen.<br />
Jon Bloomfield<br />
Europäisches Forschungszentrum der Univer-<br />
sität Birmingham (UK)<br />
digen Mitarbeiter in ihrer Behörde weiterleiteten.<br />
Das 2006 veranstaltete Forum des Ausschusses<br />
der Regionen zur Kommunikationspolitik<br />
hat jedoch deutlich gezeigt,<br />
dass die Städte und Regionen gegenüber<br />
Brüssel immer mehr Eigeninitiative<br />
entwickeln.<br />
Ja, das stimmt; die Studie verdeutlicht,<br />
dass ein Wandel im<br />
Gange ist. Immer mehr<br />
Gebietskörperschaften<br />
melden sich bei den<br />
EU-Institutionen zu<br />
Wort. Zurzeit neigen<br />
vor allem die lokalen<br />
und regionalen<br />
Akteure in den älteren<br />
«<br />
Mitgliedstaaten dazu,<br />
den EU-Institutionen<br />
mitzuteilen, wie sie zur<br />
EU-Förderpolitik stehen.<br />
Aus Sicht der<br />
meisten befragten<br />
Städte und Regionen,<br />
einschließlich all jener<br />
in den neuen Mitgliedstaaten, sind die<br />
Fördermöglichkeiten der Schlüsselfaktor<br />
für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit auf<br />
regionaler Ebene.<br />
Sie sagen, dass das Demokratiedefizit<br />
der Europäischen Union allgemein<br />
bekannt ist. Was können die Städte<br />
und Regionen tun, um Abhilfe zu schaffen?<br />
Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften<br />
und die Mitglieder des Ausschusses<br />
der Regionen sind besonders<br />
gut geeignet, den Bürgerinnen und Bürgern<br />
verständlich zu machen, welchen<br />
Mehrwert das Projekt Europa in so wichtigen<br />
Bereichen wie den Strukturfonds<br />
oder der Integration von Migranten<br />
bringt – einem Thema, mit dem alle mittelgroßen<br />
und großen Städte der EU täglich<br />
konfrontiert sind. So könnte z.B. der<br />
Bezug zwischen den Strukturfonds und<br />
dem europäischen Sozialmodell sicherlich<br />
weitaus häufiger betont werden, als<br />
dies allgemein getan wird. Auch sollten<br />
die Städte und Regionen eine breite<br />
Öffentlichkeit über speziell auf die Bürger<br />
ausgerichtete Förderprogramme<br />
informieren, wie „Bürger für Europa“,<br />
„Jugend in Aktion“, „Leonardo da Vinci“<br />
und „Erasmus“.<br />
Doch der zweifellos sinnvollste politische<br />
Beitrag, den der Ausschuss der Regionen<br />
und die Gebietskörperschaften zu dieser<br />
Debatte leisten könnten, bestünde darin,<br />
neue Ausdrucksmöglichkeiten der Multi-<br />
Level-Governance aufzuzeigen. Noch ist<br />
dieser Begriff für die Bürgerinnen und<br />
Bürger ein Beispiel für den EU-Jargon,<br />
der mit bürokratischen Strukturen und<br />
Instrumenten in Verbindung gebracht<br />
wird. Die lokalen und regionalen<br />
Gebietskörperschaften und der AdR stehen<br />
vor der Herausforderung, diese Konzepte,<br />
die den meisten EU-Bürgern heute<br />
zu abstrakt erscheinen, mit Leben und<br />
Inhalt zu füllen.<br />
Infos aus erster Hand<br />
Diese Seite ist gestaltet und<br />
autorisiert durch:<br />
Rue Belliard 101, B-1040 Brüssel<br />
Tel: 0032/2/282 2211<br />
Fax: 0032/2/ 282 2325<br />
Web: www.cor.europa.eu
◆ Mag. Nadja Tröstl<br />
Der Österreichische Gemeindebund veranstaltet<br />
von 25. bis 28. Oktober 2007<br />
eine Bürgermeisterreise in die sonnige<br />
Hauptstadt Portugals an die Atlantikküste.<br />
Wer ein anspruchsvolles Programm<br />
mit schönen Ausflügen kombinieren und<br />
zugleich die Möglichkeit wahrnehmen<br />
will, bei informellen Treffen „Networking“<br />
und Erfahrungsaustausch mit Kollegen<br />
zu betreiben, ist auf der Reise<br />
gerade richtig. Im Rahmen der Initiative<br />
„1.000 Bürgermeister fahren nach<br />
Europa“ wird eine Delegation von Bürgermeistern<br />
und Gemeindevertretern<br />
Lissabon besuchen, um mit hochkarätigen<br />
Vertretern der EU-Institutionen<br />
kommunalpolitische Themen zu diskutieren.<br />
Das Reiseprogramm kann sich<br />
sehen lassen: Nach der Ankunft in Lissabon<br />
per Linienflug wird eine Stadtrundfahrt<br />
mit Besichtigungen der wichtigsten<br />
Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise<br />
der Burg S. Jorge, ein Spaziergang<br />
durch die Alfama, Besuch des<br />
Belem-Viertels samt Besichtigung des<br />
Hieronymusklosters unternommen. Am<br />
zweiten Tag stehen die Empfänge beim<br />
österreichischen Botschafter Dr. Ewald<br />
Jäger und in der ständigen Vertretung<br />
der EU-Kommission auf dem Programm.<br />
Der Partnerverband des Österreichischen<br />
Gemeindebundes, der portugiesische<br />
Städte- und Gemeindebund sowie das<br />
Europa-Reise<br />
Lissabon: Blick auf den Praca do Império in Belém mit der Klosterkirche Santa Maria und dem archäologischen Nationalmuseum.<br />
Gemeindebund-Initiative „1.000 Bürgermeistern fahren nach Europa“<br />
Im Oktober geht’s<br />
nach Lissabon<br />
Nach dem großen Erfolg der ersten Bürgermeisterreise in das europäische Macht -<br />
zentrum Berlin zu Jahresbeginn geht es von 25. bis 28. Oktober 2007 in die nächste<br />
Hauptstadt der EU-Präsidentschaft, Lissabon. Der Österreichische Gemeindebund hat<br />
ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.<br />
Das Padrão dos Descobrimentos (Denkmal<br />
der Entdeckungen) steht im Vorort<br />
Bélem in Lissabon am Ufer des Flusses<br />
Tejo. Es wurde 1960 unter dem Salazar-<br />
Regime erstellt, genau 500 Jahre nach<br />
dem Tode von Heinrich dem Seefahrer.<br />
Parlament werden am dritten Tag<br />
besucht. Die Delegierten können auch<br />
an einem Ganztagesausflug nach Sintra,<br />
Bathalia, Alcobaca und Fatima teilnehmen.<br />
Natürlich ist die Reisegruppe auch<br />
bei einer Gemeindeverwaltung eingeladen,<br />
wo sie Einblicke in die kommunale<br />
Arbeit der portugiesischen Kollegen<br />
bekommt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich<br />
über kommunalnet.at unter<br />
www.kommunalnet.at/reise<br />
◆ Mag. Nadja Tröstl ist Redakteurin<br />
bei der Internetplattform<br />
www.kommunalnet.at<br />
KOMMUNAL 39
E-Government<br />
Ein Jahrzehnt Service im Internet<br />
E-Government<br />
in Österreich<br />
Österreich liegt in Europa auf Platz 1 im E-Government.<br />
Zu den Paradebeispielen des Digitalen Österreichs zählen<br />
der digitale Amtshelfer HELP.gv.at und das Rechtsinformationssystem<br />
RIS.bka.gv.at. Diese mehrfach national<br />
und international ausgezeichneten Anwendungen feierten<br />
Ende Juni ihr erfolgreiches 10-jähriges Bestehen.<br />
Die Geschichte von HELP.gv.at beginnt<br />
im Jahre 1997 und bereits ein Jahr später<br />
war es möglich durch Verlinkung<br />
auf die Websites der Städte, Gemeinden<br />
und Bezirkshauptmannschaften<br />
zugreifen zu können.<br />
Im selben Jahr konnte die Plattform<br />
bereits 948.314 Hits verbuchen (2006:<br />
über 100 Millionen Hits von über<br />
300.000 BesucherInnen).<br />
HELP.gv.at ist in Lebenslagen aufgebaut,<br />
welche sich durch leichtes Verständnis<br />
und bürgerfreundliche Anwendung<br />
ausgezeichnen. Damit war es<br />
möglich Amtswege sinnvoll zu „bündeln“<br />
und klassische Hierarchiestruktu-<br />
40 KOMMUNAL<br />
ren bzw. Kompetenzverteilungen von<br />
Behörden zu überwinden. Heute<br />
zählen fast 200 Lebenslagen (1998: 15<br />
Lebenslagen) zum Themenkatalog von<br />
HELP.gv.at. Bereits im Jahre 1998 wurden<br />
in HELP.gv.at die ersten „Gehversuche”<br />
mit elektronischen Formularen im<br />
österreichischen E-Government unternommen.<br />
Derzeit bietet HELP Zugriff<br />
auf mehr als 1.000 Formulare. Mit der<br />
Bürgerkartenfunktion werden immer<br />
mehr Verfahren vollständig elektronisch<br />
durchführbar, vom Antrag über die<br />
Bezahlung bis zur Zustellung. Heute<br />
gibt es insgesamt 742 Partnerbehörden,<br />
die aus 42 von HELP zur Verfügung<br />
Brigitte Barotanyi, BKA, freute sich über die Auszeichnung gemeinsam mit StS Heidrun<br />
Silhavy und Bundespräsident Heinz Fischer<br />
gestellten Online-Formularen wie z.B.<br />
Meldeauskunft, Hundeanmeldung,<br />
Kommunalsteuererklärung auswählen<br />
können.<br />
Der Grundstein für das Rechtsinformationssystem<br />
wurde im Herbst 1986 auf<br />
Im Rahmen des Global<br />
Forums verlieh die UNO Ende<br />
Juni 2007 Österreich den<br />
United Nations Public Service<br />
Award in der Rubrik „Electronic<br />
law making process“ für<br />
seine hervorragenden Leistungen<br />
im Sektor E-Government<br />
mit der Applikation E-Recht.<br />
Basis eines Ministerratsbeschlusses<br />
gelegt. Im Sommer 1997 startete RIS<br />
im Internet. Seit damals ist<br />
RIS.bka.gv.at eine öffentliche und<br />
kostenlose Plattform mit Informationen<br />
über das Recht der Republik Österreich<br />
sowie EU-Recht. Derzeit befinden sich<br />
1,4 Millionen Dokumente in der Internetversion<br />
und 2006 überstiegen die<br />
Abfragezahlen die 120 Millionen<br />
Grenze. Im Rahmen des Global Forums<br />
verlieh die UNO Ende Juni 2007 Österreich<br />
den United Nations Public Service<br />
Award in der Rubrik „Electronic law<br />
making process“ für seine hervorragen-
Über 300 Besucher – unter anderem Vizekanzler und Finanzminister Wilhelm Molterer,<br />
Staatssekretärin Heidrun Silhavy, Nationalbibliotheksdirektorin Rachinger, Sektionschef<br />
Matzka, BM a.D. Franz Löschnak und BM a.D. Karl Blecha (nicht im Bild)<br />
gratulierten zum 10-jährigen Jubiläum der Internetplattform HELP.gv.at und<br />
RIS.bka.gv.at<br />
den Leistungen im Sektor E-Government<br />
mit der Applikation E-Recht. Das<br />
Grundkonzept liegt darin, dass Rechtstexte<br />
von der ersten Entwurfsformulierung<br />
bis zur Behandlung im Parlament<br />
und der authentischen Kundmachung<br />
im Internet einen durchgehenden elektronischen<br />
Produktionsweg durchlaufen.<br />
Digitales Österreich präsentiert<br />
sich Gemeinden<br />
Vom 27. bis 28. September 2007 präsentiert<br />
sich die Plattform Digitales<br />
Österreich am 54. Österreichischen<br />
Gemeindetag im Rahmen der KOMMU-<br />
NALMESSE 2007 in Klagenfurt.<br />
Die Präsentation findet auf einer Sonderfläche<br />
von ca. 130m² statt. In dieser<br />
„E-Gov.City“ stellen Behörden, Institutionen<br />
und öffentliche Einrichtungen,<br />
gemeinsam mit ihren Wirtschaftspartnern,<br />
die aktuellsten Verwaltungslösungen<br />
sowie die spannendsten Zukunfts -<br />
trends vor.<br />
Ein moderner Staat braucht eine innovative,<br />
leistungsfähige und effiziente<br />
Verwaltung. Der Einsatz von Informationstechnologie<br />
und die Nutzung des<br />
Internets leisten dazu einen entschei-<br />
E-Government<br />
denden Beitrag. Mit der Plattform<br />
„Digitales Österreich“ forciert die Bundesregierung<br />
die homogene Zusammenarbeit<br />
von Bund, Ländern, Städten,<br />
Gemeinden<br />
und<br />
Wirt-<br />
schaft im<br />
Bereich<br />
E-Government<br />
sowie der<br />
InformationsundKommunikationstechnologie<br />
und reduziert damit nachhaltig die<br />
anfallenden Bürokratiekosten. Die<br />
Gemeinden sind bei der Umsetzung<br />
von E-Government-Strategien ein wichtiger<br />
Partner, weil sie den BürgerInnen<br />
am nächsten stehen. Laut Regierungsprogramm<br />
soll grundsätzlich jede Bürgerin<br />
und jeder Bürger bei seiner<br />
Gemeinde Zugang zu allen E-Government-Services<br />
auf Bundes-, Landesund<br />
Gemeindeebene haben.<br />
Auf der KOMMUNALMESSE in Klagenfurt<br />
werden Lösungen zum Thema<br />
E-Government, die Verwaltung von<br />
Morgen, gemeinsam und ebenenübergreifend<br />
vorgestellt. Gemeindepartner,<br />
Länder, Städte und Bundesapplikationen<br />
werden zusammen mit strategischen<br />
Partnern aus der Wirtschaft ihre<br />
neuesten Produkte präsentierten.<br />
Auf der KOMMUNALMESSE<br />
in Klagenfurt werden Lösungen<br />
zum Thema E-Government, die<br />
Verwaltung von Morgen,<br />
gemeinsam und ebenen -<br />
übergreifend vorgestellt.<br />
Information<br />
Nähere Infos zur KOMMUNAL-<br />
MESSE 2007 und zur Plattform<br />
„Digitales Österreich” unter<br />
www.digitales.oesterreich.gv.at<br />
Kontakt<br />
Bundeskanzleramt<br />
Christian Rupp<br />
Sprecher der Plattform Digitales<br />
Österreich im Bundeskanzleramt<br />
Ballhausplatz 2<br />
1014 Wien<br />
Tel: +43 (1) 53 115 - 2885<br />
E-Mail:<br />
christian.rupp@bka.gv.at<br />
KOMMUNAL 41<br />
E.E.
Blindtext Lebensministerium & Blindtext<br />
Umweltminister Pröll stellt<br />
die neue Informationskampagne<br />
für WaldbesucherInnen<br />
„Richtiges Verhalten im<br />
Wald“ vor.<br />
Neue Informationskampagne des Lebensministeriums<br />
Richtiges Verhalten<br />
im Wald fördern<br />
Die neue Informationskampagne des Lebensministeriums für WaldbesucherInnen soll zu<br />
richtigem Verhalten im Wald anregen, denn: Der österreichische Wald stellt ein großes<br />
Kapital dar – sowohl für unsere Umwelt als auch für unsere Volkswirtschaft.<br />
„Wir wollen mit diesen<br />
Tafeln Bewusstsein,<br />
Klarheit und<br />
Verständnis bei allen<br />
Waldbesuchern<br />
schaffen – um möglicheGefahrensituationen<br />
oder Konflikte<br />
erst gar nicht aufkommen<br />
zu lassen“,<br />
sagte Landwirt-<br />
schafts- und Umweltminister Josef Pröll<br />
anlässlich der Präsentation der neuen<br />
Hinweis- und Informationstafeln im<br />
Naturpark Sparbach.<br />
„Wir müssen uns ständig mit allen Faktoren<br />
auseinandersetzen, die den Zustand<br />
des Waldes gefährden können. Dies sind<br />
etwa Luftschadstoffe, der Klimawandel<br />
oder die Wald-Wildfrage. Insbesondere<br />
die steigende Zahl der Besucher, die in<br />
den Wald kommen, stellt einen Stress -<br />
faktor für den Wald dar“, so der Minister.<br />
Rund 70 Prozent der Bevölkerung sehen<br />
die Wälder als wichtigen Freizeit- und<br />
Erholungsraum an. Auch für den Tourismus<br />
sind Österreichs Wälder ein wichtiger<br />
Faktor, da sie aufgrund der hohen<br />
Vielfalt sowie der Ruhe und Stille besonders<br />
attraktiv sind. Im Gegensatz zu<br />
anderen europäischen Ländern sind rund<br />
99 Prozent des heimischen Waldes für<br />
BesucherInnen begehbar.<br />
42 KOMMUNAL<br />
Jeder Waldbesucher<br />
wird in Zukunft beim<br />
Eingang in den Wald<br />
mit einer<br />
Willkommens tafel<br />
begrüßt.<br />
„Gerade im Sommer kommen<br />
viele Menschen in den<br />
Wald, um dort an besonders<br />
heißen Tagen Erholung und<br />
Abkühlung zu suchen. Die<br />
Waldbesitzer heißen die<br />
Besucher als Gäste in ihren<br />
Wäldern herzlich willkommen“,<br />
betont Felix Montecuccoli,<br />
Präsident der Land &<br />
Forst Betriebe Österreich.<br />
„Damit aber der Aufenthalt wirklich<br />
erholsam wird und Gefährdungen sowie<br />
Konflikte vermieden werden, ist es notwendig,<br />
dass die Waldbesucher<br />
bestimmte Verhaltensregeln einhalten.“<br />
Beim Österreichischen Walddialog wurde<br />
es als wichtig angesehen, die BesucherInnen<br />
auf richtiges Verhalten im Wald aufmerksam<br />
zu machen, da sich fehlerhaftes<br />
Verhalten negativ auf das Ökosystem<br />
auswirken kann. „Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit<br />
wollen wir daher etwa<br />
erreichen, dass jedes Kind im Laufe seiner<br />
Schulzeit mindestens einmal an einer<br />
waldpädagogischen Führung teilnimmt.<br />
Mit der jetzt startenden Informationskampagne<br />
wollen wir nun die wichtigsten<br />
Verhaltensregeln den WaldbesucherInnen<br />
kurz und bündig mit auf den Weg<br />
durch den Wald geben“, stellt der Minister<br />
das Projekt vor.<br />
So wird jeder Waldbesucher mit einer<br />
Willkommenstafel begrüßt und darüber<br />
informiert, dass jeder den Wald zu Erholungszwecken<br />
betreten darf. Dieses<br />
„Willkommen“ steht aber auch für<br />
gegenseitige Rücksichtnahme und<br />
gewisse Spielregeln, die jeder Waldbesucher<br />
respektieren sollte. Jungwälder<br />
unter drei Meter Baumhöhe, gekennzeichnete<br />
Sperrgebiete sowie forstbetriebliche<br />
Einrichtungen dürfen zum<br />
Beispiel nicht betreten werden.<br />
Information<br />
Die neuen Waldtafeln sind ab<br />
sofort bei den Land & Forst<br />
Betrieben Österreich bestellbar.<br />
Genaue Informationen zur<br />
Bestellung erhalten Sie unter<br />
www.landforstbetriebe.at oder<br />
bei Gabriele Fischbacher,<br />
Tel.:<br />
01/5330227-10,<br />
Fax: 01/533104 ,<br />
Mail: fischbacher@<br />
landforstbetriebe.at<br />
Oder fordern Sie die<br />
Broschüre mit den<br />
verschiedenen<br />
Mustern bzw.<br />
Themen der Tafeln<br />
unter http://<br />
publikationen.<br />
lebensministerium.at/ an.
Wassercheck bestätigt gute Wasserqualität und zeigt Probleme auf<br />
Problembereiche sind „Last Mile“<br />
und die Hausbrunnen<br />
Damit die hohe Wasserqualität für die<br />
ÖsterreicherInnen gewährleistet wird,<br />
unterstützt das Lebensministerium seit<br />
2004 die Aktion „Wassercheck“, die in<br />
Zusammenarbeit mit der Österreichischen<br />
Post AG, AQA – Aqua Quality Austria<br />
– und ARC – Austrian Research Centers<br />
GmbH – durchgeführt wird. Bisher<br />
haben bereits mehr als 30.000<br />
ÖsterreicherInnen ihre persönliche Wasserqualität<br />
überprüft. 2006 wurde der<br />
chemisch/physikalische Wassercheck<br />
auch auf den sensiblen Bereich der<br />
Wasserhygiene ausgeweitet.<br />
Mit diesem Test ist es erstmals flächendeckend<br />
möglich, auch bakteriologische<br />
Parameter selbst zu überprüfen. Die<br />
ersten Ergebnisse bestätigen die hervor-<br />
Umweltminister Pröll (Mitte), Herbert<br />
Götz, Vorstand der Österreichischen<br />
Post (links) und Stephan Bruck, AQA<br />
Geschäftsführer (rechts) präsentierten die<br />
Ergebnisse des Wasserchecks.<br />
ragende Wasserqualität für die österreichischen<br />
Haushalte. „Es gibt aber<br />
durchaus Problembereiche auf der Last<br />
Mile – Hausleitungen und Armaturen zu<br />
Hause – und in der nicht-öffentlichen<br />
Wasserversorgung, sprich bei Hausbrunnen“,<br />
erklärt Landwirtschafts- und<br />
Umweltminister Josef Pröll. Hier gibt es<br />
keine verpflichtenden Kontrollen. Über<br />
die tatsächliche Qualität des Trinkwassers<br />
am Entnahmepunkt liegen deswegen<br />
nur vereinzelt Ergebnisse vor,<br />
obwohl die Qualität bei der Abgabe<br />
durch das Wasserwerk zu 100 Prozent<br />
einwandfrei ist. Wasser reagiert auf seine<br />
Umwelt, indem es Stoffe aufnimmt. Zum<br />
Beispiel können Wasserhähne, ganz<br />
gleich, was sie kosten, aus gutem Trinkwasser<br />
ein „trübes“ Süppchen machen.<br />
Die aktuellen Ergebnisse des Wasserchecks<br />
unterstreichen die Notwendigkeit<br />
solcher Tests: 22 Prozent aller eingesand-<br />
ten Proben aus dem chemisch/<br />
physikalischen Wassercheck zeigen Überschreitungen<br />
gegenüber höchstzulässigen<br />
Parameterwerten aus der Trinkwasserverordnung.<br />
Einflussfaktoren sind hier<br />
unter anderem das Alter der Bausubstanz<br />
und die Qualität der Leitungen und<br />
Armaturen auf den letzten Metern.<br />
Nickel, Nitrat und Blei sind hier als wichtige<br />
Parameter erwähnt. Aber auch die<br />
Wasserhärte spielt dabei eine wesentliche<br />
Rolle.<br />
Die ersten 1000 ausgewerteten bakteriologischen<br />
Wasserchecks zeigen, dass der<br />
Selbsttest zu 81 Prozent von privaten<br />
Hausbrunnenbesitzern wahrgenommen<br />
wurde. Die Messungen zeigen, dass Verdachtsmomente<br />
in den meisten Fällen<br />
begründet sind.<br />
Qualitätssicherung beim<br />
Wassercheck<br />
Beim chemisch/physikalischen Wassercheck<br />
sind die Parameter gegenüber<br />
Transport und Lagerung unempfindlich.<br />
Die Befolgung der Entnahmeanleitung ist<br />
bei beiden Wasserchecks ein wichtiges<br />
Kriterium für die Aussagekraft des<br />
Selbsttests. 99,98 Prozent der versandten<br />
Proben sind innerhalb von 24 Stunden<br />
nach Aufgabe im Labor gelandet. Der<br />
Wassercheck ist somit für uns auch ein<br />
gelebtes Qualitätssicherungsprogramm,<br />
freute sich Herbert Götz über die Spitzenwerte<br />
bei diesem Transportdienst.<br />
Eigenverantwortung und<br />
Aufklärung<br />
Nach der Identifizierung von Problemen<br />
kann in Eigenverantwortung die Nutzung<br />
für die getesteten Anlagen überdacht<br />
oder bauliche Veränderungen<br />
durchgeführt werden. Weiters werden<br />
umfassende „amtliche Analysen und<br />
Information<br />
Unter www.wassercheck.at<br />
sowie in Landesinformationen<br />
(wie z.B. in der Landesbroschüre<br />
NÖ) werden Informationen aufbereitet<br />
und alternative Untersuchungsanstalten<br />
aufgezeigt.<br />
www.lebensministerium.at<br />
www.lebensministerium.at<br />
Begutachtungen“ entsprechend den vorliegenden<br />
Ergebnissen empfohlen. Die<br />
Wasserchecks dienen in diesem Fall als<br />
kostengünstige Erstindikation und liefern<br />
einen Beitrag zur Aufklärung über das<br />
wichtige Lebensmittel Wasser.<br />
„Gerade im Bereich Grundwasser ist es<br />
wichtig, die Bevölkerung mit einzubeziehen.<br />
Ein kaputter Brunnen neben einer<br />
undichten Senkgrube kann eine Verschmutzungsquelle<br />
für eine ganze<br />
Region darstellen“, so Minister Pröll.<br />
Für mehr Hochwasserbewußtsein<br />
Hochwasserschutz ist<br />
Gemeinschaftsaufgabe<br />
Zahlreiche Ereignisse der näheren Vergangenheit<br />
haben uns deutlich vor<br />
Augen geführt, dass auch Österreich von<br />
großen Hochwasserkatastrophen nicht<br />
verschont bleibt. Die Frage, wo künftige<br />
massive Hochwässer in Österreich wieder<br />
auftreten und wie Schäden minimiert<br />
werden können, ist eine zentrale<br />
Frage, die uns bewegt.<br />
Zentrale Erkenntnis dieser Ereignisse ist,<br />
dass wir sie trotz all unserer technischen<br />
und finanziellen<br />
Möglichkeiten auch<br />
in Zukunft nicht<br />
verhindert werden<br />
können, dass wir<br />
aber bei konsequenterUmsetzung<br />
eines integralenHochwasserrisikomanagements<br />
bei künftigen<br />
Ereignissen<br />
bestmöglich vorbereitet<br />
sein werden, um die Schäden<br />
entsprechend zu minimieren.<br />
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister<br />
sind nicht nur gefordert den Katastrophenschutz<br />
auf lokaler Ebene zu organisieren,<br />
sondern auch durch Aufklärung<br />
und Information den Bürgerinnen und<br />
Bürgern ein entsprechendes „Hochwasserbewusstsein“<br />
zu vermitteln. Das<br />
Lebensministerium unterstützt die Kommunalpolitiker<br />
mit einer neuen Broschüre,<br />
die über die Homepage<br />
http://publikationen.<br />
lebensministerium.at/ zu bestellen ist.<br />
KOMMUNAL 43
Wer sich in der Schule wohlfühlt, lebt ausgeglichener und<br />
greift seltener zu Alkohol und Drogen. Das Projekt<br />
„Klasse!“ zeigt, wie ein gutes Klassenklima schützen<br />
kann.<br />
Das Projekt „Klasse!“<br />
Eine gute Klassengemeinschaft ist eine<br />
wesentliche Voraussetzung für die psychosoziale<br />
Gesundheit von Jugendlichen<br />
– das steht für die Initiatioren/ innen des<br />
Projekts „Klasse!“ fest. Ein positives Klassenklima<br />
schafft psychische Ausgeglichenheit<br />
und schützt vor pathologischen<br />
Mechanismen wie dem Konsum von<br />
Alkohol und Drogen oder anderen selbstschädigenden<br />
Handlungen.<br />
Basierend auf den Vorerfahrungen des<br />
Pilotprojekts „trouble-scout“, das im<br />
Schuljahr 2004/2005 an fünf Tiroler<br />
Schulen durchgeführt wurde, startete<br />
Kontakt & Co ein umfassendes Programm<br />
zur Förderung der psychosozialen<br />
Gesundheit von Jugendlichen. Zielgruppe<br />
waren Tiroler Schüler/innen aus<br />
30 Klassen<br />
in AHS,<br />
BHS sowie<br />
BMHS.<br />
„Klasse!“ ist<br />
eine<br />
„soziale<br />
Investition“<br />
in der 9.<br />
Schulstufe,<br />
die den<br />
Grundstock<br />
für eine<br />
gute Klassengemeinschaft<br />
in den Folgejahren<br />
legen sollte.<br />
Im Mittelpunkt standen Aktivitäten zur<br />
Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartungen,<br />
der Problembewältigungskompetenz<br />
und der sozialen Integration<br />
sowie der Lebensqualität. Vorgegangen<br />
wurde nach dem Peer-Ansatz.<br />
Klassensprecher/innen erhielten Leader -<br />
shipfunktionen, externe Trainer/innen<br />
begleiteten engagierte Klassenvorstände<br />
und Klassensprecher/innen durch das<br />
Schuljahr.<br />
44 KOMMUNAL<br />
„Klasse!“ ist eine „soziale Investition“<br />
in der 9. Schulstufe.<br />
Das Projekt beinhaltete folgende Elemente:<br />
◆ Einführung und Reflexionstreffen für<br />
die Klassenvorstände<br />
◆ Wahl geeigneter<br />
Klassensprecher/innen<br />
◆ Workshops für die<br />
Klassensprecher/innen<br />
◆ Klassenworkshops<br />
◆ Aktivitäten mit der Klasse<br />
„Klasse!“ wurde wissenschaftlich begleitet.<br />
Kernstück war eine Eingangs- und<br />
eine Abschlussbefragung, die von den<br />
Schüler/innen an Computerarbeitsplätzen<br />
der Schule durchgeführt wurde.<br />
Darüber hinaus fanden einmal im Monat<br />
Erhebungen zum subjektiven Empfinden<br />
des Klassenklimas statt. Zweimal pro<br />
Semester wurden Aktionen zum sozialen<br />
Lernen durchgeführt – geleitet von den<br />
Klassensprecher/innen, die als Peers<br />
agierten – und anschließend in einer<br />
Unterrichtseinheit vertieft. Im Rahmen<br />
von Elternabenden wurden auch die<br />
Eltern partizipativ in das Projekt eingebunden.<br />
Nach Abschluss der Projektphase übernahm<br />
man die Maßnahmen als fixen<br />
Bestandteil des Unterrichts.<br />
„Klasse!“ wurde von Kontakt & Co und<br />
dem Psychiatrischen Krankenhaus Hall<br />
durchgeführt. Finanziert vom Fonds<br />
Gesundes Österreich beteiligten sich als<br />
Kooperationspartner der Landesschulrat<br />
Tirol, das Kriseninterventionszentrum für<br />
Kinder und Jugendliche in Not (KIZ), das<br />
Pädagogische Institut des Landes Tirol<br />
und die Rotary-Clubs Tirol.<br />
Information & Kontakt<br />
Kontakt & Co, Suchtprävention<br />
Jugendrotkreuz, Dipl. Päd. Brigitte<br />
Fitsch, Projektkoordinatorin<br />
Bürgerstraße 18, 6020 Innsbruck<br />
Tel.: 05125/85730<br />
Psychiatrisches Krankenhaus Hall<br />
Prim. Dr. Christian Haring<br />
Tel.: 05223/508-2030<br />
Kontakt<br />
Fonds Gesundes Österreich –<br />
FGÖ, Mariahilferstraße 176,<br />
A-1150 Wien, Tel. 01/8950400,<br />
Fax: 01/8950400-20,<br />
E-Mail: info@fgoe.org<br />
Web: www.fgoe.org
KOMMUNAL<br />
PRAXIS<br />
Biotonnen: Neues Reinigungsmittel hilft gegen Geruchsbelästigungen<br />
Der Gestank, der aus der Tonne kam<br />
Biotonnen sind eine sinnvolle<br />
Einrichtung. Sie leisten einen<br />
wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung<br />
und dienen der<br />
Herstellung wertvollen Komposts.<br />
Gerade jedoch in der<br />
warmen Jahreszeit verströmen<br />
Biotonnen einen eindringlichen<br />
und unangenehm<br />
modrigen Geruch. Darüber<br />
hinaus sind sie eine<br />
wahre Brutstätte für Ungeziefer<br />
und Bakterien, Maden<br />
und Insektenlarven.<br />
Wer selber eine Biotonne hat,<br />
weiß, die Reinigung mit Wasser<br />
oder die Untermengung<br />
von Kalk hilft da nicht viel<br />
weiter. Gegen Fett- und<br />
Eiweißverschmutzungen helfen<br />
meist nur scharfe, giftige<br />
Die richtigen Geräte helfen, Strom zu sparen.<br />
Substanzen und dem unangenehmen<br />
Geruch, der auch<br />
leeren Tonnen noch anhaftet,<br />
ist kaum beizukommen.<br />
Ein Wiener Unternehmen<br />
hat jetzt ein Mittel auf den<br />
Markt gebracht, das mit<br />
dem Gestank aus der Tonne<br />
Schluss macht. Das von der<br />
Wiener FAQT GmbH vertriebene<br />
Mittel FAXOL beseitigt<br />
schnell und nachhaltig<br />
sowohl den Schmutz als<br />
auch und vor allem den<br />
penetranten Geruch, der<br />
ansonsten auch nach der Entleerung<br />
in der Tonne haften<br />
bleibt.<br />
Den Härtetest bestand Faxol<br />
bei der Reinigung der Hofer-<br />
Biotonnen durch die Mödlin-<br />
Energieeffiziente Geräte: Vorarlberg zeigt´ s vor<br />
Richtig Strom sparen im Büro<br />
Energieeffiziente Geräte kaufen<br />
und richtig nutzen spart<br />
Strom und Kosten. „energieeffiziente<br />
geräte“, ein<br />
klima:aktiv Programm des<br />
Lebensministeriums, berät<br />
öffentliche Institutionen und<br />
Unternehmen dabei – kostenfrei<br />
und österreichweit.<br />
Haben Bürogeräte einmal<br />
ausgedient, lohnt es sich,<br />
beim Neukauf genauer auf die<br />
Energieeffizienz zu achten.<br />
Das zeigt auch der Vorarlber-<br />
ger Umweltverband in seiner<br />
letzten PC-Ausschreibung für<br />
Vorarlberger Gemeinden: Der<br />
Energieverbrauch der Geräte<br />
ging sowohl in die Muss- als<br />
auch in die Sollkriterien ein.<br />
Durch den Kauf des energieeffizientesten<br />
PCs sparen die<br />
Vorarlberger Gemeinden im<br />
Vergleich zum ineffizienten<br />
Gerät 44 Prozent der Stromkosten<br />
– ohne jeglichen Komfortverlust.<br />
Mehr auf<br />
www.klimaaktiv.at<br />
ger Saubermacher: „Wir sind<br />
von dem neuen Mittel überzeugt,“<br />
erklärt Herr Ing. Andreas<br />
Kazda Betriebsleiter der<br />
Mödlinger Saubermacher,<br />
„die Reinigung geht schnell<br />
und unkompliziert und da<br />
man Faxol extrem niedrig<br />
dosieren kann, ist es sehr<br />
sparsam im Verbrauch – ein<br />
Argument, das bei unseren<br />
Größenordnungen natürlich<br />
nicht unwichtig ist.“<br />
Dabei ist Faxol ausgesprochen<br />
umweltfreundlich: Es<br />
ist ungiftig, nicht ätzend oder<br />
reizend, wird als nicht wassergefährdend<br />
eingestuft und<br />
wird von der ‚umweltberatung’<br />
als umweltschonendes<br />
Reinigungsmittel empfohlen.<br />
So bleibt die Biotonne sauber<br />
und dennoch umweltfreundlich.<br />
Weitere Informationen finden<br />
Sie unter www.faxol.at<br />
Cyber-Kriminalität<br />
Initiative „Sicher<br />
im Internet“<br />
Spitzenvertreter aus Politik<br />
und Wirtschaft haben die<br />
Initiative „Sicherheit im Internet“<br />
ins Leben gerufen, um<br />
der steigenden Cyber-Kriminalität<br />
den Garaus zu machen.<br />
Auch Gemeinden sollten<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
ergreifen. „Es ist gut, dass<br />
Wirtschaft und Politik ihre<br />
Kräfte bündeln und gemeinsam<br />
mehr Sicherheit im Internet<br />
schaffen“, sagt dazu BM<br />
Erwin Buchinger. Auch die<br />
2357 Gemeinden setzen<br />
immer mehr auf das Internet<br />
mit Online-Dienstleistungen<br />
für ihre Bürger und sollten<br />
sich mit Sorgfalt und Hausverstand<br />
vor Attacken schützen.<br />
Die neuen Domekameras von<br />
Siemens haben alles im Blick.<br />
Neue Technologie<br />
Klarer Überblick<br />
Die neuen Solaris Domekameras<br />
von Siemens Building Technologies<br />
überzeugen durch<br />
Präzision, Bildqualität sowie<br />
Zuverlässigkeit und können für<br />
verschiedenste Überwachungsgebiete<br />
eingesetzt werden. Sie<br />
eignen sich sowohl für Innenanwendungen<br />
im Handel und<br />
Gewerbe als auch für<br />
Außeneinsätze, beispielsweise<br />
im Verkehr, öffentlichen Zentren<br />
oder in Flughäfen.<br />
www.siemens.com/<br />
buildingtechnologies<br />
Umweltpreis 2007<br />
Nö.Firma gewinnt<br />
Das nö. Unternehmen „Bau<br />
Beton“ gewinnt den Transport-<br />
Umwelt-Preis 2007. Das 60-<br />
Mann/Frau-Unternehmen Bau<br />
Beton setzt neue Maßstäbe in<br />
punkto Umweltbewusstsein.<br />
Dass die „Grüne Produktion“ bei<br />
Bau Beton wirklich ernst<br />
genommen wird, beweist die<br />
hohe Auszeichnung des österreichischen<br />
Güterverbandes<br />
Transportbeton. „Wir freuen<br />
uns, dass unsere Investitionen in<br />
den letzten zehn Jahre in<br />
Umweltmaßnahmen Jury honoriert<br />
wurde“, freut sich Ing.<br />
Rudolf Mayer, Geschäftsführer<br />
von Bau Beton.
»<br />
E-Government-Praxis<br />
50 Prozent Ersparnis durch<br />
Behördentarif<br />
Gemeinden<br />
„stürmen“<br />
Kommunalnet<br />
Ein oft geäusserter Wunsch der<br />
Gemeinden zur Arbeitserleichterung<br />
wurde Wirklichkeit:<br />
◆ Grundbuch,<br />
◆ Firmenbuch und<br />
◆ Zentrales Gewerberegister<br />
direkt über ein Stammportal aufrufen<br />
zu können, ohne ein weiteres Login<br />
durchführen zu müssen.<br />
kommunalnet.at und das Bundesrechenzentrum<br />
haben in den letzten Monaten<br />
intensiv an der Realisierung dieses Wunsches<br />
gearbeitet, so daß seit kurzem<br />
allen kommunalnet.at-Gemeinden der<br />
Zugriff auf Grundbuch, Firmenbuch und<br />
Gewerberegister mit einem Klick zur<br />
Verfügung steht. Durch die Verrechnung<br />
über das Bundesrechenzentrum ist<br />
zudem garantiert, dass die Gemeinden<br />
bei Grundbuch und Firmenbuch in den<br />
Genuss des günstigen Behördentarifs<br />
Der Ansturm ist<br />
enorm. Bereits in<br />
den ersten Tagen<br />
haben sich über<br />
200 Gemeinden<br />
für den Zugriff<br />
angemeldet.<br />
Michael Vesely<br />
kommunalnet.at-<br />
Geschäftsführer<br />
«<br />
gelangen. Gegenüber Abfragen über<br />
andere Verrechnungsstellen sind<br />
dadurch Ersparnisse von 50 Prozent<br />
möglich.<br />
kommunalnet.at-Geschäftsführer Michael<br />
Vesely: „Der Ansturm ist enorm.<br />
Bereits in den ersten Tagen haben sich<br />
über 200 Gemeinden für den Zugriff<br />
angemeldet.“ Für Vesely war es vor<br />
allem die große Zahl an Mitgliedsgemeinden,<br />
welche das Bundesrechenzentrum<br />
bewogen haben, die notwendigen<br />
Anpassungen durchzuführen und den<br />
Zugang für kommunalnet.at freizuschalten.<br />
„Die Idee eines österreichweiten<br />
kommunalen Intranets hat sich hier wieder<br />
eindrucksvoll bewährt: Ohne die<br />
mehr als 1700 Gemeinden, die uns<br />
bereits das Vertrauen schenken, hätten<br />
wir das nicht erreicht.“<br />
46 KOMMUNAL<br />
Auf der Kommunalnet-Seite geht´s los.<br />
Seit 27. August finden Sie in Ihrer Werkzeugleiste<br />
den Button „Kommunalbedarf“<br />
Ein Klick und der User kommt – durch Single<br />
Sign-On schon angemeldet – auf die Startseite<br />
von Kommunalbedarf. Auf Kommunalbedarf heißt es dann nur no<br />
StVO, verschiedenste Warn-Tafeln, Büroarti<br />
Alltag wie Wahlurnen aussuchen.<br />
Kommunalbedarf goes Kommunalnet<br />
Ein Klick zu<br />
1000 Tafeln<br />
Verwaltungsvereinfachungen und Arbeitserleichterungen<br />
werden großgeschrieben bei den Gemeinden. Seit<br />
27. August hat sich die ganze Welt des Kommunalbedarf<br />
für die registrierten User von Kommunalnet geöffnet –<br />
und der Weg zu tausenden Verkehrszeichen und Dingen<br />
des täglichen kommunalen Bedarfs steht offen.<br />
Mehr als 1700 Gemeinden haben sich<br />
bei Kommunalnet registriert. Hunderte<br />
haben schon bei Kommunalbedarf ihre<br />
gemeindespezifischen Produkte geordert.<br />
Was liegt also näher, als die beiden<br />
Plattformen zusammenzufassen und<br />
den Arbeitsablauf zu vereinfachen –<br />
noch dazu, wo die Gemeinden ja<br />
bekannt sind für schnelle und komplikationslose<br />
Lösungen (siehe auch<br />
Bericht links)? Die Kommunalnet-User<br />
findet deswegen seit 27. August in seinem<br />
Werkzeugen auch den Begriff<br />
„Kommunalbedarf“.<br />
Ein Klick darauf, und er ist – durch die<br />
Vorteile des „Singel Sign-On“ Systems<br />
(SSO) – ohne ein weiteres Passwort<br />
sofort auf der Kommunalbedarfs-<br />
Homepage und kann dort bestellen.<br />
StVO-Verkehrszeichen<br />
sind der Renner<br />
Exklusiv auf Kommunalnet bietet Kommunalbedarf<br />
die Verkehrszeichen nach<br />
der StVO an. Darüber hinaus gibt es<br />
jede Menge an Spezialtafeln zum<br />
Schutz der Kinder. Seien es Warntafeln<br />
zum Schulbeginn – die jetzt besonders
noch, die Produkte (Verkehrszeichen nach der<br />
artikel oder Dinge speziell für den kommunalen<br />
aktuell sind – oder Wandertafeln.<br />
Damit kann jede<br />
Gemeinde ihre Wanderwege<br />
besonders schön ausschildern.<br />
Und das Schönste ist,<br />
dass die Länder die Wanderweg-Beschilderung<br />
zu 50<br />
Prozent fördern.<br />
Auf Kommunalbedarf finden<br />
sich aber neben den Verkehrszeichen<br />
auch Dinge des<br />
normalen Büroalltags wie<br />
Briefpapier und eher spezielles<br />
für den kommunalen Alltag<br />
wie Wahlurnen. Ein<br />
Klick, und es gehört ihnen.<br />
Wie funktioniert’s?<br />
Einfach wie gewohnt einsteigen<br />
bei Kommunalnet und<br />
in der Werkzeugleiste auf<br />
Kommunalbedarf klicken.<br />
Das Startfenster öffnet sich<br />
und sie brauchen nur mehr<br />
die Kategorie wählen. Dann<br />
die Bestellanfrage mit den<br />
Details der Bestellung<br />
(Anzahl, Größe, Befestigung<br />
etc.) ausfüllen und<br />
Abschicken.<br />
Dann wird ihr Auftrag<br />
berechnet und die Bestellung<br />
per E-Mail mit dem fertig<br />
berechneten Preis an Sie<br />
geschickt. Erst mit ihrem OK<br />
auf dieser Mail-Bestellung<br />
ist der Auftrag gültig, die<br />
Ware wird binnen ein paar<br />
Tagen zugestellt.<br />
Für den Fall, dass sie Fragen<br />
haben über die beste Art der<br />
Befestigung einer Tafel oder<br />
ähnliches: Wir rufen auch<br />
gerne an und beraten.<br />
Österreichischer<br />
Kommunal-Verlag,<br />
Robert Ohorn,<br />
Tel: 01/5322388-34,<br />
Fax: 01/5322388-22<br />
E-Mail: robert.ohorn@<br />
kommunal.at<br />
Wissen<br />
Das Finale: Das Bestellformular<br />
abschicken, Preis bestätigen und<br />
die Ware ein paar Tage später<br />
in Empfang nehmen.<br />
Single Sign-On<br />
Single Sign-On (kurz SSO,<br />
mitunter als „Einmalanmeldung“<br />
übersetzt)<br />
bedeutet, dass ein Benutzer<br />
nach einer einmaligen<br />
Authentifizierung auf alle<br />
Rechner und Dienste, für<br />
die er berechtigt ist,<br />
zugreifen kann, ohne sich<br />
jedes Mal neu anmelden<br />
zu müssen.<br />
Innerhalb von Portalen ist<br />
es auch möglich, dass die<br />
Identität des angemeldeten<br />
Benutzers an die das<br />
Portal konstituierenden<br />
Sichten weitervererbt<br />
wird, ohne dass dies der<br />
Sicht des Anwenders selbst<br />
bekannt gemacht worden<br />
wäre. Ziel des Single Sign-<br />
Ons ist es, dass sich der<br />
Benutzer nur einmal unter<br />
Zuhilfenahme eines Authentifizierungsverfahrens<br />
identifiziert.<br />
E-Government-Praxis<br />
CHANCEN<br />
VIELFALT<br />
Immer mehr Gemeinden nützen die Chance einer<br />
Leasingfinanzierung. Österreichs Spezialisten für<br />
kommunale Leasingprojekte sagen Ihnen wie.<br />
E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at<br />
www.kommunal-leasing.at<br />
KOMMUNAL 47
Wirtschafts-Info<br />
48 KOMMUNAL<br />
Kostengünstiger Klimaschutz mit<br />
CO2 neutralem Heizen<br />
Alleskönner in<br />
kompakter Bauweise<br />
Klimaschutz geht uns alle<br />
an. Spätestens seit dem<br />
jüngsten Klimaschutzbericht<br />
der Vereinten Nationen ist<br />
eines deutlich geworden: Es<br />
müssen neue, die Zukunft<br />
sichernde Wege gegangen<br />
werden, um die dringend<br />
notwendige CO2-Reduzierung<br />
schnellstmöglich zu<br />
erreichen.<br />
Biomasseheizungen heizen<br />
CO2 neutral, sind somit<br />
umweltschonend und die<br />
kostengünstige Alternative<br />
zu den bisherigen fossilen<br />
Energieträgern, wie z.B. Öl,<br />
und Gas.<br />
Der Innovationsführer am<br />
Markt ist KWB Biomasseheizungen.<br />
Speziell für gewerbliche<br />
Objekte und Nahwärmenetze<br />
wurde der KWB<br />
Powerfire (bis 300 kW) entwickelt.<br />
Technischer Fortschritt<br />
lässt sich hier auch<br />
beim flexiblen Brennstoffeinsatz<br />
erkennen. Der KWB<br />
Powerfire verbrennt Hackgut,<br />
Pellets und Industriepellets<br />
– ein Alleskönner! Das<br />
Produkt besticht durch einfache<br />
Technik und Zuverläs-<br />
sigkeit im Betrieb. Das große<br />
Plus des KWB Powerfire ist<br />
die kompakte Bauweise. Der<br />
Platzbedarf reduziert sich<br />
auf ein Minimum.<br />
Die Raumaustragungssy-<br />
Der KWB Powerfire wurde speziell für gewerbliche Objekte und<br />
Nahwärmenetze (bis 300 kW) entwickelt.<br />
steme werden auf die örtlichen<br />
Gegebenheiten und<br />
Wünsche der Kunden abgestimmt.<br />
Die robusten Fördersysteme<br />
zeichnen sich durch<br />
Funktionssicherheit,<br />
Laufruhe und hohe Verschleißfestigkeit<br />
aus. Die<br />
externe Ascheaustragung in<br />
den 240 Liter großen Aschebehälter<br />
sorgt für geringen<br />
Betreuungsaufwand.<br />
Die Produkte von KWB Biomasseheizungen<br />
wurden<br />
schon mit zahlreichen Preisen<br />
ausgezeichnet – unter<br />
anderem mit dem Testsieger<br />
von Stiftung Warentest, Konsument<br />
und dem blauen<br />
Engel.<br />
Information<br />
Mehr Informationen<br />
finden Sie auf<br />
www.kwb.at<br />
E.E.
Zur Erreichung dieser Zielsetzung hat<br />
sich die Bundesregierung u. a. vorgenommen,<br />
den Anteil an erneuerbaren<br />
Energieträgern bis 2010 auf 25 Prozent,<br />
bis 2020 auf 45 Prozent des Gesamt -<br />
energieverbrauches zu steigern.<br />
Die Europäische Kommission strebt in<br />
ihrem im Dezember 2005 vorgelegten<br />
Aktionsplan für Biomasse EU-weit eine<br />
Erhöhung der<br />
energetischen<br />
Biomassenutzung<br />
von 69 Mil-<br />
lionen Tonnen<br />
im Jahr 2003<br />
auf rund 150<br />
Millionen Tonnen<br />
bis etwa<br />
2010 an. ErneuerbareEnergieträger<br />
sind<br />
damit neben der<br />
Steigerung der<br />
Energieeffizienz<br />
ein wesentlicher Baustein zur Verwirklichung<br />
eines nachhaltigen Energie -<br />
systems. Die Umweltförderung im<br />
Inland ist das wichtigste Förderinstrument<br />
des Lebensministeriums zur Erreichung<br />
dieser Zielsetzung.<br />
Lösungsansätze aufgreifen,<br />
Förderung kassieren<br />
Klimaschutz ist zwar ein globales Problem,<br />
intelligente Lösungsstrategien setzen<br />
aber auf der lokalen Ebene an. Das<br />
bringt, neben den Vorteilen für das<br />
Klima, eine Minderung der Schadstoffund<br />
Lärmbelastung vor Ort, es belebt<br />
die Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und<br />
fördert Innovationen.<br />
Die Umweltförderung im Inland ist ein<br />
Förderprogramm des Lebensministeriums,<br />
das Betriebe in Gewerbe, Industrie<br />
und im Dienstleistungssektor bei der<br />
Verwirklichung von Klimaschutzprojekten<br />
unterstützt. Die<br />
Palette an möglichen<br />
Förderprojekten reicht<br />
dabei von Solaranlagen<br />
oder Biomasse-Einzelanlagen<br />
bis hin zu<br />
Investitionen mit kommunalemInfrastrukturcharakter,<br />
bspw. in<br />
Form von Biomasse-<br />
Nahwärmenetzen. Prinzipieller<br />
Förderzweck<br />
ist die Erzielung von<br />
CO2-Reduktionen durch<br />
den Einsatz erneuerbarer<br />
anstelle fossiler Energieträger oder<br />
die Steigerung der Energieeffizienz.<br />
Gefördert wird mit nicht rückzahlbaren<br />
Investitionszuschüssen in der Höhe von<br />
maximal 30 Prozent der umweltrelevanten<br />
Investitionskosten.<br />
Effizient und<br />
umweltfreundlich<br />
Im Jahr 2006 wurden etwa 73 Mio.<br />
Euro für die Unterstützung von mehr<br />
als 2.300 Projekten im Bereich der<br />
erneuerbaren Energieträger und der<br />
Wirtschafts-Info<br />
Förderung für erneuerbare Energie<br />
Einreichen lohnt sich<br />
Von 2008 bis 2012 läuft die Kyoto-Bilanzperiode. In diesem Zeitraum muss Österreich<br />
seine CO2-Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 um 13 Prozent reduzieren. Wie<br />
kann dieses Ziel erreicht werden?<br />
Überall wo Gemeindeoder<br />
Kommunalbetriebe,<br />
Errichtungs- oder Betriebs -<br />
gesellschaften im öffentlichen<br />
Eigentum klimarelevante<br />
Projekte umsetzen,<br />
lohnt eine Einreichung.<br />
Prinzipieller Förderzweck<br />
ist die Erzielung von CO2-<br />
Reduktionen durch den<br />
Einsatz erneuerbarer Energieträger<br />
wie Biomasse<br />
(Bild) anstelle fossiler oder<br />
die Steigerung der Energieeffizienz.<br />
Energieeffizienz zugesagt. Die damit<br />
ausgelösten Investitionen tragen mit<br />
einer Reduktion von ca. 710.000 Tonnen<br />
CO2-Emissionen pro Jahr zur Verbesserung<br />
der österreichischen Klima -<br />
bilanz bei. Bezogen auf die Nutzungsdauer<br />
der Anlagen reduzieren die<br />
geförderten Projekte mehr als 10 Mio.<br />
Tonnen CO2-Emissionen.<br />
Auch auf Gemeindeebene gibt es eine<br />
Vielzahl an Möglichkeiten, die Anwendung<br />
heimischer erneuerbarer Energieträger<br />
zu forcieren: Gemeinden errichten<br />
und betreiben zahlreiche Gebäude<br />
und Betriebsstätten, sorgen für<br />
Beleuchtung oder organisieren die<br />
Errichtung von Nahwärmenetzen. Einrichtungen<br />
der öffentlichen Hand kommen<br />
in Form von Betrieben mit marktbestimmter<br />
Tätigkeit in den Genuss der<br />
Umweltförderung im Inland. Überall<br />
wo Gemeinde- oder Kommunalbetriebe,<br />
Errichtungs- oder Betriebsgesellschaften<br />
im öffentlichen Eigentum klimarelevante<br />
Projekte umsetzen, lohnt<br />
eine Einreichung.<br />
Information & Formulare<br />
Kommunalkredit Public Consulting<br />
GmbH, Türkenstraße 9<br />
1092 Wien<br />
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-0<br />
Fax: +43 (0)1/31 6 31-104<br />
Mail: kpc@kommunalkredit.at<br />
Web: www.public-consulting.at/<br />
de/portal/umweltförderungen/<br />
KOMMUNAL 49<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Vorsicht bei der Ausmusterung alter Rechner<br />
Wenn alte Computer zu<br />
neuem Leben erwachen<br />
Alte Rechner, neue Sorgen: Nicht selten<br />
entscheiden sich PC-Besitzer und Firmen<br />
beim Computerneukauf, ihre alten<br />
Geräte zu verschenken, zu stiften oder<br />
im Internet zu versteigern. Was auf den<br />
ersten Blick wie eine gute Idee erscheint,<br />
kann zur bösen Überraschung werden,<br />
wenn vertrauliche Daten wie beispielsweise<br />
Konto-, Studien- oder Kundeninformationen<br />
in falsche Hände geraten.<br />
Utimaco empfiehlt daher, schon frühzeitig<br />
an die Absicherung brisanter Daten<br />
zu denken. „Es gibt zwar diverse, manchmal<br />
recht zeitaufwändige Löschmöglichkeiten<br />
und internationale Richtlinien<br />
sprechen sich für ein siebenfaches Überschreiben<br />
der Festplatte aus. Wer aber<br />
Zeit, Kosten und Mühen sparen möchte,<br />
setzt auf eine frühzeitige Verschlüsselung“,<br />
rät Rieke Bönisch, Datensicherheitsexpertin<br />
bei Utimaco.<br />
Die Data Security Company Utimaco hat<br />
bei Testkäufen bereits Rechner mit voll-<br />
ständiger E-Mail-Korrespondenz, Privatinformationen<br />
und Kundendaten entdeckt<br />
und selbst bei Stichproben, bei<br />
denen die Festplatte gesäubert war, ließ<br />
sich der Datenbestand schnell wieder<br />
rekonstruieren. Bönisch weiter:<br />
„Es reicht nicht aus, vertrauliche Informationen<br />
einfach nur zu löschen.<br />
Dabei wird nur der Verweis, wo die<br />
Daten auf der Festplatte zu finden sind,<br />
ausradiert. Das ist ungefähr so, als wenn<br />
aus einem Roman das Inhaltsverzeichnis<br />
herausgerissen wird. Das Buch lässt sich<br />
trotzdem lesen.<br />
„Die sicherste Alternative ist eine komplette<br />
Verschlüsselung aller sensiblen<br />
Dateien bereits in der Einsatzphase des<br />
Rechners. Dies schützt die Daten<br />
während und nach dem eigenen Betrieb.<br />
Die Sorge um ein umfassendes und verlässliches<br />
Löschen der Festplatte entfällt.<br />
Laut Prognosen des amerikanischen<br />
Marktforschungsinstituts Gartner werden<br />
in diesem Jahr weltweit rund 257 Millionen<br />
PC verkauft. Dies entspricht einem<br />
Wachstum von 11,1 Prozent im Vergleich<br />
zum Jahr 2006, in dem 231,5 Millionen<br />
PC verkauft wurden.<br />
Da für die neuen Geräte zumeist ein<br />
altes verschenkt, verkauft oder entsorgt<br />
wird, gilt: Nicht nur den Neukauf planen,<br />
sondern auch nachprüfen, ob vertrauliche<br />
Daten auf den ausrangierten<br />
Rechnern vollständig gegen unberechtigten<br />
Zugriff abgesichert sind. Selbst das<br />
Formatieren der Festplatte ist keine wirklich<br />
sichere Methode, um ungewollte<br />
Spuren zu verwischen.<br />
www.utimaco.de
Wirtschafts-Info<br />
In spätestens 15 Jahren kommen extreme Auszahlungsspitzen bei Abfertigungen<br />
Richtig vorsorgen entlastet Budgets<br />
Eine österreichweite Studie zum Thema<br />
Abfertigung für Vertragsbedienstete unter<br />
rund 500 Gemeinden ergab, dass die<br />
überwiegende Mehrzahl sich noch im<br />
Abfertigungssystem „Alt“ befindet. Weiteres<br />
wurde festgestellt, dass in den nächsten<br />
fünf bis 15 Jahren in allen untersuchten<br />
Gemeinden extreme Auszahlungsspitzen<br />
budgetwirksam werden.<br />
Diese Budgetbelastungen treffen die<br />
Gemeinden meist unvorhergesehen und<br />
ungeplant, da viele Vertragsbedienstete<br />
nicht bis zum Gesetzlichen Pensionsantrittsalter<br />
im Gemeindedienst verbleiben.<br />
Die Abfertigungsansprüche können bis<br />
zum zwölffachen des letzen Monatsentgeltes<br />
betragen. Die Studie hat gezeigt,<br />
dass es in den meisten Fällen keine budgetären<br />
Vorsorgen für diese Abfertigungsbeträge<br />
gibt. Ohne der entsprechenden<br />
Vorsorge müssen diese Abfertigungszahlungen<br />
aus dem laufenden Budget<br />
bedient werden, wodurch die einzelnen<br />
Budgets stark belastet werden.<br />
Es besteht aber schon seit längerem die<br />
Möglichkeit diese Auszahlungsspitzen mit<br />
Hilfe einer Abfertigungsrückdeckungsver-<br />
sicherung zu glätten. Bei diesem Modell<br />
werden zukünftige personenbezogene<br />
Abfertigungsansprüche zu den laufenden<br />
Personalkosten hinzugerechnet. Die so<br />
ermittelten Teilbeträge entsprechen der<br />
Die Studie hat gezeigt, dass es in den<br />
meisten Fällen keine budgetären Vorsorgen<br />
für diese Abfertigungsbeträge gibt.<br />
Kostenwahrheit und können transparent<br />
und einfach budgetiert werden.<br />
Um sich zu diesem Thema eine Übersicht<br />
verschaffen zu können, ist es sinnvoll eine<br />
individuelle Abfertigungsanalyse berechnen<br />
zu lassen. Auf Grund des Ergebnisses<br />
dieser individuellen Analyse, haben die<br />
Gemeindemandatare die Möglichkeit,<br />
eine fundierte Entscheidung zur Lösung<br />
der Abfertigungsproblematik zu treffen.<br />
GENERATION NÖ:<br />
Geborgenheit, ganz groß!<br />
Bei der Vergabe dieser Abfertigungsrückdeckungsversicherung<br />
muss dem Bundesvergabegesetz<br />
2006 entsprochen werden.<br />
Zur Festlegung des Auftragswertes<br />
(Schwellenwert) ist nach dem §16 des<br />
BVergG 2006 wie bei unbefristeten Aufträgen<br />
das 48-fache des zu leistenden<br />
Monatsengeltes an zu setzen.<br />
Folgende Vergabeverfahren können zur<br />
Anwendung kommen:<br />
◆ Bis 40.000 Euro Direktvergabe:<br />
◆ Über 40.000 Euro Ausschreibung nach<br />
dem BVergG 2006. Dazu wäre es sinnvoll<br />
sich im Vorfeld über die verschiedenen<br />
Möglichkeiten individuell beraten<br />
zu lassen.<br />
In diesem Zusammenhang hat sich<br />
gezeigt, dass eine durchschnittliche<br />
Gemeinde mit acht bis zehn Vertragsbediensteten<br />
schon über dem Schwellenwert<br />
von 40.000 Euro liegen kann und<br />
demnach eine Direktvergabe einer<br />
Abfertigungsvorsorge nicht mehr rechtmäßig<br />
ist.<br />
Analyse und Beratung unter:<br />
www.die-finanzdienstleister.at<br />
WIR HABEN<br />
NOCH VIEL VOR.<br />
Niederösterreich ist ein Land zum Wohlfühlen. Ein kräftiges Wirtschaftswachstum und so viele<br />
Arbeitsplätze wie nie zuvor schaffen die Grundlage für eine Politik, in der Menschen wichtiger als Zahlen<br />
sind. Wir investieren mehr als 950 Mio. Euro in den Ausbau und die Modernisierung unserer<br />
Krankenhäuser – kein anderes Bundesland tut so viel für die Gesundheit. Wir haben ein eigenes NÖ<br />
Pflege-Modell vorgelegt: In Niederösterreich gibt es keine Vermögensgrenze für die Förderung der<br />
24-Stunden-Betreuung. Nachbarschaftshilfe und Vereinskultur werden bei uns groß geschrieben. Und<br />
mit unserer Dorf- und Stadterneuerung sind wir europaweit Vorreiter. So sorgen wir landauf, landab<br />
dafür, dass Geborgenheit bei uns auch in Zukunft ganz groß ist. Wir haben noch viel vor!<br />
E.E.
Public Management<br />
Das kommunale Büro: Vom Amtsleiter zum Public Manager<br />
Das Unternehmen<br />
Kommunalverwaltung<br />
Österreichs Gemeinden werden immer mehr zu Dienstleistern. Das „verstaubte<br />
Amts image“ verschwindet zusehens. Aber was genau macht ein „Kommunales Büro“<br />
aus, wer sind die tragenden Figuren dahinter? Eine Betrachtung.<br />
◆ Prof. Dr. Franziska Cecon<br />
Eine Begebenheit, die sich in jedem Meldeamt<br />
zutragen könnte: Aus beruflichen<br />
Gründen sind Herr Müller und seine<br />
Familie aus Berlin nach Österreich gezogen.<br />
Eine Reihe von administrativen Erledigungen<br />
erwartet ihn nun. Sein erster<br />
Kontakt mit der örtlichen Verwaltung ist<br />
auf virtuellem Wege. Die gut strukturierte<br />
Homepage enthält zu seiner freudigen<br />
Überraschung neben den notwendigen<br />
Formularen im Download auch noch<br />
einen praktikablen Leitfaden für „Wohnsitzwechsler“.<br />
Herr Müller erlebt den persönlichen<br />
Kontakt am Meldeamt in<br />
freundlicher Atmosphäre, wo er zügig die<br />
Anmeldung erledigen kann. Solch positive<br />
Begegnungen hinterlassen zufriedene<br />
Kunden und sind Ausdruck für eine<br />
moderne und kundenorientierte öffentliche<br />
Verwaltung. In diesem Zusammenhang<br />
kommt der Amtsleitung eine tragende<br />
Rolle zu.<br />
Dienstleister statt Amt<br />
Öffentliche Verwaltungen verstehen sich<br />
heute immer mehr als Dienstleistungsun-<br />
◆ FH-Prof. Dr.<br />
Franziska Cecon ist Professorin<br />
für Public Management an der FH<br />
Kärnten in Villach<br />
52 KOMMUNAL<br />
ternehmen. Veränderte Erwartungshaltungen<br />
hinsichtlich einer leistungsfähigen<br />
Verwaltung, gesellschaftlicher Wandel,<br />
neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen,<br />
Globalisierung und die vielfältigen<br />
Möglichkeiten der Informationstechnologie<br />
hinterlassen ihre deutlichen Spuren<br />
im kommunalen Management. Zudem<br />
kommen noch ein verändertes Politikverständnis<br />
sowie eine Reihe von komplexen<br />
Fragen zu Migration und Integration oder<br />
aus dem weiten Feld der<br />
sozialen und bildungsbezogenen<br />
Themenstellungen. Hier<br />
ist dynamische Wandlungsfähigkeit<br />
gefragt.<br />
Im Bewusstsein all dieser<br />
sowohl extern als auch intern<br />
induzierten Herausforderungen<br />
(siehe Abbildung 1) – und<br />
hier wurde nur stichwortartig<br />
formuliert, was in der Praxis<br />
viel stärker vernetzt und komplexer<br />
ist – ist der Amtsleiter<br />
als Manager gefragt.<br />
Dr. Franz Sturm, Leiter der Abteilung 3 –<br />
Gemeinden im Amt der Kärntner Landesregierung,<br />
bringt dies auf den Punkt:<br />
„Eine moderne bürger- und serviceorientierte<br />
Kommunalverwaltung ist heute<br />
ohne ausgeprägte Managementqualifikationen<br />
der leitenden Gemeindebediensteten<br />
nicht mehr vorstellbar.“<br />
Was macht´ s aus?<br />
Was macht aber nun einen Amtsleiter<br />
zum „Public Manager“? Welche Qualifikationen<br />
sind es, auf die nicht mehr verzichtet<br />
werden sollte? Eine Klärungshilfe<br />
bietet der Begriff an sich. „Public“ steht<br />
für öffentlich bzw. öffentlichkeitsnah, im<br />
Gegensatz zum privatwirtschaftlichen<br />
Bereich, wo Management ursprünglich<br />
seine Wurzeln hat. „To manage“ leitet<br />
sich aus dem Englischen ab und heißt so<br />
viel wie „handhaben oder bewerkstelligen“.<br />
Konkret heißt Management, eine<br />
zielorientierte Steuerung der Organisation<br />
um die aktuellen und zukünftigen<br />
Herausforderungen zu meistern.<br />
Zielorientierte Steuerung beginnt mit<br />
Führungskräften, die sich ihrer Möglichkeiten<br />
und Freiräume bewusst sind und<br />
diese entsprechend nutzen.<br />
Voraussetzung<br />
dafür ist ein verändertes<br />
Denken, das auf Lösungen<br />
statt auf Problemen<br />
fokussiert ist.<br />
Manager entscheiden<br />
selbst, anstelle Entscheidungen<br />
an das System<br />
abzugeben, und sie<br />
übernehmen dafür Verantwortung.<br />
Das bedeutet,<br />
dass sie an den Leistungen<br />
und Wirkungen<br />
ihrer Entscheidungen gemessen werden.<br />
Damit ist nicht länger das Problem Drehund<br />
Angelpunkt, sondern die kundenorientierte,<br />
zielgerichtete Lösung.<br />
Schedler stellte dazu die entscheidende<br />
Frage: Wie können Führungskräfte, insbesondere<br />
in der öffentlichen Verwaltung,<br />
mit diesen Handlungsmöglichkeiten<br />
umgehen? Die Beantwortung dieser<br />
Frage hinsichtlich Managementqualifikationen<br />
kann mit dem Managementkreislauf<br />
schematisch dargestellt werden<br />
(Abbildung 2), der gleichzeitig mehrere<br />
Dimensionen beinhaltet. Vorweg, Kommunen<br />
agieren nicht im luftleeren<br />
Raum, sie stehen in Interdependenz mit<br />
ihren vielfältigen „Umwelten“, die nach<br />
eigenen Spielregeln organisiert sind.<br />
Öffentliche<br />
Verwaltungen<br />
verstehen sich heute<br />
immer mehr als<br />
Dienstleistungs -<br />
unternehmen.
Public Management<br />
Konkret heißt (Public–) Management,<br />
eine zielorientierte Steuerung<br />
der Organisation um die aktuellen<br />
und zukünftigen Herausforderungen<br />
zu meistern.<br />
Abbildung 1: Dynamische Umwelten<br />
und veränderte Anforderungen verlangen<br />
nach veränderte Antworten<br />
– Management ist gefragt.<br />
Abbildung 2: Managementkreislauf<br />
– Aufgaben des Managements<br />
Abbildung 3: Managementrollen<br />
nach Henry Mintzberg<br />
Planung ist<br />
Voraussetzung<br />
Dazu bedarf es einer Planung, der eine<br />
strategisch ausgerichtete Sichtweise<br />
zugrunde liegt. Welche Ziele verfolgt die<br />
Kommune, die Verwaltung, die Organisation?<br />
Wo möchten wir in fünf, zehn oder<br />
15 Jahren sein? Nicht der nächste Haushalt<br />
ist unter einer derartigen Betrachtung<br />
treibender Fokus,<br />
sondern eine nachhaltige,<br />
langfristig orien-<br />
tierte Entwicklung, die<br />
unterschiedliche Interessen<br />
wahrnimmt.<br />
Damit ändert sich der<br />
Schwerpunkt aus einer<br />
reaktiven zu einer<br />
gestaltenden Organisation.<br />
Aus der Strategie<br />
leiten sich die Ziele ab,<br />
die inhaltlich definiert<br />
und messbar gemacht<br />
werden.<br />
In der Umsetzung der Ziele gestaltet der<br />
Manager die Organisation. Der Einsatz<br />
der Ressourcen, Aktivitäten und Prozesse<br />
müssen derart gestaltet werden, dass die<br />
Zielerreichung möglichst qualitativ, effizient<br />
und effektiv erfolgen kann. Hier ist<br />
der Manager gefragt, Entscheidungen zu<br />
treffen zum Personal, Finanzen, Infrastruktur,<br />
Organisation usw. Es setzt voraus,<br />
dass er methodisches Know-how<br />
mitbringt und sich kontinuierlich weiterbildet.<br />
Die Einteilung und Verknüpfung<br />
von Aufgaben basiert auf einem Ausgleich<br />
zwischen Strategie, Struktur (Aufbau,<br />
Ablauf etc.), vorhandenen Potenzialen<br />
(wie Personal, Wissen, Informationstechnologie<br />
u.a.) und der inhärenten Kultur<br />
mit den zugrunde liegenden Anschauungen<br />
und Werten. Ein optimiertes<br />
Geschäftsprozessmanagement ist nur eine<br />
der Folgen daraus.<br />
Eine große Bedeutung kommt der Mitarbeiterführung<br />
zu. Manager müssen die<br />
Potenziale ihrer Mitarbeiter wahrnehmen<br />
Public Management<br />
und kennen. Schließlich zeichnen sich<br />
Manager durch die zunehmend wichtiger<br />
werdende soziale Kompetenz aus. Dieser<br />
Begriff beinhaltet viele Facetten, die mit<br />
unterschiedlichen Rollenanforderungen<br />
einhergehen (siehe auch Abbildung 3).<br />
Wesentlich erscheint insbesondere ein<br />
konstruktiver Umgang mit Konflikten.<br />
Widerstände und Reibungspunkte sind<br />
positives Element im Miteinander und<br />
werden als Lernchance aufgefasst. In<br />
einem derartigen Umfeld braucht es eine<br />
Kultur des Vertrauens, der Menschlichkeit<br />
und gleichzeitig eine Anpassung des<br />
Führungsverhaltens. „Taten sind besser<br />
als Worte“ unterstreicht die Bedeutung<br />
der Vorbildfunktion des Managers. Die<br />
gewünschten Werte vorleben, prägt die<br />
Kultur einer Organisation nachhaltig.<br />
Der Kreislauf schließt sich mit der Messung<br />
der Zielerreichung. Eine Zielvereinbarung<br />
erleichtert die Beurteilung. Die<br />
daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen<br />
wiederum in den Kreislauf mit ein: Falls<br />
notwendig, werden Korrekturmaßnahmen<br />
eingeleitet, Ziele hinterfragt, Entscheidungen<br />
und Prozessschritte analysiert<br />
usw. Anders<br />
ausgedrückt liefert<br />
Controlling ent-<br />
scheidungsrelevanteManagementinformationen.<br />
Zur Erfüllung all<br />
dieser Anforderungen<br />
muss ein<br />
Manager verschiedenste<br />
Rollen flexibel<br />
und situationsabhängigwahrnehmen<br />
(Abbildung 3),<br />
mit ganzheitlichem<br />
Weitblick den Herausforderungen begegnen,<br />
Offenheit für Neues mitbringen. Lernen<br />
und Weiterqualifizierung ergänzen<br />
die Erfahrung.<br />
Das „Unternehmen<br />
Kommunalverwaltung“ ist<br />
dann erfolgreich, wenn es<br />
sich dynamisch, innovativ und<br />
kontinuierlich als kompetente<br />
Serviceeinrichtung für ihre<br />
Kunden weiterentwickelt.<br />
Resümee<br />
Wie das anfängliche Beispiel gezeigt hat,<br />
ist das „Unternehmen Kommunalverwaltung“<br />
dann erfolgreich, wenn es sich kontinuierlich<br />
als kompetente Serviceeinrichtung<br />
für ihre Kunden weiterentwickelt.<br />
Dazu Mag. Elisabeth Reich, Stadtamtsleiterin<br />
in Landeck: „Lösungsorientiertes<br />
Denken und Handeln, betriebswirtschaftliches<br />
Verständnis sowie ein hohes Maß<br />
an sozialen Kompetenzen sind notwendige<br />
Voraussetzungen.“<br />
Mehr über den Studiengang<br />
Public Management an der Fachhochschule<br />
Kärnten in Villach auf<br />
www.fh-kaernten.at<br />
KOMMUNAL 53
Die für Gemeinden mögliche Ausbildungsplätze können sein: Verwaltungsassistenten, Lehrlinge im Fuhrpark bezihungsweise.<br />
Bauhof – und vieles mehr.<br />
Dauerbrenner „Lehrlinge im kommunalen Bereich“<br />
Mehr Lehrplätze für<br />
unsere Jugendlichen<br />
Immer mehr Gemeinden bilden Lehrlinge aus. KOMMUNAL bat den Regierungsbeauftragten<br />
für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung, KR Egon Blum, zum Interview<br />
und fragte, wie der Bund die Gemeinden dabei unterstützen kann.<br />
Was geschieht gerade, wo stehen wir?<br />
Die Qualifikation unserer Jugend<br />
umfasst zwei Themenbereiche:<br />
Zum einen die Zielgruppe von Jugendlichen,<br />
die lernleistungsstark und lernmo-<br />
»<br />
Um Jugendlichen eine<br />
auf Eignung und Neigung<br />
passende Ausbildung<br />
anbieten zu können, sind<br />
neben Unternehmern<br />
auch Länder und<br />
Gemeinden aufgerufen,<br />
Lehrplätze anzubieten.<br />
Egon Blum<br />
klärt Möglichkeiten<br />
tiviert sind. Sie erlangen, je nach Eignung<br />
und Neigung und Lernfähigkeit,<br />
die seitens der Wirtschaft hoch geschätzten<br />
Qualifikationen – Kompetenzen ent-<br />
54 KOMMUNAL<br />
«<br />
weder über die schulische Ausbildungsschiene<br />
oder über die duale Ausbildung.<br />
Zum anderen gibt es die Zielgruppe<br />
jener Jugendlichen, die ihr Fähigkeitspotential,<br />
je nach Eignung und Neigung,<br />
nur mit Nachsicht, Einfühlungsvermögen<br />
oder sonderpädagogischen Maßnahmen<br />
seitens von Unternehmen oder überbetrieblichen<br />
Ausbildungsstätten zur Wirkung<br />
bringen können.<br />
Welche Schwerpunkte sollten gesetzt<br />
werden?<br />
In Österreich erlangen rund zwei Fünftel<br />
der Jugendlichen ihre berufliche Erstausbildung<br />
über die Lehre. Obwohl in den<br />
letzten Jahren die Anzahl der Lehrstellen<br />
um mehrere tausend Plätze gesteigert<br />
werden konnte, ist nach wie vor ein<br />
Mangel an Ausbildungsplätzen festzustellen.<br />
Eine erkleckliche Anzahl von<br />
Jugendlichen ist trotzdem angewiesen,<br />
auf Qualifizierungsmaßnahmen auszuweichen,<br />
die außerhalb der betrieblichen<br />
und schulischen Ausbildung stehen.<br />
Es muss im Interesse unserer Gesellschaft<br />
und insbesondere der Politik liegen, für<br />
eine ausreichende Kapazitätsaufstockung<br />
von überbetrieblichen Ausbildungsplätzen<br />
zu sorgen, damit vor allem die lernschwächeren<br />
Jugendlichen zu einem<br />
zukunftsorientierten Ausbildungsplatz<br />
kommen.<br />
Um lernstarke Jugendliche für die Lehre<br />
begeistern zu können, muss mehr für das<br />
Image der Facharbeit getan werden. Ein<br />
Lösungsansatz dazu ist die Ausbildungskombination<br />
Lehre und Matura. Dieser<br />
zukunftsweisende Qualifikationsmix ist<br />
in der Öffentlichkeit bedauerlicherweise<br />
noch zu wenig publik. Auch die Aufwertung<br />
der gesellschaftlichen Einstufung<br />
der Facharbeit durch das „Angestelltenverhältnis<br />
für qualifizierte Fachkräfte “<br />
würde der Sache enorm Vorschub leisten.<br />
Warum Lehrlingsausbildung im kommunalen<br />
Bereich?<br />
Um Jugendlichen eine auf Eignung und<br />
Neigung passende Ausbildung anbieten<br />
zu können, sind neben den Unterneh-
mern auch Länder und Gemeinden aufgerufen,<br />
Lehrplätze anzubieten. Das Maß<br />
des Ausbildungsengagements seitens der<br />
Länder und Gemeinden widerspiegelt<br />
letztlich die Identifikation der politisch<br />
Verantwortlichen gegenüber jenem Personenkreis,<br />
die Gefahr laufen, in der<br />
beruflichen Ausbildung auf der Strecke<br />
zu bleiben.<br />
Es ist demzufolge nachvollziehbar, dass<br />
wir auch an die Gemeinden appellieren,<br />
Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz<br />
bekommen, in Erfahrung zu bringen, um<br />
ihnen ein Lehrstellenangebot machen zu<br />
können. Die für Gemeinden mögliche<br />
Ausbildungsplätze können sein: Verwal-<br />
»<br />
Die im Zusammenhang mit<br />
dem Ausbildungs -<br />
engagement erforderlichen<br />
Mittel stehen aus<br />
meiner Sicht in keiner<br />
Relation zu jenen Kosten,<br />
die entstehen, wenn wir<br />
die Jugendlichen nicht<br />
rechtzeitig fördern.<br />
«<br />
... über die tiefere Bedeutung der Lehre<br />
tungsassistenten, Lehrlinge im Fuhrpark<br />
bzw. Bauhof – und vieles mehr.<br />
Die im Zusammenhang mit dem Ausbildungsengagement<br />
erforderlichen Mittel<br />
stehen aus meiner Sicht in keiner Relation<br />
zu jenen Kosten, die entstehen,<br />
wenn wir die Jugendlichen nicht rechtzeitig<br />
fördern.<br />
Information<br />
Auch Länder und Gemeinden<br />
haben Anspruch auf den „Blum-<br />
Bonus“ (für das erste Lehrjahr<br />
400 Euro, 200 Euro im zweiten<br />
und 100 Euro im dritten<br />
(jeweils monatlich pro Lehrling)<br />
für jene Lehrstellen haben, die<br />
zusätzlich geschaffen werden.<br />
Nähere Informationen zur Lehrlingsoffensive<br />
der Bundesregierung<br />
erfahren Sie unter<br />
www.egon-blum.at<br />
Mediation als Konfliktlösungsinstrument in der<br />
Kommune setzt sich durch<br />
Bei Konflikten in der<br />
Gemeinde<br />
Die Aufgaben der Gemeinden haben<br />
sich in den letzten Jahren, was Komplexität,<br />
Umfang und auch Konfliktträchtigkeit<br />
betrifft, bedeutend erweitert.<br />
Erfolgreiches Konfliktmanagement ist<br />
eine gefragte Schlüsselqualifikation im<br />
kommunalen Alltag.<br />
Ob Widmungsfragen, größere Bauprojekte,<br />
Platz- und Straßengestaltung, Verkehrsfragen,<br />
Lärm- und Emissionsthemen,<br />
Nachbarschaftsstreitigkeiten etc.,<br />
es geht darum, unterschiedliche Interessen<br />
und Sichtweisen zu berücksichtigen<br />
und eine Konsenslösung zustande zu<br />
bringen.<br />
Hier zeigt sich das Potential der Mediation.<br />
Es geht darum, die Betroffenen zu<br />
Beteiligten zu machen und ihnen zu helfen,<br />
die Lösungssuche gemeinsam zu<br />
organisieren. Die Mediatorin/ der<br />
Mediator ist weder Richter noch Fachexperte,<br />
sondern Verfahrenshelfer/in,<br />
die/der allparteilich und professionell<br />
die Betroffenen bei ihrer Lösungssuche<br />
unterstützt.<br />
Bürger und Gemeindevertreter können<br />
schon im Vorfeld eines eventuellen<br />
Behördenverfahrens ihre Wünsche, Ängste<br />
und Ideen in die Planungsarbeiten<br />
einbringen. Bürger/innen übernehmen<br />
im Mediationsverfahren Verantwortung<br />
für ihre Gemeinde. Zusätzlich stärkt es<br />
die Identifikation mit der eigenen<br />
Gemeinde.<br />
Das WIFI bietet die Ausbildung zum/zur<br />
Mediator/in an:<br />
der Mediationslehrgang dauert 3 Semester,<br />
beinhaltet sowohl einen theoreti-<br />
»<br />
Wirtschafts-Info<br />
schen als auch einen anwendungsorientierten<br />
Teil und findet vorwiegend<br />
berufsbegleitend statt. Die Dauer richtet<br />
sich individuell nach den Anrechnungsmöglichkeiten<br />
aus dem Grundberuf und<br />
ist auf die Erfordernisse für die Eintragung<br />
in die Liste der Mediatoren und<br />
Die Methoden der Mediation<br />
stellen in der modernen<br />
Gemeindeverwaltung ein<br />
effektives, faires und zeitsparendes<br />
Instrumentarium<br />
zur konstruktiven Konflikt -<br />
bewältigung dar.<br />
Bernhard Scharmer<br />
Amtsleiter der Marktgemeinde Telfs<br />
Mediatorinnen beim Bundesministerium<br />
für Justiz abgestimmt. Informieren Sie<br />
sich jetzt unter www.wifi.at<br />
Information<br />
«<br />
Wirtschaftsförderungsinstitut<br />
der Wirtschaftskammer Österreich<br />
WIFI Netzwerk; Wiedner Hauptstraße<br />
63, 1045 Wien<br />
Tel.: +43 (0)5 90 900-3105<br />
Fax: +43 (0)5 90 900-113105<br />
E-Mail: margit.havlik@wko.at<br />
Web: www.wifi.at<br />
KOMMUNAL 55<br />
E.E.
Gesundheits-Info<br />
Innovatives Behandlungsprogramm hilft bei Diabetes<br />
Das „süße“ Leben<br />
kann gefährlich sein<br />
Die österreichische Sozialversicherung sagt der Volkskrankheit Nr. 1 – Diabetes mellitus<br />
Typ-2 – den Kampf an und startet in einigen Bundesländern das Disease Management<br />
Programm „Therapie Aktiv-Diabetes im Griff“.<br />
Diabetes ist eine Volkskrankheit, die<br />
sich in unserer Wohlstandsgesellschaft<br />
äusserst dynamisch entwickelt. Über<br />
350.000 ÖsterreicherInnen sind nach<br />
vorsichtigen Schätzungen bereits<br />
zuckerkrank. Der<br />
Großteil davon leidet<br />
an so genann-<br />
tem Typ-2 Diabetes,<br />
dem Erwachsenen-<br />
bzw. Alters-<br />
Diabetes.<br />
Gefürchtet sind<br />
neben der Erkrankung<br />
selbst vor<br />
allem die Sekundärerkrankungen:<br />
Gefäßschäden,<br />
Augenschäden,<br />
diabetischer Fuß<br />
etc. Die Kombination<br />
aus wenig<br />
Bewegung und<br />
Übergewicht lässt<br />
eine starke<br />
Zunahme der Neuerkrankungen<br />
befürchten. Diabetes ist<br />
dabei nicht nur eine Alterserkrankung,<br />
zunehmend sind alle Altersklassen von<br />
dieser Volkskrankheit betroffen. Abgesehen<br />
von der zunehmendem Ausbreitung<br />
von Diabetes bei Kindern verschärft<br />
auch die demografische Entwicklung<br />
der österreichischen Bevölkerung<br />
aufgrund der hohen Betroffenheit<br />
bei älteren Menschen dieses Problem<br />
zusehends.<br />
Die rasche Zunahme an Typ-2-DiabetikerInnen<br />
bedeutet neben persönlichem<br />
Leid enorme Kosten für das Gesundheitssystem.<br />
Das muss nicht sein:<br />
Durch rechtzeitig beginnende und kontinuierliche<br />
ärztliche Betreuung lassen<br />
sich die Spätfolgen der Zuckerkrankheit<br />
hintanhalten oder sogar ganz vermeiden.<br />
56 KOMMUNAL<br />
Die Teilnahme an<br />
„Therapie Aktiv“ erfolgt<br />
für Arzt und Patient<br />
freiwillig. Interessierte<br />
Personen mit der<br />
Diagnose Diabetes<br />
mellitus Typ 2 können<br />
sich bei einem eigens für<br />
„Therapie Aktiv“<br />
geschulten Arzt in das<br />
Programm einschreiben.<br />
Eine wichtige Maßnahme ist die<br />
Prävention im Rahmen der neuen Vorsorgeuntersuchung,<br />
wo dem wachsenden<br />
Problem Diabetes große Bedeutung<br />
beigemessen wird. Kern des neuen Vorsorgeprogramms<br />
der<br />
sozialen Krankenversicherung,<br />
welches bereits<br />
seit Anfang 2006 umgesetzt<br />
wird, sind definierte<br />
Vorsorgeziele,<br />
unter anderem auch<br />
Diabetes mellitus sowie<br />
Adipositas und Übergewicht.<br />
Dabei wird für<br />
jeden Probanden ein<br />
eigenes Risikoprofil<br />
erstellt. Neben einer<br />
Familienanamnese wird<br />
der BMI (body mass<br />
index) errechnet und<br />
eine Blutzuckermessung<br />
vorgenommen. Risikofaktoren<br />
für Diabetes<br />
wie Rauchen, übermäßigerAlkoholkonsum,<br />
wenig Bewegung,<br />
schlechte Ernährung und<br />
Übergewicht sind Teil der<br />
neuen Vorsorgeuntersuchung.<br />
Das Thema ist<br />
Lebensstilveränderung.<br />
Auch bei Diabetes Typ-2<br />
folgt die Sozialversicherung<br />
ihrer strategischen Positionierung<br />
„Länger leben bei<br />
guter Gesundheit“. Um dieses<br />
Ziel für die Menschen in<br />
Österreich zu erreichen,<br />
setzt die Sozialversicherung<br />
zum einen auf die konsequente<br />
Verstärkung von<br />
Gesundheitsförderung und<br />
Prävention, zum anderen auf die beste<br />
medizinische Betreuung von PatientInnen.<br />
Im Rahmen der Innovationsprojekte<br />
des Hauptverbandes der österreichischen<br />
Sozialversicherungsträger wurde<br />
von der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse<br />
ein innovatives Behandlungsprogramm<br />
für Typ-2-DiabetikerInnen<br />
unter dem Namen „Therapie Aktiv –<br />
Diabetes im Griff“ entwickelt.<br />
Primarius Dr. Gert Klima, ärztlicher Leiter<br />
der steiermärkischen Gebietskrankenkasse:<br />
„Gerade bei Diabetes ist es<br />
wichtig, dass der Arzt nach der Diagnose<br />
den Patienten über seine Krankheit<br />
aufklärt, ihn umfassend untersucht<br />
und die richtige Behandlung einleitet,<br />
um Folgeschäden zu vermeiden“.<br />
Die Teilnahme an „Therapie Aktiv“<br />
erfolgt für Arzt und Patient freiwillig.<br />
Interessierte Personen mit der Diagnose<br />
Diabetes mellitus Typ 2 können sich bei<br />
einem eigens für „Therapie Aktiv“<br />
geschulten Arzt in das Programm einschreiben.<br />
Niedergelassene Ärzte für<br />
Allgemeinmedizin sowie Fachärzte für<br />
Innere Medizin können nach erfolgter<br />
Basisschulung als<br />
„DMP-Ärzte“ tätig<br />
sein. Die Bindung<br />
zwischen Diabetiker<br />
und Vertrauensarztunterstützt<br />
dabei die<br />
Langzeitbetreuung<br />
für den<br />
betroffenen Teilnehmer.<br />
Das neue Disease<br />
Management Programm<br />
(DMP) für<br />
Diabetes Typ-2<br />
bietet betroffenen<br />
Menschen eine<br />
auf individuelle<br />
Erfordernisse zugeschnittene Therapie<br />
auf höchstem medizinischen Niveau.<br />
Unter aktiver Einbindung der PatientIn-<br />
Das neue Disease<br />
Management Programm<br />
(DMP) für Diabetes<br />
Typ-2 bietet betroffenen<br />
Menschen eine auf<br />
individuelle Erfordernisse<br />
zugeschnittene<br />
Therapie auf höchstem<br />
medizinischen Niveau.
Für jeden Probanden ein eigenes Risikoprofil: Neben einer Familienanamnese wird der<br />
BMI (body mass index) errechnet und eine Blutzuckermessung vorgenommen. Risikofaktoren<br />
für Diabetes wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, wenig Bewegung,<br />
schlechte Ernährung und Übergewicht sind Teil der neuen Vorsorgeuntersuchung.<br />
nen werden mögliche Folgeschäden<br />
von Diabetes Typ-2 verhindert oder<br />
zumindest verzögert und eine massive<br />
Steigerung von Lebensqualität und<br />
Wohlbefinden erreicht.<br />
Diabetes mellitus Typ-2<br />
Diabetes Typ-2 ist eine Stoffwechselstörung,<br />
bei der die Regulation des körpereigenen<br />
Insulins nicht mehr richtig<br />
funktioniert. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel<br />
mit einer Reihe von möglichen<br />
Folgeschäden wie Herzinfarkte,<br />
Schlaganfälle, Erblindungen, Beinamputationen<br />
oder Dialyse ist die Folge.<br />
Potentielles Risiko für Typ-2-DiabetikerInnen:<br />
◆ zweimal häufiger Bluthochdruck<br />
◆ zweimal häufiger Herz-Kreislauferkrankungen<br />
◆ zwei bis sechsmal häufiger pAVK<br />
(periphere arterielle Verschlusskrankheiten)<br />
◆ vier bis zehnmal häufiger Schlag -<br />
anfälle<br />
◆ 30-mal häufiger Amputationen<br />
„DMP – Therapie Aktiv – Diabetes im<br />
Griff“<br />
Disease Management (DM) ist ein systematischer<br />
Behandlungsansatz mit dem<br />
Ziel, für chronisch Kranke eine kontinuierliche<br />
und qualitativ hochwertige Versorgung<br />
nach dem neuesten Stand der<br />
Wissenschaft zu organisieren.<br />
Das Behandlungsprogramm für Typ-2-<br />
DiabetikerInnen wurde von der Steiermärkischen<br />
Gebietskrankenkasse<br />
(STGKK) im Auftrag des Hauptverbandes<br />
der österreichischen Sozialversicherungsträger<br />
entwickelt. Die Teilnahme<br />
am Programm erfolgt für ÄrztInnen und<br />
PatientInnen freiwillig. Primäres Ziel ist<br />
die Verbesserung der Lebensqualität der<br />
teilnehmenden PatientInnen und die<br />
Vermeidung oder zumindest Hinauszögerung<br />
von Folgekomplikationen<br />
Basiselemente des „DMP – Therapie<br />
Aktiv“<br />
◆ Prävention und Gesundheitsförderung<br />
◆ strukturierte Erkennung und Behandlung<br />
auf hohem medizinischen Niveau<br />
◆ stärkere Einbindung der PatientInnen<br />
in den Behandlungsprozess<br />
◆ gemeinsame Zielvereinbarung zwischen<br />
PatientIn und ÄrztIn (z.B.<br />
Gewichtsreduktion, mehr Bewegung)<br />
◆ Langzeitbetreuung und Schulung der<br />
PatientInnen<br />
◆ Fortbildung von ÄrztInnen und DiabetesberaterInnen<br />
◆ Stärkung der Hausarztbindung als<br />
Lebensbetreuungsarzt<br />
◆ langfristiger Therapieansatz<br />
◆ Qualitätsmanagement, Evaluation<br />
◆ ökonomischer Einsatz der Mittel, verminderte<br />
stationäre Aufenthalte<br />
Vorteile für betroffene PatientInnen:<br />
◆ eigens für „Therapie Aktiv“ geschulte<br />
ÄrztInnen (InternistInnen und<br />
AllgemeinmedizinerInnen)<br />
◆ intensive Betreuung durch<br />
Hausärzt Innen<br />
◆ mehr Wissen über die eigene Erkrankung<br />
◆ spezielle Schulungen für den Umgang<br />
mit der eigenen Erkrankung<br />
◆ Verhinderung von Folge- und Spätschäden<br />
Roll Out „DMP – Therapie Aktiv“<br />
Nachdem das Programm im Februar<br />
2007 in ausgesuchten Testregionen in<br />
der Steiermark und Niederösterreich<br />
gestartet wurde, wird der Roll Out in<br />
den restlichen Bundesländern im Laufe<br />
des Jahres durchgeführt. Insbesondere<br />
in Oberösterreich und dem Burgenland<br />
werden bestehende Programme der<br />
Gesundheits-Info<br />
strukturierten Diabetes Typ-2-Behandlung<br />
in das österreichweit einheitliche<br />
„DMP – Therapie Aktiv“ überführt.<br />
Derzeit nehmen rund 5800 PatientInnen<br />
sowie rund 600 ÄrztInnen an Diabetesbetreuungsprogrammen<br />
teil. Ziel des<br />
Hauptverbandes sind österreichweit<br />
11.000 eingeschriebene PatientInnen bis<br />
Ende 2007.<br />
Information<br />
Weitere Informationen zum Diabetes-Programm<br />
„Therapie Aktiv“<br />
(www.therapie-aktiv.at) erhalten<br />
Sie bei ihren Krankenkassen<br />
Gebietskrankenkasse Kärnten:<br />
Monika Hasenbichler,<br />
Monika.Hasenbichler@kgkk.at<br />
Gebietskrankenkasse Tirol:<br />
Dr. Arno Melitopulos,<br />
arno.melitopulos@tgkk.at<br />
Gebietskrankenkasse Vorarlberg:<br />
Gerhard Vetter,<br />
gerhard.vetter@vgkk.sozvers.at<br />
Gebietskrankenkasse Burgenland:<br />
Dir. Mag. Christian Moder,<br />
christian.moder@bgkk.at<br />
Gebietskrankenkasse OÖ:<br />
Dr. Heide Said,<br />
heide.said@ooegkk.at<br />
Gebietskrankenkasse NÖ:<br />
Dir. Dr. Martina Amler,<br />
martina.amler@noegkk.at<br />
Wiener Gebietskrankenkasse:<br />
Fr. Eva-Maria Baumer,<br />
eva-maria.baumer@wgkk.at<br />
Gebietskrankenkasse Salzburg:<br />
Mag. Marlies Dicklberger,<br />
marlies.dicklberger@sgkk.at<br />
Gebietskrankenkasse Steiermark:<br />
DI Fritz Bruner,<br />
fritz.bruner@stgkk.at<br />
Vorsorge:<br />
www.sozialversicherung.at<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Die TETRON Sicherheitsnetz<br />
Errichtungs- und BetriebsgmbH<br />
setzt seit September 2004 das<br />
Infrastrukturprojekt „Digitalfunk<br />
BOS-Austria“ um. Dieses österreichweite<br />
Funknetz für alle<br />
BOS basiert auf dem leistungsstarken<br />
TETRA Standard.<br />
Funkstandard erleichtert Koordination von Blaulichtorganisationen<br />
Digitale Kommunikation<br />
rettet Leben<br />
Vor einem Jahr wurde bei der Kommunalmesse in Wien der neue digitale Funkstandard<br />
TETRA und das Infrastrukturprojekt „Digitalfunk BOS-Austria“ präsentiert. Heute kann<br />
bereits über konkrete Einsatzmaßnahmen von TETRA berichtet werden.<br />
Das Bundesministerium für Inneres<br />
(BM.I) implementierte im Sommer 2004<br />
das Infrastrukturprojekt „Digitalfunk<br />
BOS-Austria“ mit dem Ziel, die Einsatz-<br />
Kommunikation der Blaulichtorganisationen<br />
– das sind im wesentlichen Polizei,<br />
Rettung und Feuerwehr – in allen<br />
Bundesländern auf den digitalen Bündelfunk<br />
umzustellen. Das TETRA-Funk -<br />
netz bietet allen „Behörden und Organisationen<br />
mit Sicherheitsaufgaben“<br />
(BOS) die Möglichkeit, direkt miteinander<br />
zu kommunizieren, was speziell in<br />
Krisensituationen einen lebensrettenden<br />
Vorsprung bedeuten kann.<br />
Die digitale Technologie von TETRA<br />
zeichnet sich gegenüber dem analogen<br />
System unter anderem durch einen<br />
schnellerer Verbindungsaufbau sowie<br />
eine exzellente Sprachqualität aus.<br />
Außerdem können alle Blaulichtorganisationen<br />
im selben Funknetz direkt<br />
kommunizieren und dadurch ihre Arbeit<br />
situativ koordinieren. Auch die Freiwilligen<br />
Feuerwehren in den Gemeinden<br />
profitieren vom neuen Funknetz: Das<br />
nach Gruppen orientierte Funksystem ist<br />
flexibler als das analoge System.<br />
Die TETRON GmbH wird durch ein so<br />
genanntes Projektfinanzierungsmodell<br />
unter Berücksichtigung von vertraglich<br />
definierten Beistellungen (z.B. Stand -<br />
orte) von deren Gesellschaftern,<br />
58 KOMMUNAL<br />
Motorola und Alcatel-Lucent, und einem<br />
Bankenkonsortium finanziert. Das Länderbeteiligungsmodell<br />
sieht die entgeltfreie<br />
Nutzung des Funkdienstes für die<br />
Länderorganisationen im Gegenzug zur<br />
Beistellung der Basisstationsstandorte<br />
im jeweiligen Bundesland vor.<br />
Ausbau und<br />
Einsatzgebiete<br />
In Wien und Tirol ist TETRA bereits seit<br />
1. Jänner 2006 im praktischen Einsatz.<br />
Bei diversen Großveranstaltungen – sei<br />
es von der EU-Präsidentschaft über das<br />
Hahnenkammrennen bis zum Donausinselfest<br />
– hat sich das neue Funksystem<br />
bereits bewährt. In der Steiermark<br />
und in Niederösterreich befindet sich<br />
der digitale Funkstandard derzeit im<br />
Ausbau. Wobei in Niederösterreich<br />
anlässlich des Papstbesuches bereits<br />
heuer die ersten Basisstationen fertig<br />
gestellt und aktiviert werden.<br />
Papst und EURO 2008<br />
Auch bei den kommenden Großereignissen<br />
wird TETRA der verwendete<br />
Funkstandard für alle eingesetzten<br />
Blaulichtorganisationen sein. So wird<br />
etwa beim Papstbesuch im September<br />
dieses Jahres die Kommunikation nach<br />
Heiligenkreuz mit TETRA erfolgen.<br />
Fünf Basisstationen werden hierfür vorzeitig<br />
in Betrieb genommen, um eine<br />
entsprechend lückenlose Funkversorgung<br />
während des Aufenthaltes von<br />
Benedikt XVI. zu gewährleisten.<br />
Auch bei der nächsten sportlichen<br />
Großveranstaltung in Österreich<br />
kommt die Hilfe digital: Während der<br />
Fußball Europameisterschaft 2008 –<br />
dem drittgrößten Sportevent weltweit –<br />
werden neben den Standorten Wien<br />
und Innsbruck auch die Stadt Salzburg<br />
und das EM-Stadion in Wals-Siezenheim<br />
an das digitale Funknetz angeschlossen<br />
sein. Die digitale Kommunikationstechnologie<br />
von TETRON<br />
ermöglicht eine reibungslose Kommunikation<br />
der Veranstaltung seitens der<br />
teilnehmenden Blaulichtorganisationen.<br />
Die Vorbereitungen dazu laufen<br />
bereits auf Hochtouren.<br />
Information<br />
Tetron Sicherheitsnetz<br />
Errichtungs- und BetriebsgmbH<br />
Tel.: 01/815 14 13-0<br />
E-Mail: office@tetron.at<br />
www.tetron.at
Wirtschafts-Info<br />
Energieeffizientes Bauen und Sanieren mit Raiffeisen<br />
Synergien nutzen ist Gebot der Stunde<br />
In Zeiten des ökologischen Wandels<br />
sowie der immer schwierigeren Finanzlage<br />
der Kommunen ist es geradzu eine<br />
Herausforderung für die innovative Raiffeisen-Leasing<br />
Folgendes anzubieten:<br />
Ein Produkt, welches sowohl die immer<br />
stärker in den Vordergrund tretenden<br />
ökologischen Gesichtspunkte und die<br />
Ein Musterbeispiel für energieeffizientes Bauen ist die<br />
Volksschule Sittendorf in Niederösterreich.<br />
laufenden Betriebskosten berücksichtigt,<br />
als auch eine Lösung für die Finanzierung<br />
bietet. Energieeffizientes Bauen<br />
und Sanieren stellt diese Synergie zwischen<br />
Ökologie und Ökonomie dar.<br />
Durch die gesamthafte Betrachtung von<br />
◆ Architektur,<br />
◆ Hoch- und Tiefbau,<br />
◆ Heizung, Lüftung, Sanitär,<br />
◆ Mess-, Steuer- und Regeltechnik,<br />
◆ Wasser und Abwasser,<br />
◆ Energieeinsparung sowie<br />
◆ Finanzierung<br />
besteht die Möglichkeit eine wesentliche<br />
Effizienzsteigerung herbeizuführen.<br />
Um eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit<br />
einer Investition machen zu können,<br />
ist es erforderlich, die Kosten für die<br />
gesamte Lebensdauer der Immobilie zu<br />
betrachten. Die kumulierten Betriebskosten<br />
können bereits nach wenigen Jahren<br />
die Neubau- bzw. Sanierungskosten<br />
überschreiten und so einen<br />
wesentlichen Faktor in der<br />
Gesamtkostenbetrachtung<br />
(Investitions- und Betriebskosten)<br />
darstellen. Durch<br />
diesen Ansatz werden<br />
sowohl die Kosten der<br />
Errichtung/Sanierung als<br />
auch die laufenden Kosten<br />
über die gesamte Lebensdauer<br />
nachhaltig gesenkt<br />
sowie Synergien durch<br />
reduzierte Schnittstellen<br />
genutzt.<br />
Die durch die Ausschreibung<br />
verbindlich anzubietende<br />
Garantie für die Investitionskosten<br />
sowie für den zu erwartenden<br />
Energiebedarf stellen die Basis für die<br />
Gesamtkostenoptimierung einer Liegenschaft<br />
dar. Größtmögliche Effizienz in<br />
der Investitionsphase als auch im Betrieb<br />
der Gebäude ist somit sichergestellt.<br />
Ergänzend dazu besteht für die Gemeinden<br />
die Möglichkeit rechtskonform die<br />
heimische Wirtschaft zu stärken.<br />
Der Nutzen und die damit verbundenen<br />
Vorteile der energieeffizienten<br />
Sanierung stellen sich demnach wie<br />
folgt dar:<br />
◆ Gesamtkosteneinsparung<br />
◆ Vertraglich fix garantierte Energie -<br />
einsparung / Energieverbrauch<br />
◆ Garantierte Pauschal-Investitionssumme<br />
◆ Minimaler Eigenaufwand– ermöglicht<br />
durch einen kompetenten Ansprechpartner<br />
(keine Schnittstellen)<br />
◆ Maastrichtkonforme Finanzierung<br />
◆ Unterstützung und Schulung des<br />
Eigenpersonals<br />
◆ Möglicher USt-Vorteil<br />
◆ Zusätzliche Fördermöglichkeiten (da<br />
Energieeinsparungsgarantie)<br />
◆ Eine durchgängige energiebewusste<br />
Planung<br />
◆ Maßnahmenumsetzung mit Wirtschaftstreibenden<br />
vor Ort<br />
◆ Nachhaltig gesenkte Betriebskosten<br />
über 30 Jahre<br />
◆ Reduktion der CO2-Emmission<br />
◆ Steigerung der Behaglichkeit durch<br />
verbesserte Raumkonditionen.<br />
Information<br />
Raiffeisen-Leasing GmbH<br />
Mag. Kathrin Moser<br />
Tel: 01/71601-8066<br />
E-Mail: kathrin.moser@rl.co.at<br />
Web: www.raiffeisen-leasing.at<br />
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien<br />
Mag. Alfred Greimel<br />
Tel: 05/1700-92944<br />
E-Mail: office.kui@raiffeisenbank.at<br />
Web: www.rlbnoew.at<br />
KOMMUNAL 59<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Der neue Renault Master<br />
bietet Komfort und höchstes<br />
Sicherheitsniveau<br />
sowie eine der besten<br />
Nutzlasten auf dem Markt<br />
RENAULT Trucks: Spezialisten leisten mehr<br />
Ideal für jeden Job<br />
Mit den Modellen RENAULT Master, Maxity und Mascott bietet RENAULT TRUCKS Österreich<br />
eine Vielfalt an Möglichkeiten, die den kommunalen Nutzfahrzeugbereich von<br />
2,8 bis 6,5 Tonnen optimal abdecken.<br />
RENAULT Master – der<br />
Komfortable<br />
Ausgestattet mit neuem Motor in drei<br />
Leistungsklassen (100 PS/74kW, 120<br />
PS/88kW, 150 PS/107kW), einem<br />
neuen serienmäßigen 6-Gang Getriebe<br />
(optional auch als automatisierte Version<br />
Quickshift) sowie neuem Außendesign<br />
und neuer Innenausstattung für noch<br />
bessere Funktionalität, bietet der neue<br />
Renault Master Komfort und ein Sicherheitsniveau,<br />
das ganz auf den professionellen<br />
Einsatz zugeschnitten ist.<br />
Der neue Master bietet immer noch eine<br />
Mit einer Nutzlast von 1820 Kilo, dem<br />
geringen Kraftstoffverbrauch und den<br />
reduzierten Betriebskosten gehört der<br />
Maxity in Sachen Rentabilität zu den<br />
Besten seiner Kategorie.<br />
60 KOMMUNAL<br />
der besten Nutzlasten auf dem Markt<br />
(1675 Kilo) sowie die niedrigste Ladekante<br />
(573 mm). Ebenso verfügt er mit<br />
seinen Scheibenbremsen und seinem<br />
lastabhängigen ESP über Sicherheitsausstattung<br />
auf höchstem Niveau. Mit seiner<br />
Konzeption sowohl für den geschlossenen<br />
(Kastenwagen), wie auch für den<br />
offenen Warentransport (Pritsche und<br />
Kipppritsche) sowie für die Personenbeförderung<br />
(Kombi, Bus und Minibus) bietet<br />
der neue Master eine große Vielfalt an<br />
Aufbauvarianten. Ob als Plattform-Fahrerhaus<br />
oder als Fahrgestell, mit Einzeloder<br />
Doppelkabine – der neue Master<br />
ermöglicht eine Lösung nach Maß für<br />
jeden Kunden, für Transportprofis gleichermaßen,<br />
wie für private Nutzer.<br />
RENAULT Maxity – der<br />
Wendige<br />
Der Maxity, ein leichtes Fahrzeug in<br />
Frontlenkerausführung, ist ein Konzentrat<br />
an Kompaktheit, Manövrierbarkeit<br />
und Nutzlast, das Ganze mit einem<br />
innovativen Design, sowohl außen wie<br />
innen, und einer verstärkten Sicherheit.<br />
Seine Breite (1,87 m) und seine geringere<br />
Gesamtlänge dank der Frontlenker-<br />
Architektur machen ihn zu einem leicht<br />
manövrierbaren Fahrzeug. Mit einem<br />
Wenderadius von 4,8 m zwischen Trottoirs<br />
beim kürzesten Radstand (2500<br />
mm) besitzt der Maxity den kleinsten<br />
Radius in seiner Kategorie.<br />
Der Maxity ist rentabel. Mit seiner Nutzlast<br />
von 1820 Kilo, dem geringen Kraftstoffverbrauch<br />
und den reduzierten<br />
Betriebskosten gehört er auch in Sachen<br />
Rentabilität zu den Besten seiner Kategorie.<br />
Der Maxity ist mit zwei Motoren und in<br />
drei Leistungsstärken erhältlich: 110, 130<br />
und 150 PS und dies in zwei Ge triebe -<br />
varianten mit fünf bzw. sechs Gängen, je<br />
nach Motorisierung und Einsatzbereich.<br />
Er verfügt über eine echte Lkw-Struktur.<br />
Seine Bauweise auf der Basis eines Fahrgestells<br />
mit Längsträgern ist Gewähr für<br />
Robustheit leichte Überbaubarkeit.<br />
RENAULT Mascott – der<br />
Robuste<br />
Der Mascott ist ein echter Lastkraftwagen,<br />
der mit einem Gewicht von 3,5 - 6,5<br />
Tonnen verfügbar ist. Der neue Motor<br />
DXi 3 mit einem ausgezeichneten Kompromiss<br />
zwischen Drehmoment und Leistung<br />
bringt 130 PS (300 Nm, 95 kW bei<br />
3600 U/min) oder 150 PS (350 Nm, 110<br />
kW bei 3 600 U/min) auf die Straße. Er<br />
ist mit einer neuen Common-Rail-Hochdruck-Einspritzung<br />
ausgestattet. Der Mascott<br />
ist mit einem 6-Gang-Getriebe und<br />
einer verstärkten Kupplung ausgestattet.<br />
Er ist im Hinblick auf die Wartungsintervalle<br />
der beste seiner Kategorie.<br />
Die neue Hinterachse toleriert eine maximale<br />
Last von 3520 Kilo beziehungsweise<br />
4720 Kilo, je nach Tonnagebereich des<br />
Fahrzeugs.<br />
Information<br />
RENAULT TRUCKS Österreich VertriebsgesmbH,<br />
Sochorgasse 12 –16,<br />
2512 Tribuswinkel,<br />
Tel.: 02252/251400-0,<br />
Fax: 02252/251400-25,<br />
www.renault-trucks.at<br />
office.austria@renault-trucks.com<br />
E.E.
Biomasseanlagen von HERZ Feuerungstechnik<br />
Biowärme von<br />
(und mit) HERZ<br />
Die seit Dezember 2004<br />
mit Hackgut betriebene<br />
HERZ BioMatic-Kombianlage<br />
im burgenländischen<br />
Neckenmarkt mit einer<br />
Gesamtheizleistung von<br />
800 kW sorgt für umweltfreundlicheEnergieversorgung.<br />
Derzeit werden rund 50<br />
Haushalte sowie zwei<br />
öffentliche Gebäude<br />
(Schule und Kirche) mit<br />
Biowärme aus der<br />
Nahwärmeversorgungsanlage<br />
gespeist.<br />
Für die kostengünstige<br />
und umweltfreundliche<br />
Wärme werden pro Jahr<br />
ca. 1.700 Schüttraummeter<br />
Hackgut benötigt. Das<br />
gesamte Hackgut wird aus dem eigenen<br />
Wald von Neckenmarkter Waldbesitzer<br />
aufgebracht.<br />
Der Biomassespezialist<br />
HERZ-Biomasseanlagen erlangen<br />
immer größere Bedeutung in der kommunalen<br />
Nahwärmeversorgung.<br />
Unzählige Referenzanlagen in ganz<br />
Europa bestätigen die hochwertige und<br />
zuverlässige Qualität von HERZ.<br />
Die HERZ BioMatic-Kombianlage in<br />
Neckenmarkt sorgt für umweltfreundliche<br />
Energieversorgung. E.E.<br />
Modernsten Pellets- und Hackschnitzelheizungen von 3<br />
bis 500 kW<br />
Traditionell innovativ<br />
Ständige Innovationen und modernste<br />
Technologien machen HERZ-Biomasseanlagen<br />
unschlagbar. Dies verdeutlicht<br />
auch der erste Platz auf der Expobioenergia<br />
2006 in Spanien, wo HERZ als<br />
Innovationspreissieger hervorging.<br />
Die Produktpalette<br />
Mit den modernsten Pellets- und Hackschnitzelheizungen<br />
im Bereich von 3<br />
bis 500 kW (Doppelanlagen bis 1000<br />
kW) sowie den perfekten Holzvergaserkesseln<br />
von 8 bis 50 kW bietet HERZ<br />
ein komplettes Sortiment für den<br />
umweltfreundlichen Brennstoff Holz<br />
an.<br />
Das Hauptaugenmerk wird dabei auf<br />
moderne, kostengünstige und umweltfreundliche<br />
Heizsysteme mit höchstem<br />
Komfort und Bedienerfreundlichkeit<br />
gelegt.<br />
Information<br />
HERZ Armaturen Ges.m.b.H<br />
Geschäftsbereich HERZ Feuerungstechnik<br />
8272 Sebersdorf 138<br />
Tel: 03333/2411-0, Fax: DW 73<br />
E: office@herz-feuerung.com<br />
www.herz-feuerung.com
Wirtschafts-Info<br />
Das Online Energie Management System von Wien Energie<br />
Alle Energiedaten<br />
im Griff<br />
Kostenkontrolle und Verbrauchsübersichten sind Basis für jedes Budget. Im Energiebereich<br />
sind die Abmessungszeiträume oft zu groß, um schnell auf geänderte Faktoren<br />
reagieren zu können. Wien Energie hat deshalb eine einfach realisierbare Lösung für<br />
Firmen und Gemeinden entwickelt – das Online Energie Management System.<br />
Sie können das das Online<br />
Energie Management System<br />
über die Internetseite<br />
www.energiemanagement.at<br />
von jedem PC aus aufrufen und<br />
Zählerstände eingeben. Energieflüsse<br />
werden transparent<br />
und der Energieeinsatz kann<br />
somit laufend optimiert werden.<br />
Ein System für alles<br />
Mit dem Online Energie Management<br />
System lassen sich<br />
Energieverbrauch und andere<br />
relevante Kenngrößen in regelmäßigen<br />
Abständen aufzeichnen.<br />
Bei Standorten, für die ein<br />
Energieliefervertrag mit der<br />
Wien Energie Vertrieb GmbH &<br />
Co KG besteht, werden die<br />
Stromzählerstände automatisch<br />
mit dem Online-Tool verknüpft.<br />
Das Serviceangebot macht<br />
Strom-, Gas- oder Wärmeverbrauch<br />
ebenso nachvollziehbar<br />
wie Öl-, Brennstoff- und Wassereinsatz.<br />
Eine lückenlose<br />
Dokumentation der täglichen<br />
Verbräuche einzelner Gebäude,<br />
selbst definierter Gebäude-Klassen<br />
oder einer ganzen<br />
Gemeinde ist möglich. Anhand übersichtlicher<br />
Diagramme und Tabellen<br />
werden die Einflüsse der Gebäudenutzung,<br />
Witterung und der technischen<br />
Ausstattung verdeutlicht.<br />
Erfolgskontrolle<br />
Abweichungen vom Soll-Energieverbrauch<br />
(z.B. gebäudetypische Durch-<br />
62 KOMMUNAL<br />
Mit dem Online Energie Management System lassen sich<br />
Energieverbrauch und andere relevante Kenngrößen in regelmäßigen<br />
Abständen aufzeichnen.<br />
schnittswerte) weisen auf Schwachstellen<br />
hin und ermöglichen das Aufspüren<br />
von Einsparpotentialen. Plant zum Beispiel<br />
eine Gemeinde Sanierungs- oder<br />
Umweltprojekte, so liefert das Online<br />
Energie Management System fundierte<br />
Entscheidungsgrundlagen. Die Beurteilung<br />
des ökologischen und ökonomischen<br />
Nutzens von Maßnahmen wird<br />
möglich. Die Erfolgskontrolle mittels<br />
Reporting motiviert Mitarbeiter,<br />
beim Energieverbrauch<br />
bewusst und sparsam zu agieren.<br />
Keine Investitionen<br />
Für das Online Energie Management<br />
System von Wien<br />
Energie wird die neueste<br />
Kommunikationstechnologie<br />
verwendet. Der Benutzer<br />
kann über www.energiemanagement.at<br />
von jedem PC aus,<br />
das Online Energie Management<br />
System aufrufen. Die<br />
Auswertungen erfolgen individuell<br />
je nach den Anforderungen<br />
und kommen direkt auf<br />
den Computerbildschirm. Für<br />
diese modernste Art der Energieoptimierung<br />
sind keine<br />
Investitionen, keine Software-<br />
Installation, keine Software-<br />
Wartung notwendig. Der<br />
Zugriff zu den Daten ist rund<br />
um die Uhr weltweit möglich.<br />
Das Online Energie Management<br />
System wird ständig<br />
erweitert und im Sinne der<br />
Kunden optimiert – für einen<br />
raschen Überblick Ihrer Energieverbrauchsdaten.<br />
Information<br />
Wien Energie<br />
Energiemanagement Hotline:<br />
0800 202 810<br />
E-Mail: redaktion@<br />
energiemanagement.at<br />
www.energiemanagement.at<br />
E.E.
Auf dem Weg zur energieeffizienten Gemeinde<br />
Viele Möglichkeiten<br />
zur Einflussnahme<br />
◆ KOMMUNAL Redaktion<br />
Die Kommunen nehmen durch die Kommunalwirtschaft<br />
selbst mit ihren verschiedenen<br />
Sektoren – Versorgung, Entsorgung<br />
und Verkehrsbetriebe – aber<br />
auch durch ihren Umgang mit eigenen<br />
kommunalen Einrichtungen eine wichtige<br />
Vorbildfunktion ein – gerade auch<br />
für das Verhalten ihrer BürgerInnen. Die<br />
Instrumente, um den Energieverbrauch<br />
und damit die Kosten im Gemeindebudget<br />
zu steuern, reichen von der einfachen<br />
Energiebuchhaltung bis zu umfassenden<br />
Programmen. Darüber hinaus haben<br />
Gemeinden, etwa als Fördergeber oder<br />
Entscheidungsträger in der örtlichen<br />
Raumplanung und Bauordnung, auch<br />
Einfluss auf energierelevante Entwicklungen<br />
im Gemeindegebiet. Unterstüt-<br />
zung für ambitionierte Gemeinden gibt<br />
es über eine Reihe von Programmen und<br />
Institutionen – etwa dem e5-Programm<br />
für energieeffiziente Gemeinden.<br />
Energieeffiziente<br />
Gemeinden<br />
„e5“ ist ein Programm zur Qualifizierung<br />
und Auszeichnung von Gemeinden, die<br />
durch den effizienten Umgang mit Energie<br />
und der Nutzung von erneuerbaren<br />
Energieträgern einen Beitrag zu einer<br />
zukunftsverträglichen Entwicklung unserer<br />
Gesellschaft leisten wollen.<br />
Es unterstützt Gemeinden bei einer langfristigen<br />
und umsetzungsorientierten Kli-<br />
Wie günstig ist Ihr Stromund<br />
Gastarif wirklich?<br />
> Energie-Hotline: 0810 10 25 54 oder e-mail: office@e-control.at<br />
Wirtschafts-Info<br />
„e5“ qualifiziert und zeichnet<br />
Gemeinden aus, die u.a. durch<br />
Nutzung von erneuerbaren<br />
Energieträgern einen Beitrag<br />
zu einer zukunftsverträglichen<br />
Entwicklung unserer Gesellschaft<br />
leisten wollen.<br />
Weil Österreichs Gemeinden den Bürgerinnen und Bürger sowie regionalen Wirtschaftstreibenden<br />
am nächsten sind, können sie wichtige Beiträge zur Bewältigung<br />
der aktuellen Herausforderungen im Energiebereich und im Klimaschutz leisten.<br />
maschutzarbeit in den Bereichen Energie<br />
& Mobilität. Angelehnt an Qualitätsmanagementsysteme<br />
aus der Wirtschaft, ist<br />
das e5-Programm als ein Prozess zu verstehen,<br />
in dem unter anderem<br />
◆ Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungspotentiale<br />
identifiziert werden<br />
sowie<br />
◆ die Mitwirkung der Bevölkerung an<br />
energiepolitischen Entscheidungen und<br />
Aktivitäten ermöglicht wird.<br />
Rad nicht neu erfinden<br />
Mit e5 können Gemeinden den Sprung<br />
weg von energieeffizienten Einzelprojekten<br />
hin zu einer kontinuierlichen Um -<br />
☛ weiter auf Seite 65<br />
> Tarifkalkulator: Errechnen Sie Ihren günstigsten Strom- oder Gasanbieter<br />
unter www.e-control.at<br />
> Quick-Check: So bekommen Sie Ihre Stromkosten in den Griff! – www.e-control.at<br />
> Schlichtungsstelle: Hilfe bei Problemen mit Ihrem Energieunternehmen oder<br />
Ihrer Rechnung – e-mail: schlichtungsstelle@e-control.at<br />
E-Control - Ihr Ansprechpartner im freien Strom- und Gasmarkt Energie-Control GmbH, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien,Tel: 01 24724-0<br />
KOMMUNAL 63
Wirtschafts-Info<br />
ACO – Schützen, gestalten, entwässern<br />
Innovative Beleuchtungseffekte<br />
Der ACO DRAIN ® Lichtpunkt und die<br />
ACO DRAIN ® Lichtlinie setzen leuchtende<br />
Akzente in der Architektur und<br />
Freiraumgestaltung. Sowohl öffentliche<br />
Plätze als auch Eingangsbereiche und<br />
Wegführungen werden funktional aufgewertet.<br />
Technische Perfektion und<br />
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten<br />
für den Planer und Verarbeiter standen<br />
bei der Entwicklung im Vordergrund.<br />
Lichtlinie und Lichtpunkt sind Wegwei-<br />
wir heizen ein...<br />
64 KOMMUNAL<br />
Die ACO DRAIN ® Lichtlinie eröffnet<br />
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten<br />
in der Farbgestaltung von Außenbereichen.<br />
ser und Blickfang zugleich. Eine<br />
innovative Möglichkeit, um die<br />
Architektur von Freiflächen wirkungsvoll<br />
zu gestalten.<br />
Bei den beiden Varianten Lichtpunkt<br />
sowie Lichtlinie dient die Polymerbetonrinne<br />
ACO DRAIN ® Multiline ® V<br />
100 S als Trägerelement. Dieses neu<br />
entwickelte System entspricht allen<br />
Anforderungen der ÖNORM EN<br />
1433.<br />
ACO DRAIN ® Lichtpunkt bietet eine<br />
innovative Kombination aus Beleuchtung<br />
und Entwässerung. Es ist kein<br />
zusätzlicher Montageaufwand erforderlich,<br />
da bereits die fertige Abdeckung<br />
geliefert wird. Der Lichtkörper ist in<br />
eine standardisierte Abdeckung integriert,<br />
so dass die Entwässerungsfunktion<br />
von Rost und Rinne erhalten bleiben.<br />
Die neue ACO DRAIN ® Lichtlinie mit<br />
ihren variablen Farbeffekten eröffnet<br />
dem Planer vielfältige Anwendungsmöglichkeiten<br />
in der Farbgestaltung<br />
von Außenbereichen. Der Rinnenkörper<br />
Multiline ® bildet zusammen mit<br />
der LED-Floorline sowie einer überrollbaren<br />
und rutschhemmenden Glastechnik<br />
ein architektonisches Gestaltungselement.<br />
Die LED-Floorline gibt es in<br />
den Standard-Einzelfarben weiß, blau<br />
und grün. Für die Beleuchtung mit<br />
individuellen Einzelfarben und die Realisation<br />
von Farbeffekten wie auch Verläufen<br />
stehen unterschiedliche Techniken<br />
zur Verfügung.<br />
Information<br />
ACO Passavant GmbH<br />
Gewerbestrasse 14-20<br />
2500 Baden<br />
Tel.: 02252/22420-0<br />
E-Mail: info@aco-passavant.at<br />
Web: www.aco-passavant.at<br />
KÖB Holzfeuerungen – optimaler Wirkungsgrad bei niedrigsten Emissionen<br />
1,5 Millionen Kilogramm CO2 eingespart<br />
Der Vorarlberger Landwirt Tobais Ilg<br />
tauschte im letzten Jahr seine Kühe<br />
gegen ein Nahwärme Heizwerk betrieben<br />
mit Hackschnitzel. Das spart<br />
650.000 Liter Heizöl pro Jahr und entspricht<br />
einem Aufkommen von 1,5 Mio.<br />
kg CO 2 .<br />
Das Heizwerk basiert auf zwei KÖB<br />
PYTEC Kesseln. Der PYRTEC kombiniert<br />
eine Unterschubfeuerung mit<br />
einem bewegten Außenrost und zeich-<br />
net sich durch einen optimalen Wirkungsgrad<br />
über einen bemerkenswert<br />
breiten Leistungsbereich bei niedrigsten<br />
Emissionen aus.<br />
Die gesamte<br />
Steuerung der<br />
Heizzentrale<br />
inklusive Kessel,<br />
Beschickung, Speicher und Netzregelung<br />
übernimmt die KÖB MASTER-<br />
CONTROL.<br />
KÖB – Wärme aus Holz ist seit mehr als<br />
25 Jahren einer der innovativen Anbieter<br />
für Holzheizungsanlagen.<br />
Für die herausragendenLeistungen<br />
auf<br />
dem Gebiet moderner Feuerungstechnik<br />
wurde KÖB mehrfach ausgezeichnet.<br />
E.E.<br />
E.E.
setzungsarbeit schaffen.<br />
Im Vordergrund der e5-<br />
Aktivitäten steht das e5-<br />
Team in der jeweiligen<br />
Gemeinden, das nach<br />
einem zuvor selbst ausgearbeiteten<br />
Konzept<br />
Schritt für Schritt die<br />
Energiesparmaßnahmen<br />
plant, anschließend<br />
umsetzt und die<br />
Erfolge evaluiert. Dem<br />
Team zur Seite steht ein<br />
ausgebildetes Energieberater-Netzwerk,<br />
das<br />
Hilfe zur Selbsthilfe leistet.<br />
Weiterbildungsveranstaltungen zur<br />
Erhöhung der Kompetenz und Erfahrungsaustauschtreffen<br />
mit anderen e5-<br />
Teams motivieren die engagierten BürgerInnen<br />
zu weiteren Aktivitäten. Besonders<br />
erfreulich ist, wenn bei der Auszeichnungsveranstaltung<br />
die BürgermeisterInnen<br />
und e5-Teams weitere „e“-<br />
Pokale erhalten und somit die Arbeit der<br />
vergangenen Jahre belohnt wird.<br />
Nutzen für e5 Gemeinden<br />
◆ Kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz<br />
und eine damit verbundene<br />
Kosteneinsparung<br />
◆ Umsetzung einer zukunftsverträglichen<br />
Energiepolitik<br />
◆ Befähigung engagierter BürgerInnen<br />
zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung<br />
durch aktive<br />
Bürgerbeteiligung<br />
◆ Qualifizierung von GemeindemitarbeiterInnen<br />
◆ Optimierung gemeinde -<br />
interner Strukturen und Prozesse<br />
in Energie-Bereichen<br />
◆ Vergleichsmöglichkeit mit<br />
anderen engagierten Gemeinden<br />
(Benchmarking)<br />
◆ Zugriff auf das Know-how<br />
von Energie-Mustergemeinden<br />
◆ Klima- und Umweltschutz<br />
bedeutet erhöhte Lebensqualität<br />
für BürgerInnen<br />
◆ Imagegewinn durch verantwortungsbewusste<br />
Energie- und Klimaschutzpolitik<br />
Erfolge von e5<br />
Wie erfolgreich das e5-Programm in<br />
Österreich in den letzten Jahren gelaufen<br />
ist, lässt sich anhand einiger weniger<br />
Fakten veranschaulichen:<br />
◆ In Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol<br />
und Vorarlberg nehmen derzeit insgesamt<br />
54 Gemeinden am Programm teil.<br />
◆ Im Laufe von drei Jahren wurden in<br />
den e5-Gemeinden etwa 1500 energierelevante<br />
Projekte umgesetzt.<br />
◆ 2005 beschäftigten sich in den e5-<br />
Gemeinden etwa 500 Energieteammitglieder<br />
aktiv mit der Umsetzung von<br />
energierelevanten Maßnahmen.<br />
Lehrgang „Kommunale/r Klimaschutzexperte/in“<br />
Österreich hat im Rahmen des internationalen<br />
Klimaschutzes (Kyoto-Protokoll)<br />
die Aufgabe übernommen, seine<br />
Treibhausgasemissionen bis 2012 um<br />
13 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.<br />
Es bedarf daher einer gemeinsamen<br />
Anstrengung aller Entscheidungsträger<br />
in Österreich, um dieses Ziel zu<br />
erreichen.<br />
Klimabündnis Österreich hat deshalb<br />
gemeinsam mit dem Lebensministerium,<br />
dem Umweltbundesamt und der<br />
Wirtschaftskammer Österreich einen<br />
europaweit einmaligen Lehrgang zur<br />
Ausbildung von kommunalen Klimaschutz-Experten<br />
und –Expertinnen<br />
unter dem Titel „Klimaschutz geht<br />
jeden an“ geschaffen, der von Oktober<br />
2007 bis Juni 2008 stattfinden wird.<br />
Ziel dieses Lehrganges ist es, Umweltund<br />
andere Gemeinderäte/innen, Klimabündnisbeauftragte<br />
und sonstige<br />
Interessierte mit den Grundlagen der<br />
nationalen und internationalen Klimapolitik<br />
vertraut zu machen bzw. Informationen<br />
über Anpassung und Umsetzung<br />
zur Verfügung zu stellen. Damit<br />
sollen jene Kenntnisse und Fähigkeiten<br />
vermittelt werden, die es den österreichischen<br />
Gemeinden ermöglichen,<br />
Foto: BMLFUW/UBA/Gröger<br />
einen aktiven Beitrag zur Reduktion<br />
der Treibhausgase zu leisten. Gleichzeitig<br />
soll das erworbene Wissen in Projektarbeiten<br />
und in einer Abschlussarbeit<br />
in erste Lösungsansätze für aktuelle<br />
Themenstellungen aus dem jeweiligen<br />
Arbeitsbereich der Teilnehmer einfließen.<br />
Besonders richtet sich die Ausbildung<br />
an engagierte Personen aus<br />
den mittlerweile 678 österreichischen<br />
Klimabündnis-Gemeinden.<br />
Die fachliche Betreuung des Lehrganges<br />
erfolgt durch anerkannte Experten<br />
im Bereich des Klimaschutzes:<br />
◆ Univ. Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb,<br />
Universität für Bodenkultur, Wien<br />
◆ Univ. Doz. Dr. Andreas Windsperger,<br />
Institut für Industrielle Ökologie, St.<br />
Pölten<br />
◆ Mag. Wolfgang Mehl, Klimabündnis<br />
Österreich.<br />
Darüber hinaus stehen zahlreiche Praktiker<br />
als Referenten/innen zur Verfügung,<br />
die auch eine Vielzahl von<br />
Umsetzungsbeispielen vorstellen werden.<br />
Die Überreichung der Abschlusszertifikate<br />
wird im Juni 2008 vom Umweltminister<br />
vorgenommen werden.<br />
Wirtschafts-Info<br />
KOMMUNAL 65
Wirtschafts-Info<br />
Marktgemeinde Finkenstein spart Energie<br />
Kelag-Analyse<br />
zeigt’s vor<br />
Nach dem EnergieMonitoring der Kelag-Energiedienstleis -<br />
tung spart die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See<br />
jährlich rund 17.000 Euro Energiekosten ein.<br />
Als eine der größten Landgemeinden<br />
Kärntens hat Finkenstein das Angebot<br />
der Kelag-Energiedienstleistung genutzt.<br />
Im Zuge des EnergieMonitorings hat die<br />
Kelag die öffentlichen Gebäude und die<br />
Straßenbeleuchtung im Hinblick auf den<br />
Energieverbrauch analysiert. „Die<br />
Analyse hat gezeigt, dass sowohl beim<br />
Rathaus und der Volksschule wie auch<br />
bei der Straßenbeleuchtung Handlungsbedarf<br />
gegeben war“, so Markus Gwenger<br />
von der Kelag-Energiedienstleistung.<br />
10.000 Euro weniger<br />
Heizkosten<br />
Nach Vorlage der Möglichkeiten zur<br />
Energieeinsparung hat die Gemeinde<br />
entschieden, die Heizkosten ohne<br />
Komfortverlust in der Volksschule und im<br />
Rathaus zu senken. Dafür wurde in der<br />
Schule und im Gemeindeamt die oberste<br />
Geschoßdecke gedämmt. In beiden<br />
Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH<br />
A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2<br />
Tel. ..43/2266/604, Telefax ..43/2266/65311<br />
www.vogel-pumpen.com<br />
66 KOMMUNAL<br />
Gebäuden wurde der alte Ölkessel gegen<br />
eine wirtschaftliche Erdgasheizung<br />
getauscht. Die jährliche Einsparung bei<br />
den Heizkosten ergibt rund 10.000 Euro.<br />
Mehr Licht, weniger<br />
Kosten<br />
Das vielfältige Kulturprogramm der<br />
Burgarena Finkenstein lockt zahlreiche<br />
Besucher von nah und fern in die<br />
Region. Europaweit bekannt ist die<br />
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker<br />
See in den letzten Jahren mit ihrem<br />
Harley Davidson-Treffen geworden.<br />
Damit die beliebte Seen- und Tourismusgemeinde<br />
weiterhin hell erstrahlt,<br />
hat der Gemeinderat einstimmig die<br />
Erneuerung der Beleuchtung beschlossen.<br />
„Wir waren immer bemüht, den Spagat<br />
zwischen Erhaltung und Errichtung zu<br />
managen. Einerseits war unsere<br />
Beleuchtung teilweise fast 50 Jahre alt.<br />
Andererseits mussten wir unsere<br />
Beleuchtung auch erweitern“, so<br />
Bürgermeister Walter Harnisch. „Mit<br />
dem Angebot der Kelag können wir<br />
unsere Mittel effizient einsetzen, die<br />
bestehende Beleuchtung sanieren und<br />
zusätzlich noch erweitern.“<br />
Neue Beleuchtung spart<br />
7000 Euro<br />
Die Kelag-Energiedienstleistung hat für<br />
das Beleuchtungskonzept 43 Schaltstellen<br />
und 1344 Lichtpunkte untersucht.<br />
Neue Natriumdampf-Hochdrucklampen<br />
ersetzen die alten Pilzlampen mit Leuchtstoffröhren<br />
oder Quecksilberdampf-<br />
Hochdrucklampen. Die Vorteile der<br />
neuen Leuchten liegen in der besseren<br />
Lichtausbeute, der optimalen<br />
Straßenausleuchtung, der wesentlichen<br />
Vogel Pumpen<br />
Wir sorgen für die Zirkulation in Ihren Kreisläufen ...<br />
Spiralgehäusepumpen und kompakte Blockpumpen für die<br />
Gebäudetechnik und Industrie.<br />
Ein Baukastensystem mit umfangreichen Baugrößen, Werkstoffen<br />
und Wellenabdichtungen flexibel anpassbar an die<br />
jeweiligen Anforderungen. Auch mit Drehzahlregelung<br />
verfügbar.<br />
SPIRALGEHÄUSEPUMPEN MEHRSTUFENPUMPEN TAUCHMOTORPUMPEN DRUCKSTEIGERUNGSANLAGEN PUMPENREGLER
Bgm. Walter Harnisch (Mitte) und Kelag-<br />
Energiedienstleister Markus Gwenger<br />
(re.) freuen sich mit allen Mitwirkenden<br />
über die erfolgreiche Umsetzung: Hermann<br />
Rabitsch, Walter Leeb, Harald<br />
Omann, Vizebgm. Ingo Wucherer, Robert<br />
Poglitsch, Markus Gastl (Gem. Finkenstein)<br />
und Willibald Kohlweg (Kelag) (v.r.).<br />
längeren Lebensdauer und dem geringeren<br />
Stromverbrauch. Die neue Beleuchtung<br />
spart jährlich 7000 Euro Strom -<br />
kosten.<br />
Für die nächste Zukunft ist geplant, das<br />
Ein- und Ausschalten der Straßen -<br />
beleuchtung über astronomische<br />
Schaltuhren zu tätigen. Dies bringt<br />
nochmals zusätzliche Einsparungen.<br />
„Wir sind auf dem neuesten Stand. Die<br />
Umsetzung des Beleuchtungskonzepts ist<br />
für uns eine markante Verbesserung“, ist<br />
Vizebürgermeister Ingo Wucherer mit<br />
der Betreuung der Kelag und der neuen<br />
Beleuchtung sehr zufrieden. „Die Arbeiten<br />
haben wir mit unseren Leuten vom<br />
Bauhof selbst umgesetzt.“ Bauamtsleiter<br />
Ing. Walter Leeb hebt ebenfalls die gute<br />
und umfassende Beratung der Kelag im<br />
Zuge des EnergieMonitorings hervor.<br />
Auch Markus Gastl, Vorarbeiter vom<br />
Bauhof, lobt die Zusammenarbeit mit<br />
der Kelag.<br />
Einspar-Contracting<br />
entlastet das Budget<br />
Finanziert werden die neue Beleuchtung<br />
und die energiesparenden Maßnahmen<br />
in der Volksschule und im Rathaus mit<br />
einem Einspar-Contracting. Dabei finanziert<br />
die Kelag die Investitionen vor. Die<br />
Die Shell Direct Austria GmbH bietet<br />
neben innovativen Produkten und qualitativen<br />
Services im Heizöl-, Diesel- und<br />
Biobrennstoffbereich ein spezielles Service<br />
zur Tanküberwachung an. Das<br />
System „Oil Link“ verhindert Leerstände<br />
im Tank und überwacht regelmäßig den<br />
Füllstand. Bei Unterschreitung einer<br />
festgelegten Menge im Tank werden Sie<br />
per E-Mail, SMS oder per Telefon verständigt.<br />
Nutzen auch Sie die Vorteile<br />
monatlichen Raten deckt die Gemeinde<br />
teilweise aus den Einsparungen. Amtsleiter<br />
Harald Omann beschreibt den Vorteil<br />
des Einspar-Contractings: „Das Gemeindebudget<br />
wird wenig belastet. Wir konnten<br />
Projekte vorziehen, die erst zu einem<br />
späteren Zeitpunkt geplant waren.“<br />
Information<br />
Nichts mehr im Tank? Das lässt sich vermeiden.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Kelag-Energiedienstleistung<br />
energiedienstleistung@kelag.at<br />
(0463)525-1655<br />
„OilLink“ von Shell überwacht die Tanks<br />
von Oil Link – einige Gemeinden verwenden<br />
das System bereits für die Überwachung<br />
ihrer Wasserbasseins. Somit ist<br />
nicht nur die Versorgung<br />
gewährleistet, auch Wasserrohrbrüche<br />
oder Quellen,<br />
die am versiegen sind, können<br />
rasch erkannt werden.<br />
Rufen Sie uns an, wir informieren<br />
Sie gerne und<br />
unverbindlich über alle<br />
Details und Möglichkeiten<br />
von Oil Link!<br />
Information<br />
Shell Direct Austria GmbH<br />
Martin Jarmer<br />
Mariazellerstrasse 134<br />
3100 St. Pölten<br />
Mobil: 0664 / 81 72 828<br />
E-Mail: Martin.Jarmer@<br />
shell-direct.at<br />
Web: www.shell-direct.at<br />
KOMMUNAL 67<br />
E.E.<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Brennende Fragen: Kaminbranche gibt Antwort<br />
Was wäre ein Leben ohne Feuer?<br />
Ein Leben ohne Knistern, ohne Prasseln,<br />
ohne Behaglichkeit, ohne Kuscheln? Ein<br />
kühles, meinen wir.<br />
Ziel der „Initiative Pro<br />
Kamin“ ist es, Lösungen<br />
für die brennend<br />
heißen<br />
Probleme am Energieund<br />
Heizungsmarkt<br />
aufzuzeigen. Ständig<br />
steigende Öl-, Gas und<br />
Strompreise verteuern<br />
das Heizen. Versorgungsengpässe,politische<br />
Unsicherheiten<br />
und Naturkatastrophen<br />
führen zu Ausfällen in<br />
der Energieversorgung<br />
– ein moderner Fertigteilkamin<br />
sichert ein<br />
warmes Zuhause.<br />
Der Universal -<br />
kamin<br />
Wer kostengünstig,<br />
sicher und komfortabel<br />
heizen will, setzt auf<br />
einen Universal kamin.<br />
Angeschlossen werden<br />
kann jede Heizquelle,<br />
egal ob sie mit Gas, Öl, Kohle oder<br />
festen Brennstoffen betrieben wird. Und<br />
wenn künftige Generationen mal einen<br />
Kaminfeuerofen, einen Kachelofen oder<br />
einen Küchenherd planen, mit einem<br />
Universalkamin im Haus ist’s möglich.<br />
ÖGL Symposium<br />
Grabenlos 2007<br />
im Kongress &<br />
TheaterHaus<br />
Bad Ischl<br />
GRABENLOS – immer ein Gewinn!<br />
���������������������������<br />
�����������������<br />
68 KOMMUNAL<br />
Der Sicherheitskamin<br />
Ob Stromausfall oder ob einfach vergessen<br />
wurde, Heizöl zu bestellen – alles<br />
Kamine mit integrierten Lüftungskanälen bieten eine windunabhängige<br />
und sichere Lösung, damit die Feuerstätte immer ausreichend Verbrennungsluft<br />
erhält.<br />
kein Problem mit einem Reserve- oder<br />
Notkamin im Haus. Ein Ofen ist im Notfall<br />
schnell angeschlossen und in Betrieb<br />
genommen. Daher ist für den klassischen<br />
„Häuslbauer“ ein Haus ohne<br />
Rauchabzug ganz undenkbar. Bewohner<br />
�����������<br />
��������������������<br />
���������������<br />
billig und daher ohne Kamin gebauter<br />
Wohnhausanlagen sitzen da in der<br />
Kälte. Damit das nicht passiert, ist der<br />
Sicherheitskamin in einigen<br />
Bundesländern<br />
gesetzlich vorgeschrieben.<br />
Die „Initiative Pro<br />
Kamin“ fordert eine<br />
Richtlinie für ganz Österreich.<br />
13. + 14.<br />
November<br />
2007<br />
Information<br />
Die Wohnfeuerstätte<br />
Niedrigenergiehäuser<br />
erfordern luftdichte<br />
Gebäudehüllen. Eine<br />
separate Zufuhr der Verbrennungsluft<br />
stellt die<br />
Funktion der Feuerstätte<br />
sicher, und mit einem<br />
Kamin im Haus oder in<br />
der Wohnung kann man<br />
heizen, auch dann, wenn<br />
der Strom ausfällt. Denn<br />
der Kamin sorgt für Sauerstoffzufuhr<br />
und<br />
Abtransport der Verbrennungsgase.<br />
Web: www.prokamin.at<br />
Initiative PRO Kamin<br />
Jägerstraße 5, A-4542 Nußbach<br />
����������������������������<br />
��������������������������<br />
���������������������������<br />
E.E.
Fotos: KölnMesse<br />
Messe Köln: FSB feiert zum Jubiläum neuen Flächenrekord<br />
Treffpunkt der Sportund<br />
Freizeitwelt<br />
Vom 31. Oktober bis 2. November 2007<br />
findet in Köln die 20. Auflage der Internationalen<br />
Fachmesse für Freiraum,<br />
Sport- und Bäderanlagen (FSB) statt.<br />
Rund 500 Aussteller aus fast 40 Ländern<br />
präsentieren auf einer Brutto-Ausstellungsfläche<br />
von rund 53.000 Quadratmetern<br />
ihre Neuheiten und Innovationen.<br />
Verwaltungsvorsitzende, Sport- und<br />
Bäderamtsleiter, Planer, Ingenieure,<br />
Landschaftsarchitekten & Architekten für<br />
Sportstätten, Betreiber von Freizeit- und<br />
Wasserparks finden auf Europas Kommunikationsplattform<br />
Nr. 1 Konzepte und<br />
Ideen zu den Themen urbanes Design,<br />
Planung, Bau und Einrichtung von Sport-,<br />
Freizeit- und Erlebniswelten. Ebenfalls<br />
zum 20. Mal im Rahmen der FSB veranstaltet<br />
die Internationale Vereinigung<br />
Sport- und Freizeiteinrichtungen (IAKS)<br />
ihren international renommierten IAKS-<br />
Kongress mit Verleihung des weltweit<br />
einzigen Architekturpreises für im<br />
Betrieb befindliche Sportstätten – dem<br />
IOC/IAKS-Award. Der IAKS-Kongress<br />
zählt international zu den führenden<br />
Kommunikationsplattformen der gesamten<br />
Sport- und Freizeitwelt.<br />
Auf der FSB werden nicht nur Freizeittrends<br />
vorgestellt (oben), sondern<br />
auch Grundlagen wie die neuesten<br />
Bodenbeläge für alle Zwecke (rechts).<br />
Urbanes Design präsentiert die Kölnmesse<br />
in diesem Jahr erneut in Kooperation<br />
mit der STADT-und-RAUM Messe<br />
und Medien GmbH, die neben einer<br />
aufwendig gestalteten Sonderfläche<br />
auch Seminare, Sonderschauen und<br />
Fotoausstellungen auf der FSB veranstaltet.<br />
Höhepunkt hier ist sicherlich die<br />
Verleihung des Deutschen Spielraumpreises<br />
2007.<br />
Zusätzlich dazu wird mit dem 2. Kölner<br />
Schwimmbad- und Wellnessforum wieder<br />
ein inhaltlich maßgeschneidertes<br />
Kommunikationskonzept für das<br />
gesamte Messetrio in Köln geschaffen.<br />
Neben der FSB beginnen zeitlich parallel<br />
die aquanale – Internationale Fachmesse<br />
für Sauna, Pool, Ambiente und<br />
die SOLARIA – Internationale Fachmesse<br />
für Sonnenlicht-Systeme. Passend<br />
dazu lauten die Oberthemen des<br />
2. Kölner Schwimmbad- und Wellnessforums:<br />
Wasser, Wärme, Licht.<br />
Information<br />
Infos: www.fsb-cologne.de<br />
E.E.<br />
������������������������������������<br />
����������������������������������<br />
�������������������<br />
���������������������������������������<br />
����������������������������������������<br />
�����������<br />
��������������������������������������<br />
� ���������������������������������<br />
� ����������<br />
�������������������������������������<br />
� ��������<br />
����������������������������<br />
���������������������������<br />
������������������������������������<br />
��������������������
Beleuchtung<br />
Quecksilber-Beleuchtung für Straßen belastet Gemeinde-Budgets<br />
Fiat Lux, Austria!<br />
KOMMUNAL zeigt auf, wie moderne Beleuchtungstechnologie – und damit auch die<br />
Gemeinden – günstige Lösungen für die Einhaltung der Ziele des Kyoto-Abkommens bildet.<br />
◆ Franz Josef Müller<br />
Gegenwärtig werden ungefähr ein Drittel<br />
der österreichischen Strassen noch<br />
immer mit der zwar billigen, aber<br />
unwirtschaftlichen Technologie aus den<br />
60er Jahren beleuchtet .Die Quecksilberdampflampen.<br />
Diese veralteten Lampen<br />
verbrauchen doppelt so viele Strom wie<br />
nötig im Vergleich zu modernen Leuchtentechnologien<br />
und sind somit eine<br />
erhebliche finanzielle Belastung für<br />
Städte und Gemeinden.<br />
Welche Lösungen gibt’s?<br />
Natriumhochdruckdampflampen<br />
Ein 1:1-Austausch gegen Quecksilber-<br />
Lichtblicke von Blachere!<br />
Jetzt Ihre neue Weihnachtsbeleuchtung bestellen und erst zu Ostern 2008 bezahlen! *<br />
* Diese Aktion ist gültig auf die gesamte Produktpalette bis Ende September 2007. Solange der Vorrat reicht.<br />
Blachere Illumination GmbH, Griesmühlstr. 6, 4600 Wels, Tel: +43/(0)7242/252021-0, Fax: +43/(0)7242/252021-9200<br />
E-Mail: office@blachere-illumination.at, Web: www.blachere-illumination.at ILLUMINATION<br />
70 KOMMUNAL<br />
dampflampen HQL/HPL bringt allein<br />
vom Stromverbrauch einiges:<br />
Eine „alte“ HQL/HPL verbraucht 80W<br />
eine „neue“ NAVE/SON-H nur 68W<br />
(HQL/HPL 125W – NAVE/SON 110W;<br />
HQL/HPL 250W – NAVE/SON 220W;<br />
HQL/HPL 400W – NAVE/SON 350W)<br />
Die Vorteile gegenüber Quecksilberdampflampen<br />
sind:<br />
◆ Über zehn Prozent Energieersparnis<br />
◆ Verlängertes Wartungsinterwall<br />
◆ Geringere Betriebskosten<br />
◆ Über 50 Prozent höherer Lichtstrom<br />
◆ Höhere Verkehrssicherheit durch<br />
höheres Beleuchtungsniveau<br />
◆ Energieersparnis bedeutet CO2-Reduk-<br />
Natriumhochdruckdampflampen<br />
haben eine<br />
mehr als doppelt so hohe<br />
Lichtausbeute gegenüber<br />
Quecksilbersdampflampen.<br />
tion und schont die Umwelt<br />
◆ HQL/HPL Vorschaltgerät erforderlich<br />
(ohne externes Zündgerät)<br />
Erst zu<br />
Ostern<br />
bezahlen!
Eine Straßenbeleuchtungs-Anlage mit den „alten“Quecksilberdampflampen.<br />
Die selbe Straße beleuchtet mit den neuen, energiesparenden<br />
Metallhalogendampflampen CPO.<br />
CO2-Reduktion bis 2012 laut<br />
Kyoto Protokoll: Die Beleuchtung<br />
muss einen überproportionalen<br />
Beitrag erbringen.<br />
Wenn der Beleuchtungskörper<br />
ausgetauscht werden<br />
muss, können<br />
durch den<br />
Umstieg von<br />
herkömmlichenQuecksilberdampflampen<br />
auf energiesparende<br />
Alternativen<br />
die Betriebskostenreduziert<br />
werden.<br />
Natriumhochdruckdampflampen<br />
haben<br />
überdies eine mehr als doppelt<br />
so hohe Lichtausbeute<br />
gegenüber Quecksilbersdampflampen.<br />
Die Wahl der<br />
richtigen Lampen<br />
und Leuchten<br />
entscheidet darüber,<br />
wie viel Kosten<br />
entstehen.<br />
Kriterien für die Bewertung<br />
von Lampen in der<br />
Straßenbeleuchtung:<br />
◆ Lebensdauer und Ausfallraten<br />
◆ Lichtstromrückgang<br />
◆ Qualität und Farbqualität<br />
(Ra)<br />
Weißes Licht bekommt man<br />
bei Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen,<br />
Metallhalogendampflampen<br />
und Quecksilberdampflampen.<br />
Hingegen geben Natriumdampflampen<br />
gelbes<br />
Licht.<br />
Die Wahl der richtigen Lampen<br />
und<br />
Leuchten entscheidet<br />
also<br />
darüber, wie<br />
viel Kosten<br />
entstehen. In<br />
Bezug auf die<br />
Wartungskosten<br />
einer<br />
Lichtanlage<br />
ist insbesondere<br />
bei<br />
großer Lichtpunkthöhe<br />
(Steiger, Leiter, 2-3 Personen)<br />
der Gruppenwechsel<br />
statt dem Einzelwechsel<br />
empfehlenswert.<br />
Die Vorteile beim<br />
Gruppenwechsel:<br />
☛ weiter nächsteSeite<br />
Modell:<br />
UMK 435 U3E<br />
Beleuchtung<br />
Freut Freut Umwelt Umwelt<br />
& Geldbörse.<br />
Geldbörse.<br />
Schonen Sie die Umwelt mit 4-Takt-Motorsensen,<br />
die 80 % weniger Schadstoffe ausstoßen als herkömmliche<br />
2-Takt-Geräte und zudem 50 % weniger<br />
Benzin verbrauchen. Kommen Sie jetzt zum Fachhändler<br />
und testen Sie Ihre neue Motorsense von<br />
Honda kostenlos!<br />
Volle Power<br />
für 365 Tage im Jahr.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie<br />
gerne auf www.honda.at im Bereich<br />
„Garten“ oder unter 02236/690-0.<br />
Setzen Sie auf das zuverlässige John Deere Programm<br />
• Ein breites Programm aus einer Hand:<br />
Rasenmäher, Rasentraktoren, Universaltransporter,<br />
Spindelmäher und Kompakttraktoren<br />
• Beste Ersatzteilversorgung durch weltweit<br />
vernetztes Versorgungssystem<br />
• Maschinen mit höchster Lebensdauer<br />
und optimaler Bedienungsfreundlichkeit<br />
Informationen bei Ihrem John Deere Vertriebspartner<br />
oder bei Rasenpflege & Kommunal Maschinen, 3130 Herzogenburg<br />
Tel.: 02782/83222 • www.johndeere.at • www.rkm.co.at<br />
Zuverlässigkeit ist unsere Stärke<br />
KOMMUNAL 71
Wirtschafts-Info<br />
72 KOMMUNAL<br />
Energieeinsparung<br />
bei keramischen Metallhalogendampflampe in Verbindung<br />
mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)<br />
Lampenleistung Lichtstrom Lampenleistung Lichtstrom<br />
HQL/HPL 80W 1770 lm CPO 45W *) 4300 lm<br />
HQL/HPL 125W 6200 lm CPO 60 W *) 6900 lm<br />
HQL/HPL 250W 12700 lm CPO 90 W *) 10450 lm<br />
HQL/HPL 400W 22000 lm CPO 140 W *) 16500 lm<br />
*) Betrieb nur am EVG. Nach 12000 Stunden 10 % Ausfall und<br />
80 Prozent Lichtstromniveau.<br />
◆ Geringere Wartungskosten<br />
◆ Höhere Anlagenbetriebssicherheit<br />
geringer Lichtstromrückgang<br />
da die<br />
Leuchtmittel im Schnitt<br />
jünger sind.<br />
Auch bei Leuchtstofflampen<br />
gibt es Alternativen:<br />
Statt dem TL Standart mit<br />
9500 Stunden Lampenlebensdauer<br />
sollten Leuchtstofflampen<br />
mit einer Lebensdauer<br />
von 18.000, 40.000 oder<br />
58.000 Stunden (bei zehn<br />
Prozent Frühausfallrate nach<br />
IEC-Schaltzyklus) verwendet<br />
werden.<br />
Beim Einsatz<br />
von Kompaktleuchtstofflampen<br />
sollte man<br />
wenn möglich<br />
auf Amalgamtechnologiezurückgreifen.<br />
Diese<br />
Lampen<br />
haben an kalten<br />
Tagen<br />
mehr Licht<br />
(wird in der<br />
Lampe statt<br />
Quecksilber eine Quecksilberlegierung<br />
eingefüllt Amalgam)<br />
so wird die Abhängigkeit<br />
des Lichtstromes von der<br />
Umgebungstemperatur geringer.<br />
Bei Einsatz der neuen keramischenMetallhalogendampflampe<br />
in Verbindung<br />
mit elektronischem Vorschaltgerät<br />
(EVG) erreicht man die<br />
höchste Energieeinsparung<br />
gegenüber Quecksilberdampflampen.<br />
Ein Handbuch<br />
kann helfen<br />
Die LTG (Lichttechnische<br />
Gesellschaft Österreich<br />
www.ltg.at) hat dafür ein<br />
Es sollten bei<br />
Errichtung einer<br />
Neuanlage für die<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Fachleute zur<br />
Beratung kontaktiert<br />
werden.<br />
umfassendes Handbuch<br />
„Licht im Aussenraum“ mit<br />
Informationen zu allen Themenbereichen<br />
der Beleuchtung<br />
im öffentlichen Raum<br />
herausgegeben.<br />
Die Lichttechnische Gesellschaft<br />
Österreichs hat das<br />
Ziel der Pflege und Förderung<br />
der gesamten Lichttechnik<br />
in Theorie und Praxis,<br />
insbesonders der Forschung,<br />
des Unterrichts und der<br />
Berufsausbildung sowie der<br />
Normung auf diesem Gebiet.<br />
Sie ist eine Gruppe von praktisch<br />
allen namhaften Lichtexperten<br />
Österreichs und<br />
beschäftigt sich<br />
derzeit schwerpunktmäßig<br />
mit den The-<br />
menEnergieeffizienz in der<br />
Bürobeleuchtung,Gebäudepass,Einsparung<br />
von<br />
Energie und<br />
dadurch Reduzierung<br />
von<br />
CO2. Zu diesen<br />
Themen werden<br />
auch laufend<br />
entsprechende Seminare<br />
und Schulungen angeboten.<br />
Nähere Infos zum<br />
Thema unter www.ltg.at<br />
◆ Franz Josef Müller ist Vorstandsvorsitzender<br />
der<br />
Lichttechnischen Gesellschaft<br />
LTG Österreich
Wenn Weihnachtsbeleuchtung der Kommune doppelt hilft<br />
Bis zu 80 Prozent<br />
Einsparungen<br />
Mit moderner LED-Technologie von<br />
Blachere Illumination kann der Stromverbrauch<br />
um durchschnittlich 80 Prozent<br />
gesenkt werden. Damit wird ein<br />
aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.<br />
Eine LED-Weihnachtsbeleuchtung<br />
spart nicht nur Strom, sondern zeichnet<br />
sich auch durch eine lange Lebensdauer<br />
aus. „Herkömmliche Weihnachtsbeleuchtungen<br />
verbrauchen fünf Mal<br />
mehr Strom als Weihnachtsbeleuchtungen<br />
mit der modernen LED-Technologie.<br />
Der Stromverbrauch kann durch<br />
LEDs enorm reduziert werden, nämlich<br />
um bis zu 80 Prozent. Damit können<br />
Kommunen Umweltbewusstsein einfach<br />
umsetzen und vorleben“, so<br />
Robert Karrer, Geschäftsführer<br />
Blachere Illumination Österreich –<br />
Deutschland.<br />
Lichtinstallationen mit LED-Technologie<br />
von Blachere erzielen zudem besondere<br />
Helligkeit und Leuchtkraft aufgrund<br />
der 320° Lichtstreuung (gegen -<br />
über 30° bei herkömmlichen LEDs)<br />
ohne Lasereffekt. Mit einer großen Auswahl<br />
an prächtigen Farben sind dem<br />
Lichtdesign keine Grenzen gesetzt.<br />
Leuchtmotive mit<br />
Solarenergie betrieben<br />
Eine absolute Energierevolution stellen<br />
solarenergiebetriebene Motive dar. Blachere<br />
Illumination hat als internationaler<br />
Marktführer das Hybridsystem BHS<br />
zur Stromversorgung von Leuchtmotiven<br />
entwickelt und bietet dieses exklusiv<br />
am Markt an. Dieses neue Produkt<br />
ermöglicht bei<br />
maximaler Sonnen -<br />
einstrahlung eine<br />
zu 100 Prozent<br />
autonome Stromversorgung.<br />
„Das<br />
Prinzip ist bei den<br />
solarenergiebetriebenen<br />
Motiven<br />
ganz einfach. Eine<br />
Batterie wird<br />
tagsüber mittels<br />
eines Mini-Solar -<br />
panels aufgeladen<br />
und versorgt das<br />
Motiv nachts autonom<br />
mit Strom.<br />
Bei sonnigem Wetter<br />
ist die Batterie<br />
ausreichend, um<br />
das Leuchtelement<br />
als einzige Quelle<br />
mit Strom zu versorgen.<br />
Bei<br />
bedecktem Wetter,<br />
wenn die Batterie<br />
Wirtschafts-Info<br />
Was wäre die Advent- und Weihnachtszeit ohne die beleuchteten Straßen, Plätze und<br />
Märkte? Im Zusammenhang mit Weihnachtsbeleuchtung wird aber das Thema Energieeinsparung<br />
für Städte und Gemeinden immer wichtiger.<br />
Energierevolution<br />
Funktionsprinzip des Hybridsystems BHS von Blachere<br />
Illumination<br />
LED-Technologie: Strom sparen und<br />
lange Lebensdauer.<br />
nicht mehr ausreicht, schaltet das<br />
System automatisch auf Netzversorgung<br />
um. Damit ist ein durchgehendes<br />
Leuchten der Motive sichergestellt.<br />
Selbst an einem bewölkten Wintertag<br />
liefert die Solarzelle 40 Prozent der<br />
benötigten Energie, bei Niederschlag<br />
noch 20 Prozent“, erklärt Karrer.<br />
Information<br />
Blachere Illumination GmbH,<br />
Griesmühlstr. 6, 4600 Wels,<br />
Tel: 07242/252021-0,<br />
Fax: 07242/252021-9200<br />
E-Mail:<br />
office@blachere-illumination.at<br />
Web: www.blachere-illumination.at<br />
KOMMUNAL 73<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Studie belegt erstmals Bedeutung der heimischen Rohstoffbranche<br />
Regionaler Arbeit -<br />
geber und wichtiger<br />
Nahversorger<br />
Eine soeben fertig gestellte Studie zeigt die immense Bedeutung der Rohstoffbranche für<br />
Österreichs Volkswirtschaft. Erstmals hat das Industriewissenschaftliche Institut im Auftrag<br />
des Forums mineralische Rohstoffe quantifizierbare Daten erhoben und analysiert.<br />
Fazit der brandaktuellen Studie: Mineralische<br />
Rohstoffe sind das Fundament<br />
vieler Branchen und stehen am Beginn<br />
vieler Wertschöpfungsketten. Österreichs<br />
Rohstoffunternehmen allein<br />
erwirtschaften jährlich einen Umsatz<br />
von 1,1 Milliarden Euro und bewirken<br />
darüber hinaus eine weitere Milliarde<br />
Euro an zusätzlicher Wertschöpfung.<br />
Besonders nachgelagerte Wirtschaftszweige<br />
wie zum Beispiel die Bauwirtschaft<br />
oder auch die Glasindustrie sind<br />
direkt von der Rohstoffwirtschaft<br />
abhängig. Immer wichtiger dabei ist<br />
eine nachhaltige Versorgung. Österreichs<br />
nationaler Rohstoffplan ist in der<br />
Fertigstellung und hat bereits jetzt Vor-<br />
»<br />
bildwirkung für die gesamte EU.<br />
Mineralische Rohstoffe sind die Grundlage<br />
unseres täglichen Lebens – sie sind<br />
die Basis für unzählige Produkte im Alltag<br />
und für die österreichische Wirtschaft<br />
unverzichtbar. Um diese Einschätzung<br />
mit Daten und Fakten zu<br />
belegen, hat das Industriewissenschaft-<br />
74 KOMMUNAL<br />
Die Ergebnisse (der<br />
Studie) zeigen deutlich,<br />
dass die Rohstoffwirtschaft<br />
eines<br />
der Fundamente der<br />
österreichischen<br />
Wirtschaft ist.<br />
Dr. Carl Hennrich<br />
Geschäftsführer des Forums<br />
mineralische Rohstoffe<br />
«<br />
liche Institut im Auftrag des Forum<br />
mineralische Rohstoffe eine Studie<br />
erstellt, die erstmals eine exakte Bilanz<br />
der mineralischen Rohstoffgewinnung<br />
in Österreich zieht. Die Studie belegt<br />
die zentrale Bedeutung der Rohstoff -<br />
unternehmen für die österreichische<br />
Volkswirtschaft. Dr. Carl Hennrich,<br />
Geschäftsführer des Forums mineralische<br />
Rohstoffe hält fest: „Die Ergebnisse<br />
zeigen deutlich, dass die Rohstoffwirtschaft<br />
eines der Fundamente der<br />
österreichischen Wirtschaft ist.“<br />
14.000 Arbeitsplätze im<br />
ländlichen Raum<br />
Zusätzlich zu ihrem direkt erwirtschafteten<br />
Jahresumsatz von 1,1 Milliarden<br />
Euro induziert die Rohstoffwirtschaft<br />
eine zusätzliche Wertschöpfung von<br />
einer Milliarde Euro in nachgelagerten<br />
Branchen. Sie ist nicht nur ein bedeutender<br />
Wirtschaftsfaktor, sondern sie<br />
sorgt auch für Beschäftigung: „Unsere<br />
Betriebe sichern rund 14.000 Arbeitsverhältnisse<br />
direkt in der Rohstoffgewinnung<br />
und Aufbereitung. Dabei handelt<br />
es sich vor allem um Jobs in ländlichen<br />
Regionen“, erklärt Dr. Hennrich.<br />
Die Hauptabnehmer der Rohstoff -<br />
branche sind vor allem zwei Sektoren,<br />
nämlich die Bauwirtschaft und Glas,<br />
Keramik, bearbeitete Steine und Erden.<br />
Sie beziehen zusammen rund 90 Prozent<br />
der heimischen Produktion mineralischer<br />
Rohstoffe.<br />
Die Rohstoffbranche selbst investierte<br />
im Jahr 2002 29,8 Milionen Euro in<br />
österreichische Investitionsgüter.<br />
Verwendung mineralischer<br />
Rohstoffe<br />
Rund 60 Millionen Tonnen an Sand,<br />
Kies und Naturstein werden jährlich für<br />
die Erhaltung und den Neubau von<br />
Straßen, Hoch- und Tiefbauten wie<br />
z.B. Industrie-, Wohnhausanlagen,<br />
Kanalbau und Bahntrassen benötigt.<br />
30 Millionen Tonnen gehen in die Produktion<br />
diverser Bauprodukte wie z.B.<br />
Zement, Putz, Mörtel, Splitt, Ziegel und<br />
Betonstein. Der Rest fließt in die Produktion<br />
von Glas, Medikamenten,<br />
Papier, Kunststoffe, Zahnpasta, in die<br />
Landwirtschaft und den Export.<br />
Das Industriewissenschaftliche Institut<br />
hat in der Studie auch berechnet, was<br />
passiert, wenn die Rohstoffgewinnung<br />
sinkt. Es zeigt, dass überproportional<br />
mehr an Produktion in der gesamten<br />
Volkswirtschaft ausfällt, weil die nötigen<br />
Vorleistungsgüter nicht mehr in<br />
ausreichender Menge zur Verfügung<br />
stehen. Bei einer Reduktion der Produktion<br />
um 30 Prozent würden in der<br />
mineralischen Rohstoffbranche 332<br />
Millionen Euro fehlen. In der gesamten<br />
Volkswirtschaft Österreichs jedoch<br />
würde das 9,34-fache davon – nämlich<br />
3100 Millionen Euro – fehlen.<br />
Unverzichtbares Gut<br />
Die österreichischen Rohstoffunternehmen<br />
sichern unsere Versorgung mit<br />
Sand, Kies, Naturstein, Kalk, Lehm,<br />
Ton, Mergel, Schiefer, Gips, Industrieminerale<br />
u. v. m. Der Bedarf an mineralischen<br />
Rohstoffen wird fast aus -<br />
schließlich aus heimischen Lagerstätten<br />
gedeckt. Österreichweit gibt es rund
Foto: Forum mineralische Rohstoffe<br />
1200 aktive Rohstoffgewinnungsstätten.<br />
Mineralische Rohstoffe haben in<br />
der Regel einen Transportradius von<br />
nur rund 30 Kilometern. Die Unternehmen<br />
sind damit bedeutende regionale<br />
Wertschöpfer, gewährleisten eine ausgezeichnete<br />
Nahversorgung und entlasten<br />
durch die kurzen Transportwege<br />
Verkehr, Umwelt und Anrainer.<br />
„Wir alle brauchen mineralische Rohstoffe.<br />
Die Rohstoffbranche braucht<br />
aber Rahmenbedingungen, die es ihr<br />
ermöglichen, die Versorgung zu<br />
sichern“, meint DI Markus Stumvoll,<br />
Vorsitzender von Cemex Austria, Österreichs<br />
führendem Anbieter von Transportbeton,<br />
Kies, Schotter und Sand.<br />
Der österreichische<br />
Rohstoffplan<br />
Eine langfristige und sichere Versorgung<br />
mit hochwertigen mineralischen<br />
Rohstoffen ist für die Lebensqualität<br />
der Menschen von großer Bedeutung.<br />
Da mineralische Rohstoffe ein knappes<br />
Gut sind, muss ihre Allokation gut vorbereitet<br />
werden. Deshalb hat Wirtschaftsminister<br />
Dr. Martin Bartenstein<br />
schon 2002 die Montanbehörde mit der<br />
Ausarbeitung des österreichischen Rohstoffplans<br />
beauftragt. Dafür wurden<br />
alle Lagerstätten und möglichen<br />
Gewinnungsgebiete in ganz Österreich<br />
erhoben und bewertet. Derzeit verhandelt<br />
das BMWA mit den Experten der<br />
Länder, welche Flächen für eine langfri-<br />
»<br />
Unser Ziel ist es, die<br />
Versorgung der Menschen<br />
mit mineralischen Rohstoffen<br />
aus der Region für die<br />
nächsten 50 Jahre mit<br />
Sand und Kies bzw. für 100<br />
Jahre mit Festgesteinen zu<br />
sichern.<br />
Univ. Prof. Dr. Leopold Weber<br />
Montanbehörde im BMWA<br />
«<br />
stige Versorgung gesichert werden können.<br />
„Unser Ziel ist es, die Versorgung der<br />
Menschen mit mineralischen Rohstoffen<br />
aus der Region für die nächsten 50<br />
Jahre mit Sand und Kies bzw. für 100<br />
Jahre mit Festgesteinen zu sichern.<br />
Dabei gehen wir völlig neue Wege und<br />
beziehen auch ungewohnte Möglichkeiten<br />
zur Rohstoffgewinnung wie zum<br />
Beispiel eine Flächenabsenkung vor<br />
einem Bauprojekt und neue Ideen zur<br />
Ressourcenschonung mit ein“, erklärt<br />
Univ. Prof. Dr. Leopold Weber von der<br />
Montanbehörde im BMWA.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Parteipolitik raus – für<br />
mehr Versachlichung<br />
Für Dr. Carl Hennrich, Geschäftsführer<br />
des Forums mineralische Rohstoffe,<br />
sind die Gemeinden der wichtigste<br />
Partner. Durchschnittlich hat jede<br />
zweite heimische Gemeinde mit der<br />
Rohstoffgewinnung zu tun, weil es<br />
österreichweit rund 1200 Gewinnungsstätten<br />
und 2357 Gemeinden gibt.<br />
Rechnet man die Transportwege dazu,<br />
so kommt fast jede Gemeinde mit der<br />
Branche in Berührung. „Unser Wunsch<br />
für die Zukunft wäre es, die Parteipolitik<br />
aus den Fragen der Rohstoffgewinnung<br />
herauszuhalten. Wir plädieren für<br />
eine viel stärkere Versachlichung der<br />
Thematik und eine offene, ehrliche Diskussion<br />
ohne parteipolitisches Taktieren“<br />
erklärt Dr. Hennrich im Gespräch<br />
mit KOMMUNAL.<br />
Information<br />
FORUM ROHSTOFFE<br />
Fachverband der Stein- und<br />
keramischen Industrie<br />
Wirtschaftskammer Österreich<br />
Mag. Robert Wasserbacher<br />
1045 Wien,<br />
Wiedner Hauptstraße 63<br />
Tel: 05 90 900 3534<br />
E-Mail: steine@wko.at<br />
Web: www.ForumRohstoffe.at<br />
KOMMUNAL 75<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Die Power Days von Austro Diesel<br />
Tage der offenen Tür –<br />
ein voller Erfolg<br />
Die Austro Diesel Tage der offenen Tür<br />
hatten POWER: 60 Jahre Massey Ferguson<br />
und 25 Jahre Austro Diesel<br />
Zum Doppeljubiläum hat der MF-Generalimporteur<br />
für Zentral- und Osteuropa<br />
Ende Juni alle Kunden und Interessenten<br />
zu den „Power-Days“ nach Schwechat<br />
eingeladen. Eine toll besuchte Veranstaltung<br />
zu der zahlreiche Landwirte aus<br />
Österreich, Ungarn, der Tschechei, Slowakei<br />
und Rumänien gekommen waren.<br />
„Wir verstehen Austro Diesel als European<br />
Player“, betonte Geschäftsführer<br />
Ing. Johann Gram.<br />
Das aktuelle MF-Power-Programm<br />
konnte hautnah erlebt werden. „Wir verstehen<br />
Austro Diesel als European<br />
Player“, betonte Geschäftsführer Ing.<br />
Johann Gram, der zu den Power-Days<br />
ein Paket mit günstigen Jubiläumsangeboten<br />
geschnürt hatte.<br />
An beiden Tagen der offenen Tür gab es<br />
am 22. Und 23. Juni 2007 ein dichtes<br />
Programm mit zahlreichen Highlights:<br />
Präsentiert wurde das umfassende Leistungsspektrum<br />
der MF-Traktoren von 30<br />
bis 315 PS, mit den Baureihen MF 400,<br />
MF 2400, MF 3400, MF 3600, MF 4400,<br />
MF 5400, MF 6400, MF 7400 und MF<br />
8400. Im Bereich Erntetechnik zeigte<br />
Austro Diesel die 160 bis 285 PS starken<br />
Mähdrescher MF Activa, MF Beta und<br />
MF Cerea mit Schneidwerken von 4,20<br />
76 KOMMUNAL<br />
E.E.<br />
bis 7,70 m Breite. Außerdem waren MF<br />
Teleskoplader, Hochleistungs-Großballenpressen<br />
und Rasentraktoren zu sehen.<br />
Detaillierte Einblicke in die MF-Technik<br />
gaben spezielle Vorführungen bzw. Präsentationen<br />
im Schulungsraum.<br />
Einzigartige Angebote<br />
Schnäppchenjäger kamen bei den Power-<br />
Days voll auf ihre Rechnung: Eines der<br />
Jubiläumshighlights war Profi-<br />
RENT mit 5 Jahren Garantie, das<br />
Full Service Leasing für Profitraktoren<br />
der Stufenlosklassen MF<br />
7400/8400 mit Dyna-VT Getriebe<br />
(118 bis 320 PS). Zum günstigen<br />
Fixpreis gibt es bei ProfiRENT alle<br />
Service- und Reparaturleistungen<br />
Massey Ferguson bietet perfekten Bedienkomfort.<br />
So wird Arbeiten zum Vergnügen<br />
– egal ob mit großen (Bild oben links)<br />
oder kleinen „Gefährten“ (oben).<br />
über eine Laufzeit von fünf Jahren, erläuterte<br />
Ing. Gram: „All inclusive: Fünf Jahre<br />
Garantie, 500 l Diesel und 5.000 h Service<br />
inklusive Öle. Und ECO-Speed<br />
garantiert 50 km/h schon bei 1.600<br />
U/min. Das reduziert den Verbrauch<br />
enorm.“<br />
Für die Gäste gab es an beiden Tagen<br />
unverschämt günstige Angebote, die<br />
auch nach den Power-Days – im gesamten<br />
Jubiläumsjahr 2007 – ihre Gültigkeit<br />
haben.<br />
Information<br />
Austro Diesel GmbH<br />
Tarbuk Business Park 4,<br />
A-2320 Schwechat<br />
Tel.: 01/701 20,<br />
Fax: 01/701 20-5<br />
Internet: www.austrodiesel.at<br />
Das Projekt „Neutor“ in Steyr ist<br />
ein klassisches Beispiel dafür, wie<br />
durch Einsatz moderner grabenloser<br />
Technologien sowohl wirtschaftliche<br />
Vorteile erzielt werden können als<br />
auch Menschen und Umwelt möglichst<br />
wenig belastet werden. Die grabenlose<br />
Technologie als umweltschonende und<br />
hocheffiziente Bauweise ist eine weltweit<br />
anerkannte gleichwertige Alternative<br />
zur konventionellen Bauweise im<br />
Bereich der Neuverlegung bzw. der<br />
Sanierung von Leitungen und Kanälen.“<br />
So beschreibt Dr. Ute Boccioli,<br />
Geschäftsführerin der ÖGL (Österreichische<br />
Vereinigung für grabenloses Bauen<br />
und Instandhalten von Leitungen) das<br />
Projekt in Steyr.<br />
Eine Herausforderung für<br />
Steyrs historischer Altstadt<br />
Ein Evaluierungsverfahren der Steyrer<br />
Baubehörde ergab, dass das Inlinersanierungs-Verfahren<br />
eine optimale Lösung<br />
für diese komplexe Aufgabenstellung bei<br />
der Baustelle Neutor mitten in der historischen<br />
Altstadt darstellen würde. Die<br />
Stadt beauftragte die Welser Spezialisten<br />
DI Georg Pennetzdorfer, Geschäftsführer<br />
DDS Rohrtechnik GmbH, Dr. Ute<br />
Boccioli, Geschäftsführerin ÖGL und<br />
Ing. David Forstenlechner, Bürgermeister<br />
der Stadt Steyr.<br />
der DDS Rohrtechnik GmbH mit der<br />
Umsetzung dieses Projektes.<br />
Bürgermeister Ing. David Forstenlechner<br />
begründete den Einsatz grabenloser Verfahren<br />
wie folgt: „Der Einsatz der modernen<br />
grabenlosen Rohrsanierungstechnologie<br />
an dieser verkehrstechnisch sensiblen<br />
Stelle der Stadt bringt uns enorme<br />
Vorteile. Wir rechnen bei diesem Teilabschnitt<br />
jetzt mit Kosten von rund 18.000<br />
Euro. Eine Kanalsanierung mittels herkömmlicher<br />
offener Bauweise wäre<br />
jedoch mit 32.000 Euro zu veranschlagen<br />
gewesen.“<br />
200 Jahre alte Kanäle<br />
Ing. Josef Popp, Leiter Kanalbau der Stadt<br />
Steyr, zu dieser technisch anspruchsvollen
Grabenlose Technologie macht Steyrs Altstadt-Rohrsanierung<br />
Mehr als 40 Prozent<br />
Kostenersparnis<br />
Aufgabe: „Die ältesten Kanäle der Steyrer<br />
Innenstadt wurden vor rund 200 Jahren<br />
errichtet. Das heutige Kanalnetz umfasst<br />
160 km, dazu kommen noch 80 km<br />
Haus anschlüsse. Bisher haben wir im<br />
Kanalbau fast ausschließlich in die Neuerrichtung<br />
von Kanalanlagen investiert,<br />
mittlerweile werden rd. 50 Prozent des<br />
Budgets für die Sanierung derselbigen<br />
ausgegeben. Wir rechnen damit, dass in<br />
naher Zukunft der Anteil der Instandhaltung<br />
und Sanierung bis auf rund 80 Prozent<br />
des dafür vorgesehenen Budgets<br />
steigen wird.“<br />
Verfahren: Sanierung mit<br />
Schlauchinliner<br />
Im ersten Schritt erfolgt die Reinigung<br />
des Altrohres mittels Hochdruckreinigung,<br />
bei dem ein Spezialfahrzeug mit<br />
hohem Wasserdruck die vorhandenen<br />
Ablagerungen und Verkrustungen an der<br />
Rohrinnenwand entfernt. Im Anschluss<br />
daran wird ein so genannter Schlauchinliner<br />
installiert. Dabei wird ein mehrlagiger<br />
Gewebeschlauch mit Epoxydharz<br />
getränkt und dann am Beginn des Sanierungsabschnittes<br />
in das Altrohr eingestülpt.<br />
Mit Druck wird durch Inversion<br />
der Schlauch bis zum Abschnittsende<br />
unterirdisch eingebracht, wobei er sich<br />
an das Altrohr anlegt. In der Folge wird<br />
mittels Heißdampf der Schlauch ausgehärtet,<br />
und er bildet damit einen perfekten<br />
Verbund mit dem Altrohr. So entsteht<br />
ein neues, qualitativ hochwertiges<br />
Rohr, welches eine mit „normalen“<br />
Kunststoffrohren vergleichbare Lebensdauer<br />
von bis zu 50 Jahren hat.<br />
Zukunft ist Grabenlos<br />
Schätzungen nach werden in Österreich<br />
jährlich rund 100 Millionen Euro in den<br />
Einsatz grabenloser Technologien bei<br />
Sanierungen, Instandhaltungen und<br />
Technik<br />
In den Sommermonaten saniert die Stadt Steyr das komplette Kanalssystem am kritischen<br />
Verkehrspunkt „Neutor“ mitten im Zentrum der historischen Altstadt. Ein „Musterbeispiel“<br />
für den vermehrten Einsatz moderner grabenloser Technologien in Österreich.<br />
ÖGL – Die Branchenplattform für grabenlose Technologien<br />
Die ÖGL (Österreichische Vereinigung<br />
für grabenloses Bauen und<br />
Instandhalten von Leitungen), 1991<br />
als unabhängiger Verein gegründet,<br />
ist <strong>DAS</strong> Kompetenzzentrum für grabenlose<br />
Technologien in Österreich.<br />
Sie fungiert als Plattform für den<br />
Informationsaustausch zwischen Pla-<br />
nungs- bzw. Auftraggeberseite, die<br />
durch wichtige Repräsentanten der<br />
Ver- und Entsorgungswirtschaft vertreten<br />
ist, und den Anbietern der grabenlosen<br />
Technologien in Österreich.<br />
Informationen über die ÖGL und alle<br />
grabenlose Bauverfahren finden Sie<br />
unter www.grabenlos.at<br />
Die historische Altstadt<br />
Steyrs war<br />
Schauplatz einer<br />
beeindruckenden<br />
Demonstration der<br />
„grabenlosen Technologie“.<br />
Bei dem System „Schlauchinliner“ wird<br />
ein mit Epoxydharz getränker Schlauch<br />
in das Altrohr eingestülpt und mit Druck<br />
unterirdisch eingebracht.<br />
Erneuerungen von Leitungen investiert.<br />
Sie helfen lange Projektzeiten, Verkehrsbehinderungen<br />
und Staus, Lärm und<br />
Staub und teilweise beträchtliche Schäden<br />
an der Infrastruktur zu verhindern.<br />
Information<br />
Ihr Kontakt bei der ÖGL<br />
Schubertring 14, A-1010 Wien<br />
Mag. Dr. Ute Boccioli<br />
Geschäftsführerin<br />
Tel: +43/1/513 15 88-26<br />
Fax: +43/1/513 15 88-25<br />
E-Mail: boccioli@oegl.at<br />
KOMMUNAL 77
Wirtschafts-Info<br />
VOGEL bietet Spiralgehäuse- und Blockpumpen sowie Heizungsumwälzpumpen<br />
Pumpen für Biomasse Heizwerke<br />
Die Fernwärmeversorgung<br />
unter Nutzung von Biomasse<br />
als eine wirtschaftliche und<br />
umweltfreundliche Wärmeversorgung<br />
gewinnt zunehmend<br />
an Bedeutung.<br />
VOGEL bietet für diese<br />
Anwendungen ein komplettes<br />
Programm an Spiralgehäuseund<br />
Blockpumpen sowie Heizungsumwälzpumpen<br />
und<br />
Breites Anwendungsgebiet in allen Gemeinden<br />
Bauer Kommunaltankwagen<br />
Die BAUER GmbH beschäftigt<br />
sich seit über 75 Jahren mit<br />
der Herstellung von landwirt-<br />
Der Kommunaltankwagen.<br />
schaftlichen Produkten wie<br />
Beregnungs- und Gülletechnik<br />
sowie Umwelt-und Kommunaltechnik.<br />
Der BAUER Kommunaltankwagen<br />
hat ein breites<br />
Anwendungsfeld in der<br />
Wartung, Erhaltung und<br />
Pflege öffentlicher Einrichtungen<br />
und Anlagen. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
sind u.a.:<br />
◆ Durchspülen und Reinigen<br />
verstopfter Kanäle<br />
78 KOMMUNAL<br />
Foto: Bauer<br />
die Regeltechnologie das sich<br />
in zahlreichen Biomasse Heizwerken<br />
(im Bild das Heizwerk<br />
Stockerau, NÖ) bewährt hat.<br />
Der bewährte HYDROVAR<br />
Pumpenregler ermöglicht eine<br />
automatische Anpassung der<br />
◆ Aussaugen von Kanälen,<br />
Klär-, Senk- und Güllegruben<br />
◆ Ausbringen u. Verteilen von<br />
Klärschlamm und Gülle<br />
◆ Als stationäre Pumpstation<br />
zur Beregnung und Bewässserung<br />
(Blumenbeeten, Grünanlagen,<br />
Böschungen usw)<br />
◆ Straßenreinigen, Staubfreimachen<br />
u. Tunnelreinigung<br />
◆ Reinigen von Straßenbegrenzungspfählen<br />
und Leitplanken<br />
◆ Katastropheneinsatz: Keller<br />
auspumpen; Feuerlöscheinsatz.<br />
Information<br />
Röhren- und Pumpenwerk<br />
BAUER GmbH.<br />
A-8570 Voitsberg<br />
Tel.: 03142/200-0<br />
Fax: 03142/200-340<br />
E-Mail:<br />
sales@bauer-at.com<br />
Web: www.bauer-at.com<br />
E.E.<br />
Pumpen an die variablen<br />
Betriebsbedingungen, damit<br />
sind Energieeinsparungen bis<br />
zu 50 Prozent gegenüber<br />
einem ungeregelten Pumpenbetrieb<br />
erzielbar, was die<br />
Gesamteffizienz derartiger<br />
Einzigartiger Blitz- und Überspannungsschutz<br />
DEHNlimit PV vermeidet<br />
Versorgungslücken<br />
Der Typ-1-<br />
Kombi-Ableiter<br />
DEHNlimit PV<br />
1000 wurde speziell<br />
für Photovoltaik-Anlagen<br />
entwickelt. Er<br />
schützt Generator<br />
und Wechselrichter<br />
vor Überspannungen,<br />
auch bei direktenBlitzeinschlägen.<br />
Einzigartig ist die<br />
Gleichstrom unterbrechnung<br />
der Funkenstrecke. Mögliche<br />
Kurzschlussströme beim<br />
Ansprechen der Funkenstrecke<br />
von bis zu 100 A werden<br />
bei einer Photovoltaik-<br />
Spannung bis 1000 V DC<br />
innerhalb weniger Sekundenbruchteile<br />
unterbrochen.<br />
Der Schutzpegel des DEHNlimit<br />
PV 1000 und die durch<br />
DEHNlimit PV<br />
Anlagen weiter steigert.<br />
Für die Übergabestationen<br />
stehen hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen<br />
mit<br />
Permanent-Magnet Motortechnologie<br />
in Energieeffizienzklasse<br />
A zur Verfügung.<br />
Information<br />
Pumpenfabrik Ernst Vogel GmbH<br />
Ernst Vogel Straße 2<br />
2000 Stockerau<br />
Web: www.vogel-pumpen.com<br />
die Verwendung der<br />
Funkenstrecken-Technologie<br />
auftretende<br />
Impulszeitverkürzung<br />
des Spannungsimpulses<br />
ermöglichen erst die<br />
Koordination des Ableiters<br />
mit den zu schützenden<br />
Betriebsmitteln.<br />
Die Symbiose aus Blitzstrom-Tragfähigkeit,<br />
Schutzvermögen und<br />
Folgestromlöschung bietet<br />
der Photovoltaik-<br />
Anlage höchste Verfügbarkeit.<br />
Information<br />
DEHN AUSTRIA<br />
Volkersdorf 8<br />
A-4470 Enns<br />
Telefon 07223 / 80356<br />
Fax 07223 / 80373<br />
Web: www.dehn.at<br />
E-Mail: info@dehn.at<br />
E.E.<br />
E.E.
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
Fünfjahresvergleich Ehrenamt: Bereitschaft zum Engagement ist im Zunehmen<br />
Keine Rede vom „Verdunsten“<br />
SALZBURG<br />
„Von einer Verdunstung des<br />
Ehrenamts kann keine Rede<br />
sein. Es stimmt zwar, dass in<br />
Bereichen des Sozialen und<br />
der Nächstenhilfe zunehmend<br />
mehr Personen beruflich<br />
tätig sind, insbesondere<br />
Frauen. In den meisten anderen<br />
Feldern, in denen Freiwillige<br />
arbeiten, sind aber<br />
teils starke Steigerungen der<br />
Anzahl von Mitarbeiter/<br />
innen zu verzeichnen“,<br />
betont der Zweite Landtagspräsident<br />
Michael Neureiter<br />
Partnerschaften<br />
EU-Förderungen<br />
für Gemeinden<br />
BRÜSSEL<br />
Österreichs Gemeinden wurden<br />
heuer bereits zum zweiten<br />
Mal von der EU finanziell<br />
gefördert. Insgesamt 15<br />
Gemeinden erhalten für ihre<br />
aktive Gestaltung der internationalen<br />
Zusammenarbeit<br />
rund 38.000 Euro. Gemeinden<br />
können sich für die<br />
Partnerschaftsprojekte 2008<br />
bei der EU bewerben.<br />
Klima-Studie: Veränderung bei Artenvielfalt<br />
Fichten & Fische akut gefährdet<br />
ÖSTERREICH<br />
Eine neue Studie der Universität<br />
für Bodenkultur<br />
Wien im Auftrag der Österreichischen<br />
Bundesforste<br />
(ÖBf) und des WWF zeigt,<br />
wo und wie sich der Klimawandel<br />
in Österreich auf<br />
unsere Wälder und die<br />
Artenvielfalt auswirken<br />
wird. Die Fichte als häufigste<br />
heimische Baumart ist<br />
der große Verlierer des<br />
Temperaturanstiegs. Auch<br />
mehrere Fischarten sind<br />
Foto: BMLFUW<br />
anlässlich der Vorlage des<br />
„Salzburger Zahlenspiegels<br />
2007“ durch Landesstatistiker<br />
Josef Raos.<br />
Tatsächlich stiegen im<br />
Bereich der Kultur und des<br />
Sports die Zahlen der Aktiven<br />
in den Jahren von 2000<br />
bis 2005 teils beträchtlich.<br />
„Freiwillige Dienste leben<br />
wesentlich von der Motivation<br />
und auch von den Rahmenbedingungen“,<br />
betont<br />
der Zweite Landtagspräsident:<br />
„Die öffentlichen<br />
Hände haben die Verpflich-<br />
WR. NEUSTADT<br />
Der Abwasserverband Wiener<br />
Neustadt-Süd steigt mit<br />
einem dreistufigen Programm<br />
verstärkt in die Ökoenergie-Erzeugung<br />
ein und<br />
wird in Zukunft vermehrt<br />
Strom und Wärme aus Klär-<br />
durch den Klimawandel<br />
akut gefährdet. Die Verschiebung<br />
des Vegetationsgürtels<br />
wird zahlreiche<br />
Arten zur Abwanderung in<br />
die Höhe zwingen oder sie<br />
aussterben lassen. WWF<br />
und Bundesforste haben<br />
nun eine Reihe von Empfehlungen<br />
zu Waldwirtschaft,<br />
Wasserbau und<br />
Naturschutz für die kommenden<br />
Jahrzehnte erarbeitet.<br />
Mehr auf www.wwf.at<br />
oder www.bundesforste.at<br />
tung, bestmögliche Rahmenbedingungen<br />
für den Einsatz<br />
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter in den<br />
verschiedensten Bereichen zu<br />
schaffen bzw. weiter zu entwickeln.<br />
Dazu gehören<br />
sowohl Maßnahmen der<br />
Absicherung etwa durch eine<br />
österreichweite Unfallversicherung<br />
für Freiwillige als<br />
auch die Anerkennung der<br />
Kompetenz und Erfahrung<br />
von Ehrenamtlichen etwa bei<br />
Anstellungen im Öffentlichen<br />
Dienst.“<br />
Ökoenergie: Abwasserverband wird Energieerzeuger<br />
Strom & Wärme aus Gas & Schlamm<br />
Foto: BMLFUW<br />
gas bzw. Klärschlamm produzieren<br />
und am Energiemarkt<br />
verkaufen. Der erste Schritt<br />
wird bereits diesen Herbst<br />
verwirklicht, wenn ein zweites<br />
Blockheizkraftwerk in<br />
Betrieb gehen wird.<br />
Gewässerprüfung wird in<br />
Kärnten groß geschrieben<br />
– der Lohn ist die Trinkwasserqualität.<br />
Foto: Schatteiner<br />
Salzburgs Zweiter Landtagspräsident<br />
Michael Neureiter<br />
(rechts) zeichnet engagierte<br />
MitarbeiterInnen von Heimatvereinen<br />
in Abtenau aus.<br />
Wohnbauförderung<br />
Bauwirtschaft auf<br />
Touren gehalten<br />
EISENSTADT<br />
„Der burgenländische Wohnbauförderungsbeirat<br />
hat 42,2<br />
Millionen Euro für Bauvorhaben<br />
genehmigt“, informiert<br />
LAbg. Bgm. Gerhard Pongracz<br />
in seiner Funktion als<br />
Vorsitzender des Wohnbauförderungsbeirates.„Insgesamt<br />
sind heuer bereits<br />
77,7 Mio. Euro an Wohnbaumitteln<br />
freigegeben worden.“<br />
Lob für Kärntens Seen<br />
Badespaß mit<br />
Sicherheit<br />
KLAGENFURT<br />
Mit Schulschluss war auch<br />
große Zeugnisverteilung für<br />
42 Kärntner Badeseen. Und<br />
wie schon die Jahre zuvor<br />
konnte Umwelt- und Wasserwirtschaftsreferent<br />
LR Reinhart<br />
Rohr Bestnoten verteilen.<br />
Fazit: Kärntens „größte Badewannen“<br />
sind hygienisch einwandfrei<br />
und zählen zu den<br />
saubersten Gewässern in ganz<br />
Europa, wie kürzlich auch die<br />
EU bestätigte.
Sicherheit<br />
Was beim Bergwandern beachtet werden sollt<br />
Wenn der Berg ruft<br />
Keine Frage – neben zahlreichen Seen, sind vor allem die Berge Anziehungspunkt Nummer<br />
eins in Österreich. Jetzt, zu einer Zeit in der der Herbst naht, zieht es viele Wanderfreunde<br />
noch einmal ins Gebirge.<br />
◆ Dr. Othmar Thann<br />
Dass Bergwandern nicht nur Hochgenuss,<br />
sondern mitunter auch ein hohes<br />
Risiko bedeuten kann, zeigen die nüchternen<br />
Zahlen der<br />
Statistik. Jährlich<br />
sterben rund 100<br />
Menschen durch<br />
Unfälle beim Wandern<br />
und Bergsteigen<br />
in Österreich. Alleine<br />
im Jahr 2005 haben<br />
sich etwa 7200 Menschen<br />
so schwer verletzt,<br />
dass sie im<br />
Krankenhaus behandelt<br />
werden mussten.<br />
Die Unfallfolgen:<br />
Knochenbrüchen mit<br />
44 Prozent, Sehnenund<br />
Muskelverletzungen mit 20 Prozent.<br />
Zwölf Prozent aller Verletzungen<br />
sind Kopfverletzungen.<br />
Stürze als häufigste<br />
Unfallursache – Senioren<br />
besonders betroffen<br />
Ausrutschen oder Stolpern nehmen mit<br />
70 Prozent bei den Unfallursachen den<br />
ersten Platz ein. Zwölf Prozent verlet-<br />
◆ Dr. Othmar Thann ist Direktor<br />
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit<br />
(KfV)<br />
80 KOMMUNAL<br />
zen sich aufgrund von Stürzen aus der<br />
Höhe. Senioren ab 60 sind von Unfällen<br />
auf Österreichs Bergen besonders<br />
betroffen.<br />
Obwohl<br />
diese Alters-<br />
gruppe nur<br />
22 Prozent<br />
der Bevölkerungausmacht,<br />
sind<br />
32 Prozent<br />
der Verunfallten<br />
60<br />
Jahre und<br />
älter. AusreichendeVorbereitung,<br />
die<br />
richtige Ausrüstung und eine realistische<br />
Einschätzung der eigenen Fitness,<br />
tragen maßgeblich dazu bei, Unfall -<br />
risken zu minimieren.<br />
Gute Vorbereitung ist beim<br />
Bergwandern die halbe Miete.<br />
Besonders wichtig sind die<br />
Planung der Wanderroute und<br />
ausreichende Informationen<br />
über die Beschaffenheit und<br />
Schwierigkeitsgrad der Wege.<br />
Angemessene Ausrüstung<br />
Das richtige Schuhwerk – am besten<br />
professionelle Wanderschuhe mit entsprechendem<br />
Profil – ist für Bergsteiger<br />
und Wanderer essenziell. Mit dem so<br />
genannten „Zwiebellook“ ist man in der<br />
Bergwelt für alle Witterungsverhältnisse<br />
gewappnet. Mehrere dünne Kleidungsstücke<br />
übereinander ermöglichen<br />
die Anpassung an das jeweilige Wetter.<br />
Was für andere Sportarten gilt, trifft<br />
selbstverständlich auch auf das Bergwandern<br />
zu: Immer ausreichend Flüssigkeit<br />
und Energie aufnehmen. Für<br />
Proviant eignen sich besonders Wasser<br />
oder gespritzter Apfelsaft sowie kleine<br />
Häppchen energiereicher Nahrung,<br />
etwa Müsliriegel oder Obst. Auch ein<br />
Erste Hilfe-Paket sollte Teil der Ausrüstung<br />
sein, ebenso ein Mobiltelefon,<br />
um im Ernstfall Hilfe anzufordern<br />
(Euro Notruf: 112/Alpinnotruf: 140).<br />
Gute Vorbereitung<br />
Gute Vorbereitung ist beim Bergwandern<br />
die halbe Miete. Besonders wichtig<br />
ist die Planung der Wanderroute<br />
und ausreichende Informationen über<br />
die Beschaffenheit und Schwierigkeitsgrad<br />
der Wege. Denn Müdigkeit und<br />
Erschöpfung sind bei einer Bergtour<br />
große Risikofaktoren. Deshalb bietet es<br />
sich an, mit allen Teilnehmern die<br />
geplante Tour im Vorfeld zu besprechen.<br />
Selbstverständlich muss Rücksicht<br />
auf den körperlichen Zustand der
einzelnen Wanderer genommen werden<br />
– auch die eigene Konstitution<br />
sollte man kennen. Einem „im Tal<br />
Gebliebenen“ das eigenen Wanderziel<br />
mitzuteilen und Informationen über<br />
den aktuellen Wetterbericht einzuholen<br />
ist ebenso wichtig wie zu wissen, an<br />
welchem Ort sich die nächste Schutzhütte<br />
befindet. Zieht trotzdem schlechtes<br />
Wetter auf, sollte die Tour sofort<br />
abgebrochen und eine Hütte aufgesucht<br />
werden. Ist es nicht mehr möglich<br />
einem Gewitter zu entkommen,<br />
müssen allein stehende Bäume, Draht-<br />
Auch ein Erste<br />
Hilfe-Paket sollte<br />
Teil der Ausrüstung<br />
sein, ebenso ein<br />
Mobiltelefon, um<br />
im Ernstfall Hilfe<br />
anzufordern.<br />
seile, Liftstützen und Wasserläufe auf<br />
jeden Fall gemieden werden. Wer mitten<br />
in ein Gewitter gerät sollte sich eine<br />
Mulde suchen und eine möglichst<br />
kleine Bodenfläche berühren indem die<br />
Füße eng geschlossen sind. Bei dichtem<br />
Nebel oder Regen kann der Wanderer<br />
leicht die Orientierung verlieren – ein<br />
Kompass ist hier von großem Nutzen.<br />
Heimtückisch ist auch die Situation bei<br />
Schneefall, da die Landschaft bereits<br />
mit wenigen Zentimetern Schnee völlig<br />
verändert aussehen kann.<br />
Grundsätzlich gilt beim Wandern:<br />
◆ Niemals alleine auf den Berg gehen<br />
◆ Eine Person, die nicht mitwandert<br />
über die geplante Route informieren<br />
◆ Zeitliche Reserven einplanen<br />
◆ Markierte Wege nicht verlassen<br />
◆ Regelmäßige Pausen<br />
◆ Ausreichend Proviant<br />
◆ Karte, Kompass und Handy mit -<br />
nehmen<br />
◆ Ausdauertraining im Vorfeld der<br />
Bergwanderung<br />
◆ Wind-, Kälte- und Regenschutz nicht<br />
vergessen<br />
◆ Sonnenschutz mitführen<br />
Wer diese Tipps beherzigt und mit ausreichender<br />
Vorbereitung und angemessener<br />
Ausrüstung in die Berge startet,<br />
wird das Naturvergnügen in vollen<br />
Zügen genießen können.<br />
Spurwege fügen sich nicht nur in Gutenberg<br />
an der Raabklamm harmonisch ins<br />
Naturbild, sie wären auch für viele<br />
andere ländliche Gemeinden geeignet.<br />
GUTENBERG an der RAABKLAMM<br />
Viele Jahrzehnte waren es Naturwege –<br />
seit 1987 sind zahlreiche Hofzufahrten<br />
in Gutenberg Spurwege. Ohne große<br />
Eingriffe in die Landschaft wurden die<br />
Spurwege in Gutenberg auf der bestehenden<br />
Wegtrasse gebaut. Viele Argu-<br />
mente für den Spurweg wurden damals<br />
schon angeführt und bestätigten sich<br />
im Anschluss auch vollständig. Damals<br />
wurde ein Zeitraum von 15 Jahren mit<br />
geringsten Wegerhaltungskosten angenommen.<br />
Es sind inzwischen 20 Jahre<br />
vergangen und die Spurwege fügen<br />
sich immer mehr in das Landschaftsbild<br />
der Gemeinde Gutenberg, ohne zusätzliche<br />
Erhaltungskosten zu verursachen.<br />
Und dies geschah trotz zahlreicher<br />
Unwetter die in diesem Zeitraum auf<br />
die Spurwege niedergegangen, ohne<br />
Aus den Gemeinden<br />
Der Spurweg feiert sein 20-Jahr Jubiläum<br />
Naturnah und hart im<br />
Nehmen – trotzdem out<br />
jedoch gravierende Abschwemmung zu<br />
verursachen.<br />
Was den Spurwegen mehr zu schaffen<br />
macht, ist der schwere Milchtank LKW-<br />
Verkehr, der erst vor wenigen Jahren<br />
den Traktor bzw. das Milchwagerl ablöste.<br />
Das größte Hindernis für die Ausbreitung<br />
der Spurwege stellt jedoch die<br />
Tatsache dar, dass die Asphaltfirmen<br />
kein großes Interesse für diese Art des<br />
Wegausbaues zeigen, da bei gleichem<br />
Arbeitsaufwand um 1/3 weniger<br />
Asphalt benötigt wird. So wurde der<br />
Spurweg bereits bei der „Geburt“<br />
begraben, obwohl viele Anfragen aus<br />
ganz Österreich eingingen und immerhin<br />
auch einige Spurwege in anderen<br />
Gemeinden gebaut wurden. Nichtsdes -<br />
totrotz stellt der Ausbau von bestehenden<br />
Hofzufahrten zum Spurweg in<br />
Anbetracht immer kleinerer Gemeindeund<br />
Landesbudgets für den Straßenbau<br />
eine wirtschaftlich und landschaftlich<br />
attraktive Alternative (siehe Fotos) zu<br />
Neutrassierungen von Hofzufahrten<br />
dar, die oft einen krassen Eingriff in die<br />
Natur mit sich bringen. In Österreich<br />
und vor allem unseren östlichen Nachbarn<br />
sind zweifellos noch unzählige<br />
Hofzufahrtswege als Karrenwege vorhanden,<br />
für die ein Ausbau zum Spurweg<br />
in Erwägung gezogen werden<br />
sollte.<br />
Franz Klammler, Altbürgermeister von<br />
Gutenberg/Raabklamm, Stmk.<br />
KOMMUNAL 81
Wettbewerb<br />
Gründach-Wettbewerb<br />
Einreichen noch bis<br />
31. August möglich<br />
WIEN<br />
Bis 31. August läuft noch die Einreichfrist<br />
für den ersten Österreichischen Gründach-Städtewettbewerb,<br />
initiiert vom Verband<br />
für Bauwerksbegrünung (V.f.B.).<br />
Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen<br />
Gemeinden, in denen sich Gründächer<br />
befinden. Ziel des Wettbewerbs ist<br />
die Auszeichnung der Gemeinden mit<br />
sehenswerten Gründach-Umsetzungen.<br />
Mit dem „1. Österreichischen Gründach-<br />
Städtewettbewerb“ prämiert der Verband<br />
für Bauwerksbegrünung Städte und<br />
Gemeinden, in denen sehenswerte Gründächer<br />
umgesetzt wurden. „Ein Ziel des<br />
Gründach-Wettbewerbs ist es, das<br />
Bewusst sein der Bewohner, Planer und<br />
Entwickler in Städten und Gemeinden für<br />
Begrünungen zu vertiefen bzw. aufzuzeigen,<br />
welche Möglichkeiten der Bauwerksbegrünung<br />
es gibt“, betont Gerold Steinbauer,<br />
Obmann des V.f.B. So soll auch zur<br />
Umsetzung weiterer Gründächer angespornt<br />
werden, Argumente für Gründächer<br />
offen gelegt und die Möglichkeiten<br />
der Unterstützung bzw. bestehende<br />
Förderung von Dachbegrünungen in den<br />
Gemeinden erhoben und kommuniziert<br />
werden.<br />
Zur Teilnahme am Gründach-Wettbewerb<br />
sind alle österreichischen Kommunen<br />
berechtigt. Eingereicht werden können<br />
auch geförderte Privatobjekte bzw. laut<br />
Raumplanung vorgeschriebene Dachbegrünungen.<br />
Entscheidendes Kriterium für<br />
die Einreichung sind herausragende und<br />
sehenswerte Gründachobjekte<br />
(größte/schönste Gründach) in der<br />
Gemeinde/in der Stadt.<br />
Die Siegerstadt/-gemeinde erhält neben<br />
der nationalen Vorstellung auch Gelegenheit,<br />
sich im internationalen Gründach-<br />
Forum Europäische Föderation Bauwerksbegrünung<br />
(EFB) zu präsentieren.<br />
Näheres zum „1. Österreichischen Gründach-Städtewettbewerb“<br />
unter<br />
www.gruendach.at<br />
82 KOMMUNAL<br />
Auszeichnung für besonderes Engagement<br />
„Zivildiener<br />
des Jahres“<br />
In seinem über 30-jährigen Bestehen ist der Zivildienst<br />
immer mehr zu einem unverzichtbaren Teil gemeinnützigen<br />
Handelns in Österreich geworden. Der Gemeinde -<br />
minister sucht deshalb den „Zivildiener des Jahres“.<br />
KOMMUNAL informiert und lädt zum Mitmachen ein.<br />
Gerade die österreichischen Gemeinden<br />
profitieren im besonderen Maße von den<br />
Leistungen der Zivildienstleistenden, da<br />
das Rettungswesen und die zahlreichen<br />
sozialen Aufgabenstellungen den Hauptfokus<br />
dieses Dienstes an der Gemeinschaft<br />
bilden. Damit der soziale Bereich<br />
und insbesondere die Gemeinden auch<br />
in Zukunft auf diese engagierten jungen<br />
Männer zählen können, ist es wichtig,<br />
dass auch die Rahmenbedingungen für<br />
den Zivildienst stimmen. Selbstverständlich<br />
ist die Entscheidung zum Zivildienst<br />
eine individuelle Gewissensentscheidung,<br />
doch haben gerade die Reformen<br />
der letzten Jahre einen beachtlichen<br />
Zugewinn für diesen Wehrersatzdienst<br />
mit sich gebracht. Konnten im Jahr 2000<br />
gerade einmal 6326 junge Männer einer<br />
sozialen Einrichtung zugewiesen werden,<br />
haben sich die Zuweisungszahlen in<br />
nur sechs Jahren auf nahezu 12.000<br />
Zuweisungen erhöht und somit fast verdoppelt.<br />
Auch nach der Verkürzung der<br />
Wehrpflicht auf sechs und der Verkürzung<br />
des Zivildienstes auf neun Monate<br />
haben sich immer mehr junge Männer<br />
für den Zivildienst entschieden.<br />
Durch diese erfolgreichen Reformen ist<br />
das Interesse am Zivildienst stark gestiegen,<br />
aber auch sein Wert für die Allge-<br />
meinheit, seine Akzeptanz in der Bevölkerung<br />
sowie seine Tätigkeitsfelder sind<br />
stets gewachsen.<br />
Diese Entwicklung war und ist nur mög-<br />
Gemeindeminister Günther Platter sucht<br />
den „Zivildiener des Jahres“.
lich durch den persönlichen Einsatz jener<br />
Zivildienstleistenden, die ihren Dienst<br />
nicht nur als Pflicht verstehen, sondern<br />
mit beherztem Einsatz, Einfühlungsvermögen<br />
und Engagement die Institution<br />
Zivildienst durch ihr tagtägliches Verhalten<br />
mit Leben<br />
erfüllen.<br />
Ein weiterer<br />
Schritt, den<br />
Zivildienst<br />
noch attraktiver<br />
zu<br />
machen und<br />
seine Leistungen<br />
nicht nur<br />
den unmittelbarBetroffenen<br />
vor<br />
Augen zu<br />
führen, ist die<br />
Einführung<br />
einer besonderenAuszeichnung<br />
für<br />
Zivildiener. Daher ist es Bundesminister<br />
Günther Platter ein großes persönliches<br />
Anliegen, als Zeichen der Anerkennung<br />
und Wertschätzung dieses Einsatzes den<br />
„Zivildiener des Jahres“ zu ermitteln und<br />
mit einem Preis auszuzeichnen.<br />
Dabei darf auch um die tatkräftige<br />
Unterstützung der Gemeinden ersucht<br />
werden, denn nominiert werden kann<br />
der potentielle „Zivildiener des Jahres“<br />
von Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten<br />
sowie von all jenen, die von der<br />
Dienstausübung des jungen Mannes profitiert<br />
haben.<br />
Eine Jury aus Persönlichkeiten, die mit<br />
dem Zivildienst eng verbunden sind,<br />
wird aus allen fristgerecht eingereichten<br />
Nominierungen einen Gewinner für<br />
jedes Bundesland eruieren. Aus den<br />
neun Bundesländerpreisträgern wird in<br />
weiterer Folge der gesamtösterreichische<br />
Zivildiener des Jahres ermittelt.<br />
Der Einsendeschluss für Nominierungen<br />
ist der 10. Jänner 2008, wobei der<br />
Rechtsweg ausgeschlossen ist.<br />
Nominiert werden<br />
kann der potentielle<br />
„Zivildiener des Jahres“<br />
von Kollegen, Mitarbeitern<br />
und Vorgesetzten,<br />
sowie von all jenen, die<br />
von der Dienstausübung<br />
des jungen Mannes<br />
profitiert haben.<br />
Mehr Information<br />
Nähere Informationen gibt es<br />
auch auf der Homepage der<br />
Zivildienstserviceagentur unter<br />
www.zivildienst.gv.at<br />
GROSS-SIEGHARTS<br />
Am 18. Juni fand das zweite österreichisch-tschechischeBürgermeistertreffen<br />
unter der Schirmherrschaft der<br />
österreichischen Botschafterin in Tschechien,<br />
Margot Klestil-Löffler, statt.<br />
Nachdem das Treffen im Vorjahr zum<br />
ersten Mal in Budweis stattgefunden<br />
hatte, war diesmal Groß-Siegharts Austragungsort.<br />
Die Bürgermeister aller österreichischen<br />
und tschechischen Städte und<br />
Gemeinden, die eine Partnerschaft mit<br />
dem Nachbarland haben, waren eingeladen,<br />
um sich mit ihren Kollegen aus<br />
dem Nachbarland auszutauschen und<br />
sich gemeinsam bei verschiedenen<br />
Fachreferaten zum Thema „nachhaltiges<br />
Wirtschaften als kommunale Herausforderung“<br />
zu informieren. Unter<br />
anderem nahmen auch Vertreter der<br />
Länder NÖ, OÖ, der benachbarten<br />
tschechischen Kreise sowie Vertreter<br />
aus Wirtschaft, Politik und den Interessensvertretungen<br />
an der Tagung teil.<br />
Vertreter Niederösterreichs war GVV-<br />
Vizepräsident LAbg. Karl Moser.<br />
Botschafterin Klestil-Löffler: „Im grenzübergreifenden<br />
Austausch und bei der<br />
Zusammenarbeit spielen die Gemeinden<br />
eine besonders wichtige Rolle. Verbindungen<br />
im Wege von unterschiedlichen<br />
Institutionen in den Gemeinden,<br />
wie etwa im Bereich der Schulen, gemeinnützigen<br />
Vereinen, Wirtschaft, Kultur<br />
und Sport sind eine wichtige<br />
Grundlage für eine produktive grenzübergreifende<br />
Zusammenarbeit.<br />
Tagung<br />
Prof. Dietmar Pilz (Österreichischer Gemeindebund), NÖ-GVV-VP-Vizepräsident Karl<br />
Moser, Sibylle Umgeher (Städtebund NÖ-Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl,<br />
Botschafterin Margot Klestil-Löffler, LAbg. Gabriele Lackner-Strauss (Land OÖ/Wirtschaftsbund),<br />
Reinhard Troper (Städtebund), Eva Farkácvá (ecoplus Prag) und Präs.<br />
Anton Koczur (IIZ Groß-Siegharts).<br />
Tagung österreichischer und tschechischer Partnergemeinden<br />
Gelebte Partnerschaft<br />
Die Fachreferenten des Gemeindebundes,<br />
Städtebundes und ihr Kollege aus<br />
Tschechien stellten zuerst einen allgemeinen<br />
Zugang zum Thema Nachhaltigkeit<br />
her und veranschaulichten dann<br />
regionale Vernetzungsmöglichkeiten.<br />
Begleitend zu den Vorträgen hatte die<br />
WKO Außenhandelsstelle in Prag Firmenpräsentationen<br />
organisiert. In den<br />
Pausen konnten sich die Teilnehmer<br />
über die verschiedenen Angebote und<br />
Leistungen informieren.<br />
Für die Organisation der Tagung zeichnete<br />
das Internationale Interkommunale<br />
Zentrum (IIZ) Groß-Siegharts verantwortlich,<br />
das seitens der Teilnehmer<br />
viel Lob für die hervorragende Durchführung<br />
erhielt. Aufgrund des großen<br />
Erfolges wird es natürlich 2008 das<br />
3. österreichisch-tschechische Bürgermeistertreffen<br />
geben: Die Botschafterin<br />
verkündete, dass während der Tagung<br />
auch bereits der Austragungsort festgelegt<br />
wurde: 2008 wird die Konferenz in<br />
Jihlava, der Hauptstadt des Kreises<br />
Vysočina, stattfinden.<br />
Mehr Information<br />
Ulrike Trinkl<br />
IIZ (Internationales Interkommunales<br />
Zentrum)<br />
Schlossplatz 2,<br />
3812 Groß-Siegharts<br />
Tel: 02847/ 84198,<br />
E-Mail: iiz.trinkl@siegharts.at<br />
KOMMUNAL 83
Tagungen<br />
19. Bürgermeistertag in Wieselburg<br />
Miteinander zum Erfolg<br />
Starke Städte brauchen einen erfolgreichen ländlichen Raum. Und umgekehrt profitieren<br />
blühende Regionen von pulsierenden Städten. Ein gemeinsames Miteinander kann<br />
nachhaltig zum Erfolg führen. Vor dem Hintergrund der Globalisierung werden<br />
Kooperationen immer wichtiger. Darin waren sich die Vortragenden des<br />
19. Bürgermeistertages in Wieselburg einig.<br />
Bauernbund-Präsident und Forum Land-<br />
Obmann Fritz Grillitsch betonte in seiner<br />
Eröffnungsrede die Wichtigkeit neuer<br />
Kommunikationstechnologien für den<br />
ländlichen Raum. „Breitband ist eine Riesenchance<br />
für unsere ländlichen Räume<br />
und bringt nicht nur die Welt ins Dorf,<br />
sondern umgekehrt ermöglicht es uns<br />
diese Technologie in Sekundenschnelle<br />
unsere Ideen hinauszutragen“, sagte Gril-<br />
LAA an der THAYA<br />
Soziale Schwerpunkte regional abzugleichen<br />
und zukunftsweisende Konzepte<br />
entwickeln war der Tenor des 1. Österreichisch-tschechischenBürgermeisterInnentreffen<br />
zum Thema EUREGIO social<br />
und EUREGIO kommunal.<br />
Das Weinviertel Management lud am 19.<br />
Juni zu einer ersten grenzüberschreitenden<br />
Gesprächsrunde zum Thema „Macht<br />
Soziales vor der Grenze halt? Zur Situation<br />
im Grenzraum“ in Laa an der Thaya.<br />
24 GemeindevertreterInnen aus dem<br />
Weinviertel und aus Südmähren nahmen<br />
Therese Reinel und Eva Maria Stein-<br />
84 KOMMUNAL<br />
litsch. Auch VP-Klubobmann Wolfgang<br />
Schüssel unterstrich die Bedeutung eines<br />
leistungsfähigen Datennetzes, denn so<br />
könne endlich die Arbeit zu den Menschen<br />
kommen und nicht umgekehrt.<br />
„Qualifizierte Arbeitsplätze entstehen<br />
somit auch außerhalb der Zentren“, so<br />
Schüssel.<br />
Die Mittel aus dem Finanzausgleich sind<br />
die Grundlage der Gemeinden, mit denen<br />
mayer vom Weinviertel Management<br />
stellten die grenzüberschreitenden Projekte<br />
EUREGIOkommunal und EURE-<br />
GIOsocial vor, deren Ziel die Verbesserung<br />
der grenzüberschreitenden Kooperationen<br />
im sozialen bzw. kommunalen<br />
Bereich sind. LAbg. Bgm. Karl Wilfing<br />
aus Poysdorf und Bgm. Jana Vlkova aus<br />
der tschechischen Gemeinde Hlohovec<br />
gaben einen kurzen Überblick über die<br />
jeweilige Situation aus Sicht der Gemeinden.<br />
Beide erachteten den Ausbau der<br />
Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten<br />
zuhause als wichtigen Punkt. LAbg. Bgm.<br />
Herbert Nowohradsky sprach aus der<br />
Sicht des Hilfswerkes und gab einen<br />
Überblick über die Entwicklung der<br />
mobilen Dienstleistungsorganisation und<br />
deren Angebote für Gemeinden. Bgm.<br />
Georg Jungmayer aus Seefeld-Kadolz<br />
stellte die Projektidee des grenzüberschreitenden<br />
Generationenhauses mit<br />
Jaroslavice vor.<br />
In den anschließenden zwei Gesprächsrunden<br />
wurde über mögliche Kooperationen<br />
im kommunalen und sozialen<br />
Bereich diskutiert. Folgende Themen<br />
wurden dabei sowohl im Weinviertel als<br />
auch in Südmähren als dringlich identifiziert:<br />
Generationenproblematik mit dem<br />
sie die Lebensqualität ihrer Bewohner<br />
garantieren. Zu den Aufgaben der<br />
Gemeinden zählen nicht nur die Wasserversorgung,<br />
Abwasser- und Müllbeseitigung<br />
und der Straßenbau, sondern auch<br />
die Bereiche der Kinderbetreuung oder<br />
der Ausbildung. Er sprach sich in diesem<br />
Zusammenhang für eine weitere Anhebung<br />
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels<br />
für kleine Gemeinden aus.<br />
Grenzüberschreitende Kooperation: Macht Soziales vor einer Grenze halt?<br />
50 Jahre tote Grenze – und immer noch Spuren<br />
Der Eiserne Vorhang hat sich gehoben, nur<br />
mehr Schilde künden davon. Aber in den<br />
Köpfen sitzen Grenzen oft länger.<br />
Thema der Abwanderung, Wohnen,<br />
Infrastruktur und Verkehrsverbindungen,<br />
Pflege- und Betreuung zuhause, Kleinstkinderbetreuung,<br />
Sprachkompetenz<br />
(auch Sprachkurse für BürgermeisterInnen)<br />
und Freizeitangebote in den<br />
Gemeinden, Aufrechterhaltung des Schulund<br />
Kindergartenbetriebes, Kanalisation,<br />
Grenzübergänge.<br />
Weitere Gesprächsrunden sind geplant.<br />
Die nächste findet zum Thema „grenzüberschreitende<br />
Schulkooperationen“ statt.<br />
Im Oktober 07 steht die diesjährige<br />
EUREGIO Tagung ganz im Zeichen der<br />
grenzüberschreitenden sozialen Kooperationen.<br />
Die Teilnehmer an der 1. Österreichisch-<br />
Tschechischen Bürgermeisterkonferenz.
Die Referenten des Bürgermeistertages: Sixtus Lanner, Obmann der ARGE Ländlicher<br />
Raum, VP-Klubobmann Wolfgang Schüssel, Josef Ober vom Steirischen Vulkanland,<br />
Fritz Grillitsch, Obmann von Forum Land, Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen<br />
Städtebundes und Günther Leichtfried, Bürgermeister von Wieselburg.<br />
Grillitsch: „Jeder Bürger muss gleich viel<br />
wert sein – egal ob aus der Stadt oder<br />
vom Land.“ Es müssten Anreize zu einer<br />
verstärkten Nutzung von Synergien<br />
gesetzt werden.<br />
»<br />
In den kommenden<br />
Verhandlungen müssen<br />
wir auch den Weg zu<br />
einem aufgaben -<br />
orientierten Finanzausgleich<br />
kontinuierlich<br />
weiter beschreiten.<br />
«<br />
Fritz Grillitsch<br />
Der Forum Land-Obmann war sich in<br />
diesem Punkt mit Städtebund-General<br />
Thomas Weninger einig<br />
„In den kommenden Verhandlungen<br />
müssen wir auch den Weg zu einem aufgabenorientierten<br />
Finanzausgleich kontinuierlich<br />
weiter beschreiten“, waren sich<br />
Grillitsch und Thomas Weninger, Generalsekretär<br />
des Österreichischen Städtebundes<br />
einig.<br />
„Städte sind Motoren für Wirtschaft und<br />
Arbeit. Europa und Österreich brauchen<br />
starke Städte“, betonte Weninger dann<br />
die Wichtigkeit der urbanen Räume. „Die<br />
Bedeutung der Städte nimmt weltweit<br />
zu, und die Verstädterung der Welt verändert<br />
Landschaften und Menschen. Dabei<br />
werden Sitten und Bräuche urbanisiert“,<br />
so Weninger. Die interkommunale<br />
Zusammenarbeit sei ausbaufähig und<br />
verbesserungswürdig, auch über Bundes-<br />
ländergrenzen hinweg. Städte seien wichtige<br />
Akteure der Regionen und Zentren<br />
von Bildung und Wachstum. Gleichzeitig<br />
stellte er aber auch klar, dass umgekehrt<br />
starke Regionen wichtig sind für die<br />
Städte.<br />
„Die menschlichen, naturräumlichen und<br />
wirtschaftlichen Potenziale sichtbar zu<br />
machen als Inspiration für eine eigenstän-<br />
Wie Gemeinden mit Contracting sparen<br />
Breite Anwendungsfelder<br />
ST. PÖLTEN<br />
Wie können österreichische Gemeinden<br />
gleichzeitig ihren Energieverbrauch<br />
senken und ihre Kosten reduzieren,<br />
ohne die Versorgungssicherheit zu<br />
gefährden? Contracting setzt sich<br />
immer stärker als ideale Lösung durch.<br />
Die Einsatzmöglichkeiten, Voraussetzungen<br />
und Einsparpotenziale präsentierte<br />
Platzer & Partner im Rahmen<br />
einer Fachtagung in Kooperation mit<br />
der DECA (Dachverband Energie-Contracting<br />
Austria) und der Zeitschrift<br />
Kommunal im WIFI St. Pölten vor 20<br />
interessierten österreichischen Gemeindevertretern.<br />
Ob Strom, Wärme oder Druckluft: Mit<br />
Contracting-Verträgen können Kommunen<br />
die Aufgaben der Bereitstellung<br />
bzw. Lieferung von Betriebsstoffen und<br />
den Betrieb zugehöriger Anlagen auf<br />
ein externes Dienstleistungsunternehmen<br />
übertragen. Auch bei anderen<br />
Betriebsstoffen wie Erdöl/Erdgas, Solarenergie,<br />
Sonderbrennstoffen, aber<br />
auch bei Hausmüll, Ampeln, Straßenoder<br />
Innenbeleuchtung und Regenwassernutzungsanlagen<br />
bietet sich Contracting<br />
an.<br />
Mag. Martin Platzer, geschäftsführender<br />
Gesellschafter Platzer & Partner<br />
Unternehmensberatungsgesellschaft<br />
mbH, stellte einige Anwendungsbeispiele<br />
in den Bereichen Heizungsanlagen<br />
eines Amtsgebäudes, Erneuerung<br />
Tagungen<br />
dige regionale Entwicklung. Das sind die<br />
Stärken unserer ländlichen Räume“,<br />
betonte der Obmann des Steirischen<br />
Vulkanlandes, Josef Ober. Er appellierte<br />
daran, Ideen zu verwirklichen und an die<br />
eigenen Werte der Bewohner und der<br />
Region zu glauben – die regionale<br />
Zukunft selbst erschaffen. Die Menschen<br />
dürften nicht nur Forderungen an die<br />
Politik stellen, sie müssten auch selbst<br />
aktiv werden und beginnen in Räumen<br />
und langfristigen Prozessen zu denken.<br />
Unter der Tagungsleitung von Sixtus Lanner,<br />
ARGE Ländlicher Raum, folgten rund<br />
150 Bürgermeister und Gemeindevertreter<br />
der Einladung nach Wieselburg.<br />
Mehr Information<br />
DI Uschi Raser, Forum Land,<br />
Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien,<br />
www.forum-land.at<br />
E-Mail: u.raser@forum-land.at<br />
und Betrieb der Stromversorgung eines<br />
Pensionistenheims oder Einbau und<br />
Betrieb einer Klimaanlage in einem<br />
Krankenhaus vor. Im Anschluss referierte<br />
Ing. Alexander Petz, stellvertretender<br />
Präsident der DECA Dachverband<br />
Einspar-Contracting Austria, über<br />
Einspar-Contracting als wirtschaftliche<br />
Energieoptimierung mit Garantie und<br />
erörterte die Kosten- und Umweltvorteile<br />
dieses neuen Weges für Gemeinden.<br />
Moderiert wurde die Fachtagung<br />
von Walter Zimper, Geschäftsführer des<br />
Kommunal-Verlags.<br />
Mag. Martin Platzer, Walter Zimper<br />
und Ing. Alexander Petz freuen sich über<br />
das Interesse der Kommunalpolitiker an<br />
Contracting.<br />
KOMMUNAL 85
Aus den Bundesländern<br />
86 KOMMUNAL<br />
BURGENLAND<br />
Erfolgreiche Entwicklung der Dorferneuerung<br />
Draßburg setzt’s um<br />
DRASSBURG<br />
Die Dorferneuerung ist im<br />
Burgenland zu einem unverzichtbaren<br />
Bestandteil der<br />
Landesentwicklung geworden.<br />
Ziel ist es, die ländlichen<br />
Regionen zu stärken<br />
und das Zukunftspotenzial<br />
der Dörfer zu nutzen. LR<br />
Verena Dunst und Draßburgs<br />
Bürgermeister LAbg.<br />
KÄRNTEN<br />
Tourismusgemeinden<br />
Sommerhoch in<br />
Kärnten<br />
KLAGENFURT<br />
Nach der erfolgreichsten<br />
Wintersaison, die Kärnten je<br />
erlebt hat, steigen nun auch<br />
im Sommer die Besucherzahlen<br />
– plus zwei Millionen<br />
laut Statistik Austria.<br />
Besonders beliebt bei den<br />
Touristen war im Juni Kärntens<br />
Naturarena, alle<br />
Gemeinden des Bezirks<br />
Hermagor konnten sich über<br />
ein Besucherplus von sieben<br />
Prozent freuen.<br />
Die beliebteste Feriendestination<br />
am Wörthersee ist im<br />
Juni 2007 Maria Wörth.<br />
Auch die Bergregionen<br />
locken verstärkt Urlauber<br />
nach Kärnten, so bilden Heiligenblut,<br />
Irschen und Mallnitz<br />
die Spitze im Nächtigungszuwachs.<br />
Mehr Infos & Details auf<br />
www.ktn.gv.at<br />
Christian Illedits (Bild)<br />
haben kürzlich gemeinsam<br />
das Dorferneuerungskonzept<br />
der Gemeinde Draßburg<br />
präsentiert. Mit Unterstützung<br />
der Landesregierung<br />
wurde im Jahr 1998 in<br />
Draßburg der Hauptplatz<br />
und Europapark attraktiviert<br />
und verkehrsberuhigt. Jetzt<br />
werden die restlichen Teile<br />
des Hauptplatzes, der<br />
angrenzende Marienplatz<br />
und die Mühlgasse in die<br />
Dorferneuerung einbezogen.<br />
Die Gemeinde will damit vor<br />
allem eine neue Parkplatz-<br />
Ordnung am Hauptplatz<br />
und eine verkehrsfreie Zone<br />
umsetzen. „Dieser Platz soll<br />
in Zukunft in erster Linie<br />
eine Stätte der Begegnung<br />
für Kinder, Familien und<br />
Anrainer sein“, hob Illedits<br />
hervor. Die Eröffnung ist für<br />
den 16. September geplant.<br />
PÖRTSCHACH<br />
Die Kärntner Breitband-<br />
Initiative „Kärnten Klick“ der<br />
Entwicklungsagentur Kärnten<br />
(EAK) suchte die besten<br />
Ideen fürs Internet. In Beisein<br />
von LH Jörg Haider<br />
wurde Mitte Juli im Schloss<br />
Leonstain in Pörtschach erstmals<br />
der „Kärnten Klick<br />
Award“ vergeben. Ausgezeichnet<br />
wurden die besten<br />
Internetseiten in den Kategorien<br />
„Business“, „Privat“ und<br />
„Gemeinden“. Insgesamt gab<br />
Bedarfszuweisungen<br />
Neun Millionen<br />
als erste Rate<br />
EISENSTADT<br />
Die 171 burgenländischen<br />
Gemeinden erhalten über<br />
neun Millionen Euro als erste<br />
Rate der Bedarfszuweisungen.<br />
Das hat die Landesregierung<br />
beschlossen. Für die Vergabe<br />
der Finanzmittel an die<br />
jeweiligen Gemeinden gibt es<br />
keine festen Richtlinien. Die<br />
Überweisung der zweiten<br />
Rate erfolgt Ende des Jahres.<br />
Die Bedarfszuweisungen<br />
zählen neben den Ertragsanteilen<br />
zu den wichtigsten Einnahmequellen<br />
der Gemeinden.<br />
Mit diesen Fördermitteln<br />
vom Land werden Projekte in<br />
den Kommunen finanziert.<br />
Besonders wichtig sind die<br />
Bedarfszuweisungen für die<br />
kleinen Gemeinden, die nur<br />
über wenige eigene Steuereinnahmen<br />
verfügen.<br />
LH Jörg Haider im Kreis der Sieger von „Kärnten Klick“<br />
Breitband-Initiative „Kärnten Klick“<br />
Beste Websites prämiert<br />
es über 120 Einsendungen<br />
davon sieben von den<br />
Gemeinden. Der Gemeindeseitenpreis<br />
ging an die<br />
Homepage www.arriach.at<br />
der Gemeinde Arriach. Sie<br />
überträgt mit einer Live-<br />
Webcam das örtliche Geschehen<br />
der Gemeinde.<br />
Die Gemeinden Wolfsberg<br />
(www.wolfsberg.at) und<br />
Dellach im Gailtal (http://<br />
gemeinde.dellach.at) landeten<br />
auf den Plätzen zwei und<br />
drei.<br />
Blumenschmuck<br />
Landessieger<br />
stehen fest<br />
EISENSTADT<br />
„Hochart, Wolfau, Bad Sauerbrunn<br />
und Pinkafeld machten<br />
das Rennen beim Landesblumenschmuckwettbewerb<br />
2007. Diese farbenprächtigen<br />
Orte und alle an der ‚Blumenolympiade’<br />
teilgenommenen<br />
56 Gemeinden sind blühende<br />
Tourismusbotschafter des<br />
Landes“, gratuliert Tourismuslandesrätin<br />
Mag. Michaela<br />
Resetar zur bunten Blumenpracht<br />
der Gemeinden.<br />
Damit sind die Bewerbe<br />
schönster Ort und schönster<br />
Dorfplatz abgeschlossen. Insgesamt<br />
56 Gemeinden sind<br />
dem Aufruf gefolgt, sich in<br />
diesen Kategorien<br />
zu bewerben.Siegerehrung<br />
ist am<br />
1. September.<br />
Kommunale Kläranlagen<br />
Spatenstich<br />
erfolgt<br />
STEINFELD & DELLACH<br />
Die WTE Wassertechnik<br />
GmbH erhielt als Bestbieter<br />
in einem EU-weiten Wettbewerb<br />
den Auftrag für die Planung<br />
und Errichtung der<br />
Kläranlagen Steinfeld und<br />
Dellach im Oberen Drautal.<br />
Nach Vorliegen aller behördlichen<br />
Bewilligungen erfolgte<br />
der offizielle Spatenstich<br />
unter der Schirmherrschaft<br />
von LR Reinhard Rohr. Die<br />
Inbetriebnahme der beiden<br />
Anlagen (Investitionssumme<br />
rd. 5,9 Mio. Euro)ist für Frühjahr<br />
2008 geplant. Durch die<br />
zeitgleiche Errichtung beider<br />
Kläranlagen durch einen einzigen<br />
Auftragnehmer erwarten<br />
sich die<br />
Gemeinden, dass<br />
Synergien genutzt<br />
und Kosten<br />
gespart werden.
Barrierefrei<br />
NIEDERÖSTERREICH<br />
Blindengerechter<br />
Arbeitsplatz<br />
SCHWECHAT<br />
In Schwechat wurde jetzt ein<br />
blindengerechter und barrierefreier<br />
Arbeitsplatz geschaffen.<br />
Seit Mitte Juli 2007 sitzt<br />
die seit ihrem dritten Lebens-<br />
jahr blinde Silvia Oblak im<br />
Bürgerservice des Rathauses.<br />
Bgm. NR Hannes Fazekas<br />
(Bild): „Als einer der größten<br />
Arbeitgeber haben wir eine<br />
Vorbildwirkung. Wir zeigen,<br />
dass es neue Möglichkeiten<br />
gibt, Menschen mit besonderen<br />
Bedürfnissen adäquate<br />
Arbeitsplätze zu bieten.“<br />
OBERÖSTERREICH<br />
LINZ<br />
Die oberösterreichischen<br />
Gemeindechefs klagen über<br />
ihre geringen Löhne. Der oö.<br />
Gemeindebund kommt den<br />
Forderungen nach und<br />
kämpft für höhere Auf -<br />
wands entschädigungen, Pensionsanspruch<br />
und Abfertigungen.<br />
Wie die sog. Mazal-<br />
Studie aufzeigt, lässt die<br />
soziale Situation der Bürgermeister<br />
mehr als zu wünschen<br />
übrig: Geringes<br />
Gehalt, immer mehr Verantwortung<br />
und Aufgaben,<br />
wenig soziale Absicherung<br />
und schwer zu findende<br />
Nachfolger. Diese Situation<br />
war auch zentrales Thema<br />
bei den Kommunalen Sommergesprächen<br />
2007 (siehe<br />
auch Bericht ab Seite 8 dieser<br />
Ausgabe). Die oberösterreichischen<br />
Bürgermeister<br />
machen nun mobil und hal-<br />
Wahlrechtspaket<br />
Briefwahl wird<br />
2008 möglich<br />
ST. PÖLTEN<br />
Der Bund hat die Möglichkeit<br />
für Briefwahl und Wählen mit<br />
16 eröffnet. In NÖ wurden<br />
nun im Landtag die entsprechenden<br />
Anträge eingebracht.<br />
Derzeit läuft die Begutachtung,<br />
am 30. August soll die<br />
Wahlrechtsreform im NÖ<br />
Landtag beschlossen werden.<br />
Damit könnte die NÖ Landtagswahl<br />
2008 die erste große<br />
Wahl sein, bei der die demokratiepolitischenVerbesserungen<br />
angewendet werden:<br />
Briefwahl, Wählen mit 16 und<br />
das Wahlrecht für Auslands-<br />
Niederösterreicher bei Landtagswahlen.<br />
Geändert werden<br />
müssen Verfassung, Landtagswahlordnung,Gemeinderatswahlordnung,Landesbürgerevidenzgesetz<br />
und das Initiativund<br />
Einspruchsgesetz.<br />
Oberösterreich: Bürgermeister wollen mehr Geld<br />
ten mit ihren Forderungen<br />
nicht mehr hinter dem Berg.<br />
Im Bundesländervergleich<br />
sind die oö. Bürgermeister<br />
unter den schlechtesten Verdienern.<br />
Die Ebbe auf dem<br />
Konto macht sich auch im<br />
zurückgehenden Interesse<br />
am Bürgermeister-Job<br />
bemerkbar. Der Bürgermeister<br />
bekommt auch kein<br />
Gehalt im herkömmlichen<br />
Sinn, da er in keinem Dienstverhältnis<br />
mit der Gemeinde<br />
steht wie beispielsweise der<br />
Amtsleiter. Er wird vom Volk<br />
gewählt und ist den Bürgern<br />
sowie dem Gemeinderat verantwortlich.<br />
Der Gemeindechef<br />
bekommt eine Aufwandsentschädigung.<br />
Steininger:<br />
„Die Aufwandsentschädigung<br />
für Bürgermeister soll um<br />
mindestens 500 Euro angehoben<br />
werden. In 100 oö.<br />
Kommunen wird es 2008<br />
ST. PÖLTEN<br />
Auf die Kommunen kommen<br />
immer mehr Aufgaben und<br />
Kosten zu. Das Land greift<br />
ihnen dabei finanziell unter<br />
die Arme. Zum Personalaufwand<br />
der Kindergartenbetreuer<br />
in den Landeskindergärten<br />
erhalten die Gemeinden<br />
für das erste Halbjahr<br />
2007 eine Förderung in der<br />
Höhe von 6.850.858 Euro.<br />
Die Finanzspritze des Landes<br />
ist eine wichtige Unterstützung<br />
für die Kommunen. Im<br />
Gegensatz zu den Kindergärtnern<br />
und Kindergärtnerinnen,<br />
die Landesbedienstete<br />
sind, stehen die Kindergartenhelfer<br />
und Kindergartenhelferinnen<br />
in einem<br />
Dienstverhältnis mit den<br />
Gemeinden. In Niederösterreich<br />
gibt es insgesamt 573<br />
Gemeinden und 1017 Landeskindergärten.<br />
553 Kom-<br />
Aus den Bundesländern<br />
Kinderbetreuung: 6,8 Millionen Euro für Gemeinden<br />
Hilfe für 553 Gemeinden<br />
einen Bürgermeisterwechsel<br />
geben – weil die Bürgermeister<br />
in Pension gehen oder<br />
zurücktreten. Die Hälfte aller<br />
Bürgermeister steht an der<br />
Spitze von Gemeinden mit<br />
bis zu 2.000 Einwohnern. Sie<br />
verdienen wenig, und Nachfolger<br />
sind schwer zu finden.<br />
Die Bürgermeister zählen<br />
nicht zu den Spitzenverdienern<br />
und sind oft „für Gottes<br />
Lohn“ unterwegs. Der Ortschef<br />
einer Kommune mit<br />
weniger als 1.000 Einwohnern<br />
bezieht 1.604 Euro<br />
brutto. Bis 2.000 Einwohner<br />
bekommt er etwas mehr als<br />
2.000 Euro und bis 3.000<br />
Einwohner 2.400 Euro.<br />
Nach dem Gemeindebund<br />
wird nun auch das Land<br />
aktiv: Die Klagen haben bei<br />
Gemeinde-Landesrat Josef<br />
Stockinger ein offenes Ohr<br />
gefunden.<br />
munen haben einen oder<br />
mehrere Landeskindergärten<br />
und werden somit gefördert.<br />
Angewendet werden spezielle<br />
Fördersätze, die auf der<br />
Anzahl der Kindergartengruppen<br />
basieren.<br />
Auch die Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf ist eine<br />
tägliche Herausforderung für<br />
viele. Kinderbetreuung muss<br />
deshalb an die Bedürfnisse<br />
von Eltern und Kindern<br />
angepasst sein. Bedarfsgerechte<br />
Öffnungszeiten und<br />
der weitere Ausbau der<br />
Nachmittagsbetreuung<br />
gehören genauso dazu wie<br />
die Sicherung der Betreuungsqualität.<br />
Junge Familien<br />
stehen vielfach vor großen<br />
Problemen, Kinderbetreuung<br />
und<br />
Berufstätigkeit<br />
unter einen Hut zu<br />
bringen.<br />
Bädersanierung<br />
Ortschefs gehen auf die Barrikaden 70 Prozent der<br />
Gemeinden mit<br />
Badeanlage<br />
LINZ<br />
„In Oberösterreich gibt es<br />
263 Freibadanlagen und 75<br />
Normal- und Kleinhallenbäder.<br />
Seit dem<br />
Start des Bädersanierungsprogramms<br />
im<br />
Jahr 1987 sind<br />
155 Badeanlagen<br />
saniert<br />
worden, davon<br />
103 Freibäder,<br />
20 Hallenbäder,<br />
14 Strandbäder, zehn Lehrerschwimmbecken<br />
und acht<br />
Naturbäder“, zieht LH und<br />
Sportreferent Dr. Josef<br />
Pühringer<br />
(Bild) eine<br />
erfolgreiche<br />
Bilanz der letzten<br />
20 Jahre.<br />
KOMMUNAL 87<br />
Foto: Land OÖ / Kraml
Aus den Bundesländern<br />
88 KOMMUNAL<br />
SALZBURG<br />
Ausflugsziel gerettet<br />
Feste Mandling<br />
wird saniert<br />
RADSTADT<br />
Mit Gesamtkosten von rund<br />
80.000 Euro werden derzeit<br />
die Befestigungsmauern und<br />
Wehrgänge der Grenzbefestigungsanlage<br />
Mandling<br />
restauriert bzw. wieder hergestellt.<br />
Die Anlage ist heute<br />
ein beliebtes Ausflugsziel.<br />
STEIERMARK<br />
Hochwasser-Schutz<br />
Fünf Jahre nach<br />
dem Hochwasser<br />
Burgstaller gegen Schließung der Kleinschulen<br />
„BMF-Positionspapier nicht<br />
nachvollziehbar“<br />
SALZBURG<br />
„Der Bund will alle Schulen<br />
unter 80 Kindern schließen.<br />
Die Entscheidungen von Wien<br />
werden am grünen Tisch<br />
gemacht und sind nicht nachvollziehbar.<br />
Die Volksschule<br />
zählt zur Basis der öffentlichen<br />
Versorgung und ist ein<br />
wichtiger Teil des sozialen<br />
Netzwerks innerhalb der<br />
Gemeinde.“ Das betonte<br />
Anfang August LH Gabi Burgstaller,<br />
für die klar feststeht,<br />
dass die bestmögliche Versorgung<br />
in den Grundschulen<br />
vor allem in ländlichen Regionen<br />
auch hinkünftig gesichert<br />
sein solle. Burgstaller zeigte<br />
sich verwundert darüber, dass<br />
ein derartiges Positionspapier<br />
aus dem Finanzministerium<br />
vorgelegt wird.<br />
18 Pioniere auf dem Weg zur Barrierefreiheit in der ganzen Steiermark<br />
Steirische Gemeinden – Orte für ALLE<br />
GRAZ<br />
Dass Barrierefreiheit auch<br />
außerhalb von Graz gelebte<br />
Realität ist, zeigen 18 steirische<br />
Gemeinden. Sie sind die<br />
ersten Partner des CEDOS-<br />
Netzwerkes, dessen Ziel es<br />
ist, steirische Gemeinden auf<br />
dem Weg zur Barrierefreiheit<br />
zu unterstützen. So hat<br />
Fohns dorf schon damit<br />
begonnen, sämtliche Wanderwege<br />
auf Hürden hin zu<br />
Foto: LPB<br />
Bürgermeister von Radstadt<br />
Josef Tagwercher, LR Doraja<br />
Eberle, Dr. Christian Haller -<br />
Chef des Referats Erhaltung<br />
des kulturellen Erbes, Amt der<br />
Salzburger Landesregierung.<br />
Foto: Landespressedienst<br />
SALZBURG<br />
Vor fünf Jahren, im August<br />
2002, waren weite Teile des<br />
Bundeslandes Salzburg von<br />
einer Hochwasserkatastrophe<br />
betroffen. Der Schwerpunkt<br />
lag im Tennengau, im Flachgau,<br />
in der Stadt Salzburg<br />
und im unteren Saalachtal.<br />
„Seit 2002 setzen wir eine<br />
Vielzahl von Hochwasserschutzprojekten<br />
um. Diese<br />
Maßnahmen sollen für die<br />
Bevölkerung in den betroffenen<br />
Gemeinden nach den<br />
Hochwässern rasch die<br />
größtmögliche Sicherheit<br />
schaffen. Bisher wurden insgesamt<br />
63 Millionen Euro in<br />
Schutzwasserbauten investiert.<br />
Für die kommenden<br />
Jahre stehen jeweils zwölf<br />
Millionen zur Verfügung“,<br />
kündigte LR Sepp Eisl an.<br />
checken. „Uns ist es einfach<br />
wichtig, dass das Bewusstsein<br />
für ganzheitliche Barrierefreiheit<br />
zur Selbstverständlichkeit<br />
wird“, so Bürgermeister<br />
Johann Straner. Das CEDOS-<br />
System hilft Gemeinden fachlich<br />
fundiert bei der praktischen<br />
Umsetzung vor Ort. So<br />
genannte Toolboxen bieten<br />
Hintergrundinformationen<br />
über Gesetze und Richtlinien,<br />
sie können damit in Eigenre-<br />
LH Franz Voves, Bgm. Johann<br />
Straner, Fohnsdorf, Bgm. Dir.<br />
August Wagner, Trofaiach,<br />
Christian Hofer, Projektleiter<br />
CEDOS-Netzwerk, Claus Candussi<br />
und Walburga Fröhlich,<br />
Geschäftsführer vom Verein<br />
Atempo und LAbg. Anne<br />
Marie Wicher beim Festakt in<br />
der barrierefreien Orangerie<br />
im Grazer Burggarten.<br />
gie ihre Internetseiten sowie<br />
auch ihr Kultur- und Gesundheitssystem<br />
hinsichtlich Barrierefreiheit<br />
überprüfen.<br />
Neben Fohnsdorf bekamen<br />
Anfang Juli im Rahmen eines<br />
Festaktes in der Orangerie<br />
auch die Gemeinden Eichberg-Trautenburg,Gössendorf,<br />
Grambach, Hart bei<br />
Graz, Kraubath an der Mur,<br />
Krieglach, Pölfing-Brunn, Seiersberg,<br />
Spielfeld, Straden,<br />
St. Stefan ob Stainz, Thörl,<br />
Trofaiach, Übelbach, Weiz<br />
und Zwaring-Pöls sowie die<br />
Stadt Bruck an der Mur von<br />
LH Franz Voves die Partnerurkunde<br />
überreicht. „Ich kann<br />
nur allen Bürgermeistern<br />
danken, dass sie sich von sich<br />
aus diesem Thema annehmen“,<br />
so Voves.<br />
Nähere Informationen unter<br />
www.cedos.at<br />
Die Salzburger Schullandschaft<br />
besteht zu 47 Prozent<br />
aus Kleinschulen. Der Vorschlag<br />
des Ministeriums<br />
würde bedeuten, dass insgesamt<br />
71 Volksschulen<br />
geschlossen werden müssten.<br />
Burgstaller wird dazu nicht<br />
ihre Zustimmung geben.<br />
Über die Beförderung der<br />
Schüler aus entlegenen ländlichen<br />
Regionen zur Schule<br />
hat man sich offensichtlich<br />
keine Gedanken gemacht.<br />
Hier wäre vor allem eine<br />
Lösung auf allen Ebenen notwendig.“<br />
Sinnvoll findet LH<br />
Burgstaller den Vorschlag,<br />
dass zwei oder<br />
mehrere Kleinschulen<br />
unter<br />
einer Leitung<br />
stehen sollen.<br />
Umweltbewusst<br />
Stadtverwaltung<br />
fährt Erdgas-Autos<br />
LIEZEN<br />
Ökologische und ökonomische<br />
Aspekte spielten bei der<br />
Anschaffung des neuen<br />
Dienstfahrzeuges für die<br />
Stadtverwaltung eine bedeutende<br />
Rolle. Aus diesem<br />
Grund wurde für die Stadtverwaltung<br />
ein erdgasbetriebenes<br />
Dienstfahrzeug angeschafft.<br />
„Mit diesem Fahrzeug<br />
fahren wir nicht nur umweltbewusst,<br />
sondern sparen<br />
auch Kraftstoffkosten, und<br />
dabei müssen wir weder auf<br />
Fahrkomfort noch auf die<br />
Sicherheit verzichten“ –<br />
brachte es Bürgermeister<br />
Mag. Rudolf Hakel anlässlich<br />
der offiziellen Autoübergabe<br />
bei der Erdgas<br />
(CNG)-Tankstelle<br />
Puster auf den<br />
Punkt.
TIROL<br />
Müll-Streit unzumutbar<br />
Neues Gesetz<br />
soll helfen<br />
INNSBRUCK<br />
„Der Streit darüber, wer<br />
beim Müll wofür zuständig ist<br />
und wofür nicht, ist der Tiroler<br />
Bevölkerung längst nicht<br />
mehr zumutbar“, resümiert<br />
Anfang August<br />
LR Hans Lindenberger<br />
(Bild).<br />
Offenbar lässt<br />
das Gesetz, das<br />
immerhin schon<br />
aus dem Jahr 1990 stammt,<br />
zu viel Raum für Interpretation.<br />
„Ich schlage daher vor,<br />
dass wir das Tiroler Abfallwirtschaftsgesetzüberarbeiten,<br />
um rechtliche Klarheit zu<br />
schaffen“, betont Lindenberger.<br />
„Es ist grotesk, wenn das<br />
Bundeskanzleramt um Auskunft<br />
darüber gebeten werden<br />
muss, wie ein Tiroler<br />
Gesetz zu verstehen ist.“<br />
VORARLBERG<br />
HOHENEMS<br />
Im Rahmen eines internationalenWeltabwasserkongresses<br />
der International Water<br />
Association (IWA) im September<br />
2007 in Wien wird<br />
das Projekt ARA Hohenems/Kummenberg<br />
neben<br />
anderen internationalen<br />
Großkläranlagen einem<br />
weltweiten Fachpublikum<br />
präsentiert.<br />
Wasserverbandschef Bgm.<br />
Brändle mit Prof. DI Matsché<br />
anläßlich der Präsentation der<br />
Emser Anlage beim Weltabwasserkongress<br />
im September.<br />
Hochwasserschutz für das Ötztal<br />
INNSBRUCK<br />
LH Herwig van Staa will eine<br />
sofortige Verbesserung des<br />
Hochwasserschutzes im Tiroler<br />
Ötztal. Zwei Varianten<br />
wurden einer<br />
wissenschaftlichen<br />
Bewertung<br />
unterzogen. Die<br />
Ergebnisse des<br />
Gutachtens wurden<br />
nun präsentiert,<br />
blieben aber<br />
nicht ohne<br />
Gegenstimmen.<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Theodor Strobl<br />
von der TU München<br />
prüfte<br />
machbare Möglichkeiten<br />
eines wirksamen<br />
Hochwasserschutzes im Ötztal.<br />
Grundlage dafür war der<br />
sogenannte Masterplan der<br />
Tiwag. Der Bürgermeister<br />
ARA Hohenems beim Weltabwasserkongress<br />
Musteranlage aus dem Ländle<br />
Der Hohenemser Konferenzbeitrag<br />
ist als Sieger<br />
einer mehrstufigen vorhergehendenKonferenzbeitragsausschreibunghervorgegangen.<br />
Weiters werden<br />
Projekte aus San Francisco,<br />
Amsterdam, Prag, Danzig<br />
und Brasilien präsentiert.<br />
Ausschlaggebend für den<br />
Seminarbeitrag war, dass<br />
die Leistungssteigerung der<br />
ARA Hohenems ohne<br />
zusätzliche neue Bauwerke<br />
mit den bestehenden<br />
Becken erzielt werden<br />
konnte. Der Obmann des<br />
Wasserverbandes Hohenems<br />
und Am Kum ma, der<br />
Altacher Bürgermeister<br />
Gottfried Brändle und Univ.<br />
Prof. DI Dr. Matsché freuen<br />
sich mit Betriebsleiter Ing.<br />
Werner Schättle und Zivil -<br />
techniker DI Michael Gasser<br />
über diese Präsentation.<br />
von Kaunertal (Bezirk Landeck),<br />
Josef Raich, und Bürgermeister<br />
Rupert Hosp aus<br />
St. Leonhard (Bezirk Imst) im<br />
Pitztal unterstützen das Vorhaben<br />
tatkräftig.<br />
Sie haben in<br />
ihren Gemeinden<br />
bereits gute<br />
Erfahrungen mit<br />
dem Hochwasserschutz<br />
gemacht, zeigen<br />
aber auch Verständnis<br />
für die<br />
Skepsis der Gegner.<br />
Van Staa will<br />
zunächst noch<br />
die Gespräche<br />
mit den betroffenen<br />
Gemeinden Gurgl und<br />
Vent abwarten, ist sich einer<br />
möglichst raschen Umsetzung<br />
des Projekts aber bereits<br />
sicher.<br />
BREGENZ<br />
Straßen waren in früheren<br />
Zeiten stets auch Stätten der<br />
Begegnung, Spielraum für<br />
Kinder und Jugendliche<br />
sowie Lebensraum für die<br />
Anwohner. Durch den<br />
Anstieg der Mobilität wurden<br />
sie aber zunehmend<br />
vom Verkehr vereinnahmt.<br />
Während der „Vorarlberg<br />
MOBIL“-Woche (17. bis 23.<br />
September) sollen Straßen<br />
wieder zu Begegnungszonen<br />
werden. In einem Pilotversuch<br />
unterstützt die Initiative<br />
„Kinder in die Mitte“ fünf<br />
Feste, die von einer Straßen-<br />
Aus den Bundesländern<br />
Verwaltung<br />
Bürgermeister sind für Pläne Elektronischer<br />
Behördenweg<br />
INNSBRUCK<br />
Der sichere<br />
elektronische<br />
Behördenweg,<br />
den Landsrätin<br />
Anna Hosp<br />
(Bild) Mitte<br />
Mai eröffnet<br />
hat, entwickelt<br />
sich zur<br />
Erfolgsstory. Via Internet<br />
können damit das gesamte<br />
Verwaltungsverfahren und<br />
das Verwaltungsstrafverfahren<br />
ohne unnötige Behördenwege,Parteienverkehrszeiten<br />
und Portogebühren<br />
elektronisch und rechtsverbindlich<br />
abgewickelt werden.<br />
In den ersten zehn<br />
Wochen des Betriebes<br />
sind bereits 420<br />
Online-Formulare<br />
eingelangt.<br />
Gemeinde können sich bewerben und für ein „Kinder-Familien-<br />
Straßenfest“ die zeitweilige Straßensperre organisieren.<br />
Straßen – kinderfreundliche Ort der Begegnung<br />
Pilotgemeinden gesucht<br />
Nachbarschaft in Eigenregie<br />
organisiert werden.<br />
Gesucht werden nun<br />
Gemeinden, denen die Idee<br />
der Rückgewinnung der<br />
Nebenstraßen als Begegnungszonen<br />
gefällt, die sich<br />
vorstellen können, diese Projektidee<br />
in der Gemeinde zu<br />
bewerben und für ein „Kinder-Familien-Straßenfest“<br />
die<br />
zeitweilige<br />
Straßensperre zu<br />
organisieren.<br />
Infos bei Vor arlberg<br />
MOBIL<br />
E-Mail: martin.reis<br />
@energieinstitut.at<br />
KOMMUNAL 89
Kontakt<br />
KOMMUNAL-International<br />
SÜDTIROL<br />
Klare Kompetenztrennung & wissenschaftliche Finanzierung<br />
Reformvorschlag: Gemeinden<br />
„Aug in Aug“ mit dem Land<br />
BOZEN<br />
Eine klare neue Kompetenztrennung<br />
zwischen Land und<br />
Gemeinden sowie ein Finanzierungssystem,<br />
das auf wissenschftlichen<br />
Kriterien<br />
beruht und den Gemeinden<br />
weit mehr Autonomie sichert.<br />
Das sind Herzstücke der institutionellen<br />
Reform, die der<br />
Gemeindenverband ausgearbeitet<br />
hat.<br />
„Ich bin mit dem Ergebniss<br />
sehr zufrieden“, sagte Arnold<br />
Schuler, Präsident des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes,<br />
nach der Präsentation vor der<br />
Vollversammlung des<br />
Gemeindeverbandes Anfang<br />
August, „denn die Stimmung<br />
unter den Gemeinden ist<br />
absolut positiv.“<br />
Es hatte auch allen Grund<br />
dazu, „manifestierte sich im<br />
Bozener Festsaal das neue<br />
Selbstbewusstsein der Südtiroler<br />
Gemeinden“ (Tiroler<br />
Zeitung). Und was offiziell<br />
eine Informationsveranstaltung<br />
war, wuchs sich zu einer<br />
politischen Revolution aus,<br />
90 KOMMUNAL<br />
die Südtirol noch einige Zeit<br />
beschäftigen wird.<br />
Die Reform gründet sich auf<br />
zwei Pfeilern. „Zuerst muss es<br />
zu einer klaren Kompetenzaufteilung<br />
zwischen Land<br />
und Gemeinden kommen,“ so<br />
Schuler zur ersten Säule. Derzeit<br />
müssen sich Land und<br />
Gemeinden durch ein<br />
Dickicht von kompetenzüberlagerungen<br />
schlagen – was<br />
Gemeindenverbandspräsident Arnold Schuler (Mitte) & Co wollen<br />
weg vom Bittstellerstatus und auf gleicher Augenhöhe mit<br />
dem Land verhandeln.<br />
Südtiroler Gemeindenverband<br />
Gen.m.b.H.<br />
Schlachthofstrasse 4,<br />
I-39100 Bozen<br />
dazu führt, dass heikle Entscheidungen<br />
hin und her und<br />
vor sich her geschoben werden.<br />
Diese Kompetenzen sollen<br />
künftig klar aufgeteilt<br />
werden und die Verantwortungsachse<br />
soll sich klar Richtung<br />
Gemeinden verschieben.<br />
Gerade das fordert aber auch<br />
ein absolut neues Finanzierungssystem<br />
der Gemeinden<br />
durch das Land – und auch<br />
dafür hat der Gemeindenverband<br />
ein neues Modell vorgestellt.<br />
Ausgearbeitet wurde<br />
das neue Modell durch die<br />
beiden Wirtschaftswissenschafter<br />
Oswald Lechner und<br />
Georg Lun sowie Universitäts -<br />
Tel 0039-0471-304655,<br />
Fax 0039-0471-304625<br />
Email: sgv@gvcc.net<br />
www.gvcc.net<br />
professor Gottfried Trappeiner.<br />
„Dieses System ist nicht<br />
auf politische Entscheidungen<br />
aufgebaut, sondern fußt einzig<br />
und allein auf<br />
wissenschaftlicher Basis“,<br />
beschreibt Arnold Schuler das<br />
Modell. Die neuen Gemeindefinanzierung<br />
würde auf<br />
einfachen und objektiv messbaren<br />
Kriterien aufbauen.<br />
Die drei Wissenschafter<br />
haben die Kriterien im Zuge<br />
einer Durchforstung der<br />
Haushalte aller 116 Südtiroelr<br />
Gemeinden erstellt und<br />
dabei Kennzahlen, Standards<br />
und Indikatoren entwickelt,<br />
die eine gerechte Berechnung<br />
der Gemeinden ermöglicht.<br />
Und man beschränkte sich<br />
dabei nicht nur auf die laufenden<br />
Ausgaben, sondern<br />
auch auf die Investitionen.<br />
Alles soll künftig in einen<br />
Topf fließen, der von den<br />
Gemeinden autonom verwaltet<br />
wird. „Es geht dabei auch<br />
um eine Vereinfachung und<br />
einen deutlichen Bürokratieabbau<br />
auf beiden Seiten“,<br />
so Schuler.<br />
Einhergehend mit diesen<br />
Reformen soll auch eine deutliche<br />
Aufwertung des Rates<br />
der Gemeinden geschehen –<br />
sozusagen als Sicherheit,<br />
nicht länger vom Land bevormundet<br />
zu werden. „Es<br />
braucht eine Absicherung“, so<br />
Schuler, „und das kann nur<br />
ein Gremium sein, in dem die<br />
Gemeinden auf Augenhöhe<br />
mit dem Land verhandeln.“<br />
Demnach sollen langfristige<br />
Probleme zwischen dem<br />
Land un den Gemeinden in<br />
Rat der Gemeinden verhandelt<br />
und abgesegnet werden.<br />
Zudem soll festgelegt werden,<br />
was passiert, wenn der<br />
Rat ein negatives Urteil zu<br />
einem Landesgesetz gibt.<br />
Bayern ehrt<br />
Verdienstorden für<br />
Franz Schausberger<br />
Auszeichnung für<br />
Zusammenarbeit<br />
MÜNCHEN<br />
Die höchste Auszeichnung<br />
des Freistaates Bayern, den<br />
Bayerischen Verdienstorden,<br />
erhielt Mitte Juli 2007 der<br />
frühere Salzburger Landeshauptmann<br />
und Vorstandsvorsitzende<br />
des Instituts der<br />
Mag. Heidi und Dr. Franz<br />
Schausberger und Bayerns<br />
Ministerpräsident Edmund Stoiber<br />
bei der Überreichung des<br />
Bayerischen Verdienstordens.<br />
Regionen Europas, Dr. Franz<br />
Schausberger, vom bayerischen<br />
Ministerpräsidenten<br />
Edmund Stoiber in der Residenz<br />
München überreicht.<br />
Die Auszeichnung soll die<br />
enge Zusammenarbeit zwischen<br />
Bayern und Salzburg<br />
in der Zeit Schausbergers als<br />
Landeshauptmann von 1996<br />
bis 2004 anerkennen. Zahlreiche<br />
gemeinsame Aktivitäten<br />
gab es in der ARGE ALP.,<br />
in den Bereichen Kultur,<br />
Energiepolitik, Umweltpolitik,<br />
Verkehrsinfrastruktur,<br />
gesamteuropäischen Verkehrsfragen,<br />
Agenda 2000<br />
etc. Salzburg und Bayern<br />
waren und sind enge Verbündete<br />
im Ausschuss der Regionen<br />
der EU gegen den Zentralismus<br />
der EU-Gremien<br />
und für die Stärkung der<br />
Regionen in der EU. Stoiber<br />
würdigte damit auch das<br />
Engagement Schausbergers<br />
im Ausschuss der Regionen<br />
und in dem von ihm gegründeten<br />
Institut der Regionen<br />
Europas (IRE).
Oberösterreich<br />
Höchste Auszeichnung der Raiffeisenlandesbank OÖ<br />
Goldenes Giebelkreuz für Gemeindebund-Präsident<br />
Franz Steininger<br />
LINZ<br />
„Er ist ein Mann, der den<br />
Konsens sucht, der die Harmonie<br />
wünscht und der es<br />
versteht, sachlich zu argumentieren<br />
und gewinnend zu<br />
agieren“,<br />
betonte Dr. Ludwig<br />
Scharinger,<br />
Generaldirektor<br />
der Raiffeisenlandesbank<br />
OÖ bei der Verleihung<br />
des<br />
Goldenen Giebelkreuzes<br />
an<br />
Gemeindebund-<br />
Präsident Bgm.<br />
Franz Steininger.<br />
Mit dem<br />
Goldenen Giebelkreuz<br />
der Raiffeisenlandesbank<br />
OÖ werden hochrangige<br />
Persönlichkeiten ausgezeichnet,<br />
die sich wesentlich<br />
durch Dialogbereitschaft<br />
und Innovationsfähigkeit<br />
auszeichnen und dadurch<br />
einen wichtigen Beitrag bei<br />
der Gestaltung Oberöster-<br />
reichs leisten. Scharinger<br />
würdigte Steininger in seiner<br />
Laudatio als vorbildlichen<br />
Vertreter der Gemeindeinteressen:<br />
„Präsident Steininger<br />
kümmert sich seit 24 Jahren<br />
Franz Steiniger erhielt das Goldene Giebelkreuz<br />
aus der Hand von NRAbg. Bgm. Jakob Auer.<br />
Tiroler Gemeindebund<br />
als Bürgermeister an vorderster<br />
Stelle um die positive<br />
Entwicklung seiner<br />
Gemeinde Garsten. Er weiß<br />
daher sehr genau, wo der<br />
Schuh drückt, aber auch, wo<br />
Chancen und Möglichkeiten<br />
liegen.“<br />
Ehrenring der Tiroler Gemeinden für Hubert Rauch<br />
Anerkennung zum Sechziger<br />
INNSBRUCK<br />
Der Tiroler Gemeindebund-<br />
Präsident und Bürgermeister<br />
der Gemeinde Steinach am<br />
Brenner,<br />
Dipl. Vw.<br />
Hubert<br />
Rauch,<br />
erhielt<br />
den<br />
Ehrenring<br />
der Tiroler<br />
Gemeinden.<br />
Hubert Rauch<br />
Rauch<br />
wurde am<br />
12. Juli<br />
1947 geboren und feierte<br />
daher erst kürzlich seinen 60.<br />
Geburtstag. Der Gemeindebund-Präsident<br />
ist seit 1986<br />
Bürgermeister (ÖVP) und im<br />
Vorstand des Tiroler Gemeindeverbandes.<br />
Am 1. Oktober<br />
1995 wurde er mit eindeutiger<br />
Mehrheit zum Präsidenten<br />
des Gemeindeverbandes<br />
in Tirol gewählt. Rauch war<br />
lange Zeit als Bezirksparteiobmann<br />
des Bezirkes Innsbruck/Land<br />
aktiv. Als Präsident<br />
des Tiroler Gemeindeverbandes<br />
vertritt er in zahlreichen<br />
Gremien die Anliegen<br />
der Gemeinden in Tirol.<br />
Seit 2001 ist Rauch Landtagsabgeordneter,<br />
und<br />
Anfang 2007 wurde er<br />
Obmann des Finanzausschusses<br />
des Österreichischen<br />
Gemeindebundes. Als Steuerberater<br />
ist der vierfache Vater<br />
Experte im Bereich Finanzen<br />
und Steuern.<br />
Foto: RLB OÖ<br />
Niederösterreich ehrt<br />
ST. PÖLTEN<br />
Nach langen Jahren am<br />
Eisernen Vorhang und im<br />
Schatten der Bundeshauptstadt<br />
sei Niederösterreich<br />
heute ein selbstbewusstes,<br />
wirtschaftlich dynamisches,<br />
kulturell reichhaltiges und<br />
sozial ausgewogenes Land,<br />
sagte LH Dr. Erwin Pröll<br />
Ende Juni bei der Überreichung<br />
des „Silbernen Komturkreuzes<br />
mit<br />
dem Stern des<br />
Ehrenzeichens für<br />
Verdienste um<br />
Niederösterreich“<br />
an Volksanwältin<br />
Rosemarie Bauer<br />
in St. Pölten.<br />
Dieses neue Nie-<br />
derösterreich, so<br />
Pröll weiter, sei<br />
geprägt von Persönlichkeiten,<br />
wie<br />
Rosemarie Bauer<br />
die bereit gewesen<br />
wären, sich<br />
einzubringen.<br />
Ihr Name und ihre Persönlichkeiten<br />
hätten Gewicht,<br />
ihre Tätigkeit in der Volksan-<br />
Personalia<br />
Vier Jahrzehnte in Kontakt mit der Bevölkerung<br />
Silbernes Komturkreuz für<br />
Rosemarie Bauer<br />
Foto: Boltz<br />
OÖ Gemeindebund<br />
LINZ<br />
Als ausgeprägten Demokraten,<br />
dem eine gute Zusammenarbeit<br />
aller demokratischen<br />
Kräfte ein echtes Anliegen<br />
war, würdigten LH Dr.<br />
Josef Pühringer und<br />
Landtagspräsidentin<br />
Angela Orthner den<br />
ehemaligen Präsidenten<br />
des Oö.<br />
Landtags Matthias<br />
Hödlmoser anlässlich<br />
seines 100.<br />
Geburtstags. Die<br />
Kommunalpolitik<br />
zieht sich wie ein<br />
waltschaft habe weit über<br />
Niederösterreich hinaus<br />
Beachtung gefunden. Ihre<br />
Funktion als Volkanwältin<br />
umfasste auf Bundesebene<br />
u. a. die Bereiche Steuern,<br />
Land- und Forstwirtschaft,<br />
Natur- und Umweltschutz,<br />
Wissenschaft und Studienförderung.<br />
Auf Landesebene<br />
wurden in ihrem Geschäftsbereich<br />
vor allem Gemeinde-<br />
Gratulation an die „Gemeinde“-Volksanwältin<br />
a.D.: Gemeindebund-Vizepräsident Bgm.<br />
Alfred Riedl, Rosemarie Bauer, LH Erwin Pröll<br />
und Gemeindebund-General Robert Hink.<br />
angelegenheiten,insbesondere Fragen der Raumordnung,<br />
des Baurechts und des<br />
Wohnungswesens geprüft.<br />
Gemeindebundpräsident a. D. Matthias Hödlmoser<br />
Ein „Hunderter“ wird gefeiert<br />
Matthias<br />
Hödlmoser<br />
roter Faden durch das Leben<br />
des Jubilars. Hödlmoser<br />
wurde nach Kriegsende Bürgermeister<br />
von St. Wolfgang<br />
und füllte diese Funktion bis<br />
1973 aus. Zwischen 1967<br />
und 1973 war er Präsident<br />
des Oö. Gemeindebundes.<br />
Dem Oö.<br />
Landtag gehörte er<br />
fünf Legislaturperioden<br />
von 1945 bis 1973 an.<br />
1953 wurde er zum<br />
ersten Landtagspräsidenten<br />
gewählt und<br />
verblieb in dieser<br />
Funktion bis 1967.<br />
KOMMUNAL 91
Info-Mix<br />
Der herrliche Tag und der<br />
prachtvolle Rundblick entschädigten<br />
für die Mühsal des Aufstiegs.<br />
Oben BH Heinz Zimper,<br />
rechts Gemeindebund-General<br />
Robert Hink mit Gattin Herta.<br />
Voller Erfolg für „Schwaigen – Reigen“<br />
Der Wechsel präsentiert<br />
seine Almen und seine Musik<br />
ASPANGBERG-ST. PETER<br />
Im Wechselgebiet fand Mitte<br />
Juni 2007 mit dem 1.<br />
„Schwaigen-Reigen“ etwas<br />
ganz Besonderes statt. Über<br />
190 Musikanten, Sänger,<br />
Volkstänzer, Dichter und<br />
Naturführer aus den 14 niederösterreichischen<br />
und steirischen<br />
Gemeinden, die sich<br />
seit nicht allzu langer Zeit –<br />
grenzüberschreitend – zur<br />
„Wirtschaftsplattform Wechselland“zusammengeschlossen<br />
haben, beteiligten sich an<br />
der Veranstaltung.<br />
Den Ehrenschutz über das<br />
„Festival der Almhütten am<br />
Wechsel“ hatte der Österreichische<br />
Gemeindebund mit<br />
Generalsekretär, Dr. Robert<br />
Hink übernommen. Neunkirchens<br />
Bezirkshauptmann Dr.<br />
Heinz Zimper, Gutsbesitzer<br />
Ökonomierat Dipl. Ing. Stefan<br />
Schenker und Bürgermeister<br />
Josef Bauer, Aspangberg-<br />
St. Peter am Wechsel, auf dessen<br />
Gemeindegebiet das Wetterkoglerhaus<br />
steht, ließen es<br />
sich nicht nehmen, ebenso<br />
wie zahlreiche Bürgermeister<br />
der umliegenden Gemeinden,<br />
92 KOMMUNAL<br />
zu Fuß auf das 1743 m hoch<br />
gelegene Wetterkoglerhaus<br />
hinaufzugehen. Der prachtvolle<br />
Rundblick vom Plattensee<br />
bis zum Ötscher entschädigte<br />
für die Mühsal des Aufstieg.<br />
Übrigends: Die Zahl der<br />
Gäste übertraf mit 3500 alle<br />
Erwartungen.<br />
Der Anstoß zum „Schwaigen-<br />
Reigen“ war der Versuch, das<br />
aktuelle Lied- und Musizierguts<br />
des Wechsels zur Ergänzung<br />
des umfangreichen<br />
Archivmaterials um 1900 für<br />
den projektierten COMPA<br />
(=Corpus Musicae Popularis<br />
Austriacae)-Band „Der Wechsel<br />
– Musik einer Landschaft“<br />
(Erika Sieder und Walter<br />
Deutsch) zu erfassen. Durch<br />
das rege Interesse der Beteiligten<br />
und die Resonanz der<br />
Veranstaltung entstand eine<br />
Medienwirkung für das<br />
Wechselgebiet, wie sie die<br />
Region seit den Nachkriegs-<br />
Hamsterfahrten der Wiener,<br />
wohl nicht mehr gekannt<br />
hatte.<br />
Mehr Infos auf<br />
www.schwaigen-reigen.at<br />
In memoriam<br />
Drei Todesfälle erschüttern auch die Gemeinden<br />
Trauriger Sommer<br />
WKÖ-Präsident a.D.<br />
Leopold Maderthaner<br />
Der ehemalige Präsident der<br />
Wirtschaftskammer Österreich<br />
und des Österreichischen<br />
Wirtschaftsbundes,<br />
Leopold Maderthaner ist<br />
nach schwerer Krankheit<br />
kurz vor seinem 72. Geburtstag<br />
in Amstetten (NÖ) verstorben.<br />
Er wurde 1935 in<br />
Hausmesing (NÖ) geboren.<br />
Von 1972 bis 1985 war<br />
Maderthaner Stadtrat von<br />
Amstetten.<br />
Als Präsident<br />
des<br />
ÖsterreichischenWirtschaftsbundesfungierte<br />
er von<br />
1989 bis<br />
1999. Von<br />
Leopold<br />
Maderthaner<br />
1990 bis<br />
2000 bekleidete<br />
er das<br />
Amt des<br />
Präsidenten der Wirtschaftskammer<br />
Österreich (WKO).<br />
Als Mitglied des Bundesrates<br />
fungierte er von 1979 bis<br />
1989 und von 1989 bis 2001<br />
als Abgeordneter zum Nationalrat.<br />
Im Jahr 2000 trat er<br />
von allen Ämtern zurück.<br />
Bundespräsident a. D.<br />
Kurt Waldheim<br />
Bundespräsident a.D. Dr.<br />
Kurt Waldheim ist im 89.<br />
Lebensjahr nach kurzer,<br />
schwerer Krankheit in Wien<br />
verstorben. Waldheim wurde<br />
1918 in St.<br />
Andrä-<br />
Wördern/Niederösterreichgeboren.<br />
Nach<br />
seiner<br />
Matura<br />
absolvierte<br />
er den<br />
Militärdienst<br />
beim öster- Kurt Waldheim<br />
reichischen Bundesheer und<br />
die österreichische Konsularakademie<br />
und begann<br />
anschließend das Studium<br />
der Rechtswissenschaften.<br />
1945 trat Waldheim in den<br />
Auswärtigen Dienst ein und<br />
diente in diplomatischen<br />
Missionen in Paris, bei den<br />
Vereinten Nationen in New<br />
York sowie in Kanada. Von<br />
1968 bis 1970 war Waldheim<br />
Außenminister der<br />
Republik Österreich und<br />
anschließend Generalsekretär<br />
der Vereinten Nationen.<br />
1986 wurde er zum<br />
Bundespräsidenten der<br />
Republik Österreich gewählt.<br />
Seine 6-jährige Amtszeit<br />
endete im Jahr 1992.<br />
Umwelt- und Gesundheitsminister<br />
a.D. Kurt Steyrer<br />
Der frühere Umwelt- und<br />
Gesundheitsminister sowie<br />
Präsidentschaftskandidat<br />
Kurt Steyrer<br />
ist im 87.<br />
Lebensjahr<br />
verstorben.<br />
Auf Drängen<br />
von<br />
SPÖ-Chef<br />
Sinowatz<br />
trat er 1986<br />
gegen Waldheim<br />
an,<br />
unterlag<br />
dem VP-<br />
Kandidaten Kurt Steyrer<br />
aber im<br />
zweiten Wahlgang. Kurt<br />
Steyrer studierte Medizin in<br />
Wien und an der Universität<br />
Prag. 1946 trat Steyrer<br />
der SPÖ und der Sozialistischen<br />
Ärztevereinigung<br />
bei, deren Obmann er von<br />
1961 bis 1968 war. Von<br />
1975 bis 1983 war Kurt<br />
Steyrer Abgeordneter zum<br />
Nationalrat, von 1981 bis<br />
1985 Bundesminister für<br />
Gesundheit und Umweltschutz<br />
unter Bruno<br />
Kreisky und Fred Sinowatz.
Foto: © Paur<br />
Neuer Waidhofner Bürgermeister begrüßt<br />
Ehrenrunde mit dem Streifenwagen<br />
Für den neuen Waidhofner Bürgermeister Kurt Strohmayer-<br />
Dangl gab es eine Ehrenrunde mit einem alten Polizeiauto Baujahr<br />
1964: Chefinspektor Peter Kratky, Vizebürgermeister Dir.<br />
Gerhard Binder, Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Franz Prucher (er<br />
gab den Chauffeur), Silvia Strohmayer-Dangl, Bürgermeister<br />
Inspektor Kurt Strohmayer-Dangl, Kontrollinspektor Reinhard<br />
Zimmermann, Univ. Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, Stadtamtsdirektor<br />
Mag. Rudolf Polt und Bezirks inspektor Hannes Luef.<br />
Jahrhundertentwurf mit Gold aufgewogen<br />
Loisium-Gründer ausgezeichnet<br />
LANGENLOIS<br />
„Ganz so einfach ist es nicht,<br />
einen erfolgreichen Mann zu<br />
ehren“, bemerkte Bgm. Kurt<br />
Bürgermeister Kom.Rat Kurt<br />
Renner (l.) und Vizebürgermeister<br />
Heinz Altmann (r.)<br />
überreichten Dkfm. Gerhard<br />
Nidetzky (mit Gattin Tuula)<br />
das „Stadtwappen in Gold“.<br />
Renner Ende Juni schmunzelnd<br />
in seiner Laudatio für<br />
Gerhard Nidetzky. Bereits im<br />
Gemeinde<br />
verkauft<br />
FERLACH<br />
Die kärntner Stadtgemeinde<br />
Ferlach verkauft Straßenbeleuchtungsmaterial:<br />
◆ 22 Pilzlampen Siteco,<br />
ohne Mast € 80,--<br />
◆ 80 Peitschenlampen<br />
ohne Mast € 50,-mit<br />
Mast € 80,--<br />
◆ 27 Rondolux € 80,--<br />
◆ 400 Pilzlampen<br />
ohne Mast € 40,--<br />
◆ Schirmleuchten<br />
ohne Mast € 30,--<br />
Auskünfte erteilt Ihnen<br />
gerne die Finanzverwaltung<br />
der Stadtgemeinde Ferlach,<br />
unter der Telefonnummer<br />
04227/2600 DW 33, FAX<br />
04227 2600 57 oder E-Mail:<br />
siegfried.rutter@ktn.gde.at<br />
Dezember des Vorjahres hat<br />
der Gemeinderat einstimmig<br />
das „Stadtwappen in Gold“<br />
für den Loisium-Gründer<br />
Nidetzky beschlossen.<br />
Für Verdienste um<br />
die Republik<br />
Bundes aus -<br />
zeichnungen<br />
verliehen<br />
Mit Entschließung vom<br />
30. Mai 2007 hat HBP<br />
Heinz Fischer verliehen:<br />
Die Goldene Medaille für<br />
Verdienste um die Republik<br />
an Johann Wipplinger,<br />
ehem. Gemeinderat der<br />
Marktgemeinde<br />
Aschach/OÖ<br />
Das Goldene Verdienstzeichen<br />
der Republik an<br />
Georg Ramsauer, Amtsleiter<br />
der Marktgemeinde<br />
Mondsee /OÖ<br />
Mit Entschließung vom<br />
31. Mai 2007<br />
Die Goldene Medaille für<br />
Verdienste um die Republik<br />
an Alois Hartleitner,<br />
Gemeindevorstand der<br />
Gemeinde Kirchham /<br />
OÖ.<br />
Mit Entschließung vom<br />
11. Juni 2007<br />
Das Große Ehrenzeichen<br />
für Verdienste um die<br />
Republik an Mag. Karl<br />
Wilfing, Bürgermeister<br />
der Stadt Poysdorf und<br />
Abg. zum NÖ Landtag.<br />
2005 wurde in einer Studie<br />
die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung des Pferdes in<br />
Österreich erhoben. Das<br />
Ergebnis beeindruckt: Jährlich<br />
generiert das Pferd in<br />
Österreichs Volkswirtschaft<br />
eine Produktion<br />
von rund 1,24<br />
Milliarden Euro<br />
und drei bis vier<br />
Pferde schaffen<br />
bereits einen<br />
Arbeitsplatz.<br />
Landwirtschaft<br />
und Tourismus<br />
profitieren am<br />
meisten vom Faktor Pferd.<br />
Aber um überhaupt Pferde<br />
halten zu können, sind genügend<br />
Platz, Verständnis und<br />
Menschen, die das Pferd als<br />
wertvollen Lebensgefährten<br />
und Sportpartner anerkennen,<br />
erforderlich.<br />
Deshalb sucht PferdAustria,<br />
die Plattform für das Pferd in<br />
BRIG-GLIS<br />
Mitte Juni wurde Brig-Glis<br />
offiziell als Alpenstadt des<br />
Jahres 2008 erklärt. Die<br />
Stadtgemeinde wird damit<br />
insbesondere für<br />
ihre Aktivitäten in<br />
den Bereichen<br />
Kooperation und<br />
Nachhaltigkeit<br />
ausgezeichnet,<br />
durch die sie der<br />
Bevölkerung eine<br />
hohe Lebensqualität<br />
und den Besucherinnen<br />
und<br />
Besuchern eine<br />
große Attraktivität<br />
bieten will. Nach<br />
Herisau ist Brig-<br />
Glis erst die zweite<br />
Schweizer Stadt<br />
und die kleinste,<br />
der das Label,<br />
„Alpenstadt des<br />
Jahres“ zuerkannt<br />
wurde.<br />
Info-Mix<br />
Gesucht: Österreichs pferdefreundliche Gemeinde<br />
Einreichfrist verlängert<br />
Österreich, die „Pferdefreundliche<br />
Gemeinde 2007“.<br />
In dem bundesweiten Wettbewerb<br />
können Sie Ihre<br />
Gemeinde für ihr Engagement<br />
im Bereich Pferdehaltung,<br />
-sport und –zucht<br />
belohnen.<br />
Wird auf Harmoniezwischen<br />
Pferden,<br />
Landschaft<br />
sowie Umwelt<br />
der Gemeinde<br />
geachtet?<br />
Dann wenden<br />
Sie sich doch<br />
gleich an Ihre Gemeinde und<br />
füllen Sie bis zum 15. September<br />
2007 den Bewerbungsbogen<br />
aus, der einfach<br />
und schnell auf der Homepage<br />
www.pferdaustria.info<br />
erhältlich ist.<br />
Hier erhalten sie auch weitere<br />
Infos und Ausschreibungsunterlagen.<br />
Brig-Glis ist Alpenstadt des Jahres 2008<br />
Kleine Alpenstadt ganz gross<br />
Das Label „Alpenstadt des<br />
Jahres“ erhalten seit 1997<br />
Städte im europäischen<br />
Alpenraum von Deutschland,<br />
Frankreich, Italien, Österreich,<br />
der Schweiz<br />
und Slowenien,<br />
welche sich für<br />
eine nachhaltige<br />
und zukunftsweisende<br />
Entwicklung<br />
ihrer Stadt und<br />
ihrer Region einsetzen.<br />
Die Auszeichnung<br />
wird auf<br />
Vorschlag einer<br />
internationalen<br />
Jury vom Verein<br />
Alpenstadt des<br />
Jahres e.V. verliehen.sind.<br />
Mehr<br />
Infos auf den<br />
Homepages<br />
www.alpenstadt-<br />
2008.ch und<br />
www.alpenstaedte.org<br />
KOMMUNAL 93
Wirtschafts-Info<br />
Veranstaltungen<br />
acqua alta alpina 2007<br />
Fachmesse und<br />
Kongress<br />
SALZBURG<br />
Die „acqua alta“ wird sich in<br />
Salzburg erstmalig aktuellen<br />
Themen zum Klimawandel, zu<br />
Klimafolgen und Gefahrenerkennung,<br />
zur Prävention und<br />
Vorsorge, zu Schutzmaßnahmen<br />
und dem Katastrophenmanagement<br />
in alpinen Regionen<br />
widmen.<br />
Zwei Tage lang wird Salzburg<br />
zum Branchentreff nationaler<br />
und internationaler Organisationen<br />
und Institutionen.<br />
Hochkarätige Fachexperten<br />
widmen sich Inhalten zum globalen<br />
Klimawandel und seinen<br />
Auswirkungen auf die Gebirgsregionen,<br />
u.a. zu Schutzmaßnahmen<br />
in der kommunalen<br />
Praxis, zu neuen Herausforderungen<br />
für den alpinen Tourismus<br />
aber auch zur Kommunikation<br />
und internationalen<br />
Zusammenarbeit für den<br />
Schutz vor alpinen Gefahren.<br />
www.acqua-alta-alpina.at<br />
Kleinstädte-Symposium<br />
Sterben die<br />
Kleinstädte?<br />
ST. VEIT an der GLAN<br />
„Sterben die Kleinstädte, wie<br />
geht es ihnen, welche Chancen<br />
haben sie?" sind nur einige der<br />
vielen Fragen, auf die das „4.<br />
Internationale Kleinstädte-Symposion“<br />
von 20. bis 22. September<br />
in St. Veit an der Glan<br />
(Kärnten) Antworten zu geben<br />
versuchen wird. Die Veranstalter<br />
Netz.Werk.Stadt, Initiative für<br />
Ortskernbelebung, und die<br />
Stadtgemeinde St. Veit an der<br />
Glan erwarten rund 300 Teilnehmer<br />
aus ganz Europa im<br />
Konferenzhotel Fuchspalast der<br />
ehemaligen Kärntner Herzogstadt.<br />
Die Tagungsgebühr beträgt 108<br />
Euro pro Tag, bzw. 290 Euro<br />
(inkl. MWSt.) für alle drei Tage.<br />
Detailinformationen auf den<br />
Webpages<br />
www.stveit.carinthia.at und<br />
www.netzwerkstadt.net.<br />
94 KOMMUNAL<br />
PuMa-Schriften<br />
Umfassende<br />
Bürgerbeteiligung<br />
Fehlende Transparenz und<br />
verspätete Integration von<br />
Bürgerinteressen führen<br />
immer wieder zu Akzeptanzproblemen,<br />
verzögern die<br />
Realisierung von öffentlichen<br />
Projekten, bringen Projektmanager,<br />
Finanziers und Politiker<br />
„in’s Schwitzen“ und<br />
führen im worst-case zu<br />
Stopp-Entscheidungen. Hohe<br />
öffentliche Akzeptanz und<br />
Identifikation, sowie Umsetzungssicherheit,<br />
sind Projektzieldimensionen,<br />
die durch<br />
ein proaktives Bürger- und<br />
Betroffenenbeteiligungsmanagementerreichbar<br />
sind.<br />
Mit dem<br />
ersten<br />
Band zur<br />
PuMa-<br />
Schriftenreihe<br />
zeigt der<br />
Autor als<br />
Promotor und umsetzungsverantwortlicherProjektmanager<br />
des „Kommunalen<br />
Energieprojektes Lienz“ die<br />
Chancen und Vorteile einer<br />
umfassenden Bürgerbeteiligung<br />
für die verschiedenen<br />
Akteursgruppen auf und fasst<br />
die Erfahrung mit der kooperativen<br />
Projektentwicklung in<br />
einer Art Anleitungsempfehlung<br />
für erfolgreiche Bürgerbeteiligung<br />
zusammen.<br />
Das Buch<br />
Oskar Januschke:<br />
„Umfassende Bürgerbeteiligung“,<br />
ISBN: 978-3-<br />
902545-00-8, Herausgeber:<br />
Studiengang Public<br />
Management, Fachhochschule<br />
Kärnten, Reihe:<br />
PuMa-Schriftenreihe,<br />
Band 1 (2007), 237 Seiten,<br />
Preis: 21,50 Euro<br />
Bestellungen an E-Mail:<br />
forschung@puma.<br />
fh-kaernten.at,<br />
Fax: 04242 90500 1210<br />
Tel: 04242 90500 1234<br />
Rechtsbuch<br />
Reisekosten<br />
Novelle 2007<br />
Reisekosten gehören zu den<br />
in Theorie und Praxis meistdiskutierten<br />
Themen des<br />
steuerlichenAlltags.<br />
Das<br />
ist weder<br />
eine<br />
Erscheinung<br />
des<br />
Augenblicks,<br />
noch auf<br />
das österreichische Steuerrecht<br />
beschränkt. Die Gründe<br />
dafür liegen auf der Hand:<br />
Der Großteil der Steuerzahler<br />
ist unmittelbar selbst von den<br />
Reisekosten betroffen.<br />
Das vorliegende aktualisierte<br />
SWK-Spezial Reisekosten in<br />
der Praxis stellt die geltende<br />
Rechtslage auf Grund der Reisekosten-Novelle<br />
2007<br />
umfassend dar. Zahlreiche<br />
Übersichten (z.B. tabellarische<br />
Gegenüberstellung der<br />
alten und neuen Rechtslage),<br />
Beispiele und Musterformulare<br />
ergänzen den Inhalt und<br />
bieten dem Praktiker einen<br />
leicht verständlichen Behelf<br />
für die tägliche Arbeit.<br />
Das Buch<br />
Eduard Müller, „Die<br />
Auswirkungen der Reisekosten-Novelle<br />
2007<br />
in der Praxis“, Linde<br />
Verlag Wien, 1. Auflage<br />
2007, 152 Seiten, kart.,<br />
ISBN 978-3-7073-1183-<br />
9, 16,80 Euro<br />
Tel.: 01/24 630-30,<br />
Fax: 01/24 630-53<br />
www.lindeverlag.at<br />
Rechtsbuch<br />
Abfall -<br />
management<br />
Mit dem AWG 2002 wurden<br />
Systematik und Konzeption<br />
des österreichischen Abfallwirtschaftsrechts<br />
zum Teil<br />
grundlegend verändert. Zum<br />
neuen AWG sind seitdem<br />
bereits vier weitere Novellen<br />
ergangen, zuletzt das zum<br />
Großteil am 1. April 2006 in<br />
Kraft getretene Umweltrechtsanpassungsgesetz<br />
2005. Zudem ist in den letzten<br />
Jahren das Volumen an<br />
einschlägiger Rechtsprechung<br />
auf diesem Gebiet dramatisch<br />
angewachsen. Der<br />
Rechtsprechung kommt im<br />
Abfallwirtschaftsrecht aufgrund<br />
der vielfach unklaren<br />
Rechtslage zentrale und<br />
essentielle Bedeutung zu.<br />
Diese Edition baut nun auf<br />
der 2002 eingeleiteten Entwicklung<br />
auf und verarbeitet<br />
den letzten Stand der Rechtsentwicklung<br />
auf europäischer<br />
und österreichischer Ebene<br />
und gibt Antworten auf Fragen,<br />
mit denen der Rechtsanwender<br />
in diesem Bereich<br />
täglich konfrontiert ist.<br />
Das Buch<br />
Christian M. Piska „Das<br />
Recht des Abfallmanagements“,<br />
Band 1, ISBN<br />
978-3-7083-0337-6,<br />
Band 2, ISBN 978-3-<br />
7083-0448-9 und Band<br />
3, ISBN 978-3-7083-<br />
0462-5, Neuer Wissenschaftlicher<br />
Verlag<br />
GmbH, 1040 Wien<br />
Tel.: 01/535 61 03-21;<br />
Fax: 01/535 61 03-25;<br />
E-Mail: office@nwv.at<br />
Ankündigung<br />
In der kommenden Ausgabe von KOMMUNAL<br />
lesen Sie alles über<br />
den 54. Östereichischen Gemeindetag und<br />
die KOMMUNALMESSE 2007<br />
Erscheinungstermin: 11. 10. 2007<br />
Anzeigenschluss: 13. 9. 2007<br />
Infos unter Telefon: 0043/1/5322388-0
Alfredo Rosenmaier<br />
Bürgermeister<br />
Wien Energie versorgt auch Ihre Gemeinde umweltfreundlich mit Strom<br />
aus 100% Wasserkraft. Nutzen Sie langjährige Kommunalerfahrung und<br />
informieren Sie sich über die günstigen Preise, das energiesparende<br />
Lichtservice und alle Dienstleistungen. Mehr Infos unter 01/97 700-38171.<br />
Zwei für Ebenfurth:<br />
Alfredo Rosenmaier<br />
und Wien Energie.<br />
www.wienenergie.at WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.