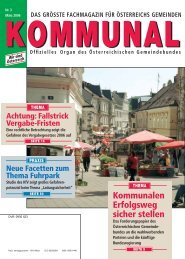DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Recht & Verwaltung<br />
Gesundheitsgefährdung bei der Wasserversorgung<br />
Doppelte Haftungsfalle<br />
Bleirohre<br />
Sowohl bei der Trinkwasserversorgung als auch als Vermieterin kann die Gemeinde Haftungsansprüchen<br />
wegen der Gesundheitsgefährdung durch bleihaltige Wasserrohre<br />
ausgesetzt sein. In welchen Fallkonstellationen wurde diese Haftung bereits schlagend,<br />
wo ergeben sich zusätzliche Gefährdungspotenziale?<br />
◆ a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Vonkilch<br />
In einer Entscheidung des OGH (OGH<br />
4. 4. 2006, 1 Ob 256/05m) wurde<br />
jüngst die Haftung einer Gemeinde<br />
bejaht, wenn sie es im Rahmen der<br />
öffentlichen Trinkwasserversorgung<br />
unterlässt, für die Abwehr jener<br />
Gesundheitsgefahren zu sorgen, die<br />
von Bleileitungen ausgehen<br />
können. Im Folgenden<br />
werden<br />
zunächst die Kernaussagen<br />
der Entscheidung<br />
sowie die aus<br />
ihr resultierenden<br />
finanziellen Konsequenzen<br />
dargestellt.<br />
Dass diese Konsequenzen<br />
die konkrete<br />
Gemeinde im Anlass -<br />
fall nicht in vollem<br />
Umfang getroffen<br />
haben, resultierte bloß aus den<br />
Umständen des Einzelfalls: der OGH<br />
bejahte bezüglich des von der Klägerin<br />
geltend gemachten Schmerzengelds<br />
◆ A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas<br />
Vonkilch ist am Institut für Zivilrecht<br />
der Universität Wien tätig.<br />
28 KOMMUNAL<br />
Abzuraten ist einer<br />
Gemeinde von einem<br />
Zuwarten mit der<br />
Aufarbeitung der<br />
Bleirohr-Problematik in<br />
ihren Miethäusern.<br />
das Zustandekommen eines Vergleichs ,<br />
der sich für die beklagte Gemeinde im<br />
nachhinein als sehr günstig herausstellte.<br />
Konkret waren von der<br />
Gemeinde aufgrund des Vergleichs nur<br />
ca. 7300 Euro an Schmerzensgeld zu<br />
leisten, und nicht – wie von der Klägerin<br />
(dem Grunde nach<br />
grundsätzlich wohl<br />
berechtigt, aber auf-<br />
grund des Vergleichs<br />
„zu spät“) in weiterer<br />
Folge geltend gemacht<br />
– ca. 138.000 Euro.<br />
Darüber hinaus kann in<br />
Hinblick auf die Thematik<br />
„Bleirohre“ nicht<br />
allein schon deswegen<br />
Entwarnung gegeben<br />
werden, weil das<br />
öffentliche Wasserversorgungsnetz<br />
bereits dem Stand der<br />
Technik angepasst wurde. Im Hinblick<br />
auf die weit verbreitete Rolle von<br />
Gemeinden als private Wohnungsvermieter<br />
ist es nämlich keineswegs ausgeschlossen,<br />
dass es aufgrund des Inkrafttretens<br />
der Wohnrechtsnovelle 2006<br />
(WRN 2006) mit 1. 10. 2006, zu einem<br />
zweiten Akt des (auch finanziellen)<br />
Dramas „Die Gemeinde und das Bleirohr“<br />
kommt. So fungiert etwa die<br />
Gemeinde Wien als Vermieterin von ca.<br />
220.000 Gemeindewohnungen.<br />
Haftung wegen mangelhafter<br />
Wasserversorgung<br />
Im Anlassfall war Folgendes passiert:<br />
Aufgrund des Vorhandenseins eines<br />
fünf bis sechs Meter langen Bleirohrs<br />
unmittelbar vor dem Haus der Klägerin<br />
(aber immer noch im Bereich der<br />
öffentlichen Wasserleitung), dessen Existenz<br />
der Gemeinde seit 1952 bekannt<br />
war, kam es nach Entnahmepausen zu<br />
einer Bleibelastung des Trinkwassers<br />
im Haus der Klägerin im Umfang von<br />
60 bis 110 Mikrogramm pro Liter 1 . Aus<br />
diesem Grund hatte sich die Klägerin<br />
1 Zum Vergleich: Die WHO meint, dass nur<br />
ein Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter<br />
alle Bevölkerungsgruppen sicher vor Gesundheitsschäden<br />
schützt. Sie geht dabei von<br />
einem ca. 5 kg schweren Säugling aus, der<br />
durchschnittlich pro Tag einen dreiviertel<br />
Liter Wasser trinkt. Dieser Grenzwert liegt<br />
auch der EU-Trinkwasserrichtlinie vom 16.<br />
10. 1997 zugrunde. In Umsetzung dieser<br />
Richtlinie muss Österreich den Grenzwert ab<br />
1. 12. 2003 auf 25 Mikrogramm pro Liter<br />
und ab 1. 12. 2013 auf den WHO-Wert von<br />
10 Mikrogramm pro Liter senken. Gemäß § 3<br />
Abs 1 der Trinkwasserverordnung vom 21. 8.<br />
2001, BGBl II 2001/304, muss Wasser geeignet<br />
sein, ohne Gefährdung der menschlichen<br />
Gesundheit getrunken oder verwendet zu<br />
werden, und den in Anhang I Teil A und B<br />
festgelegten Mindestanforderungen entsprechen.<br />
Teil A Anhang I sieht für Blei ebenfalls<br />
einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro<br />
Liter vor. Aus Anmerkung 4 ergibt sich, dass<br />
dieser Wert spätestens ab 1. 12. 2013 einzuhalten<br />
ist, er bis 1. 12. 2003 50 Mikrogramm<br />
pro Liter und für den Zeitraum 1. 12. 2003<br />
bis 1. 12. 2013 25 Mikrogramm pro Liter<br />
beträgt. Gemäß Anmerkung 3 ist die Probe in<br />
der Weise zu entnehmen, dass sie für die<br />
durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme<br />
repräsentativ ist.