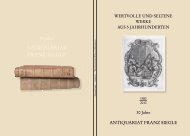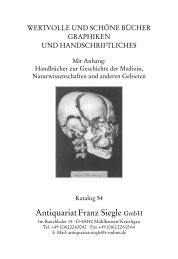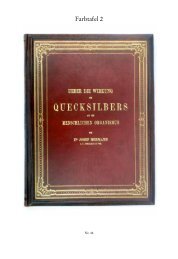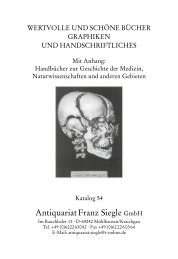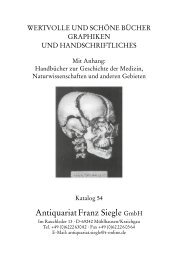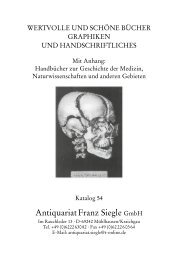Alte Medizin · Homöopathie Alte ... - Antiquariat Franz Siegle
Alte Medizin · Homöopathie Alte ... - Antiquariat Franz Siegle
Alte Medizin · Homöopathie Alte ... - Antiquariat Franz Siegle
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
des Reichsklosters Lorsch aber einzigartiges und unschätzbares Quellenwerk“ (Kat. „Handschriften<br />
des Reichsklosters Lorsch“, 1964, Nr. 14). – Das Kloster Lorsch, welches zuerst reichsunmittelbar<br />
war, wurde unter Friedrich II. kurmainzisch und 1461 kurpfälzisch. Der vorliegende Codex<br />
wurde auf Veranlassung Karl Theodors von dem Sekretär der Mannheimer Akademie, Andreas<br />
Lamey (1726–1802), zusammengestellt und in vorliegender Form erstmals veröffentlicht.<br />
Der Lorscher Codex (lat. Codex Laureshamensis) ist ein zwischen 1170 und 1175 begonnenes<br />
handschriftliches Kopialbuch. Allerdings ist keine einzige der Originalurkunden mehr vorhanden,<br />
von denen die Abschriften gemacht wurden.<br />
„Der Codex wurde erstellt, um die Rechte und Besitztümer des Klosters Lorsch zu dokumentieren<br />
und damit der Abtei langfristig zu sichern. Der Codex wurde im 12. Jahrhundert, als die Lorscher<br />
Macht bereits zurückging, zusammengestellt. Er besteht aus über 3800 urkundlichen Eintragungen<br />
(Traditionsnotizen) eines Rechtsvorgangs (Kauf, Schenkung usw.) mit den dazugehörigen zitierten<br />
Urkunden (von Königen, Päpsten usw.). Diese Urkunden wurden stark verkürzt wiedergegeben.<br />
Die ältesten Rechtsgeschäfte sind ab 764 beschrieben und registriert. Weiterhin enthält der Codex<br />
zwei Gönnerverzeichnisse und eine Äbtechronik. Diese Äbtechronik dient vor allem als Quelle für<br />
die Baugeschichte und der Entwicklung des Kirchenschatzes. Lediglich der Initialbuchstabe der<br />
ersten Seite ist illuminiert. Der Text des Codex ist in karolingischen Minuskeln geschrieben.<br />
Da der Lorscher Codex die Ersterwähnung vieler Gemeinden – über 1.000 Orte werden in ihm<br />
genannt – enthält, wird er von heimatgeschichtlich Interessierten gern anachronistisch als Grundbuch<br />
bezeichnet. Der Lorscher Codex ist die älteste geschriebene Geschichtsquelle für Hunderte<br />
von Orten und beweist das Vorhandensein vieler Ortschaften bereits vor 1100 bis 1200 Jahren.<br />
Im „Codex Laureshamensis“ verzeichneten die Mönche des Lorscher Klosters neben Kauf- und<br />
Tauschverträgen die dem Kloster gemachten Schenkungen von Dörfern, Gehöften, Ländereien und<br />
allerlei sonstigen schätzenswerten Dingen auf Grund der ihnen vorliegenden Originalurkunden<br />
geordnet. In diesem Buch werden zuerst die Schenkungen von Kaisern und Fürsten genannt und<br />
dann die aus dem Volke, letztere geordnet nach Gauen, dem Wormsgau (wo das Kloster etwa 1.180<br />
Güter besaß), dem Speyergau, Lobdengau, Rheingau, Maingau, Neckargau, Kraichgau usw. Die<br />
unter Karl Theodor in Mannheim gegründete Pfälzische Akademie der Wissenschaften gab in den<br />
Jahren 1768–1770 das Werk erstmals im Druck heraus“ (wikipedia). – Heute wird der Codex im<br />
Staatsarchiv Würzburg (bayerisches Staatsarchiv mit Zuständigkeitsbereich Unterfranken) aufbewahrt.<br />
Einbände nur leicht berieb., ein Kapital mit kl. Fehlstelle; insgesamt ein prachtvolles Exemplar. –<br />
Holzmann/Bohatta I, 9681. Dahlmann/Waitz 1181. Brunet VI, 21768. Veitenheimer, Druckort<br />
Mannheim, 537. – Siehe Einbandabbildung 3. Umschlagseite (oben links).<br />
Luthers Anweisung zum Beten für die Einfältigen<br />
44 LUTHER, MARTIN, Ein einfeltige weise zu Beten, für einen guten freund. Mit<br />
breiter Titelbordüre des Monogrammisten MS (?) und 1 geschnittenen Initiale. 16 Bll.<br />
4°. Umschlag. (Wittenberg, Hans Lufft), 1535. € 1.200.–<br />
Erste Ausgabe. – Für das Volk geschriebene einfache Anweisung zum Beten, „dem Meister Peter<br />
Balbirer“ gewidmet: „Lieber Meister Peter, Ich gebs euch so gut als ichs habe, und wie ich selber<br />
mich mit beten halte...“. Balbirer hieß mit Familiennamen eigentlich Beskendorf; er war eine bei<br />
den Professoren bekannte Persönlichkeit. Melanchthon nannte ihn „einen um viele wohl verdienten<br />
Greis“ (Köstlin-Kawerau II, 297 f.). – Die schöne Bordüre zeigt den guten Hirten mit dem<br />
Lamm über der Schulter und die Embleme der fünf Reformatoren mit deren Monogramm (Luther,<br />
Melanchthon, Jonas, Bugenhagen und Cruciger), abgebildet bei J. Luther, Taf. 28. – Vereinzelt<br />
gebräunt, gering fleckig, Titel mit angeschnittenem hs. Besitzvermerk, seitlich und unten sehr<br />
breitrandig. – Benzing 3148<br />
Jean Paul Marat und Alessandro Volta<br />
45 (MARAT, J.-P.), Lettres de l’observateur Bon-Sens a M. de***, sur la fatale catastrophe<br />
des infortunes Pilatre de Rosier & Romain, les aéronautes & l’aérostation. Mit<br />
2 Kupfertafeln. 39 Seiten. Lederband der Zeit. Paris, Méquignon, 1785. – VORGE-<br />
31