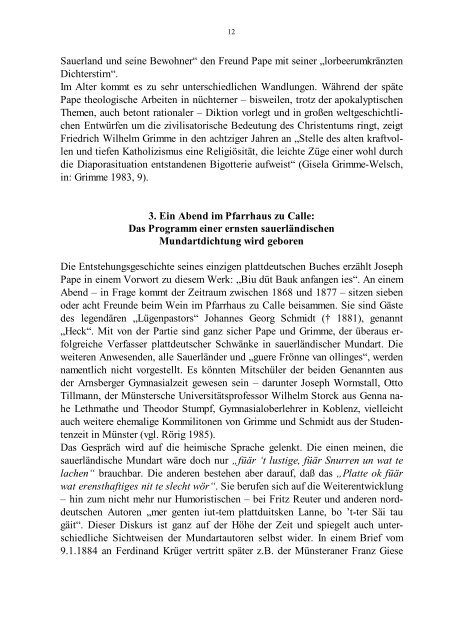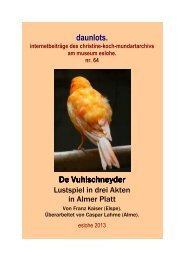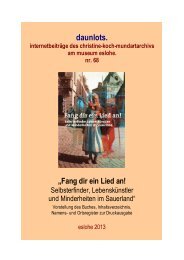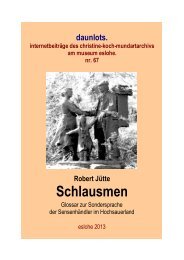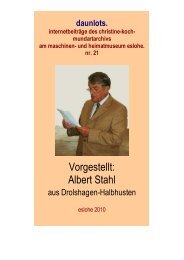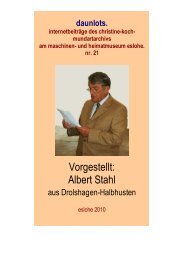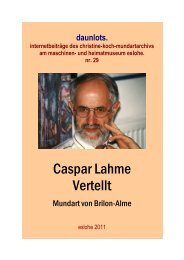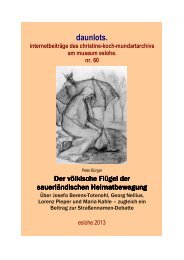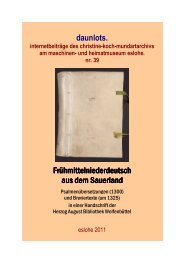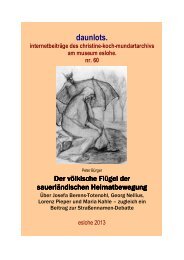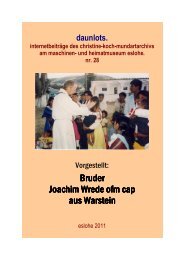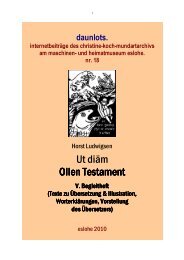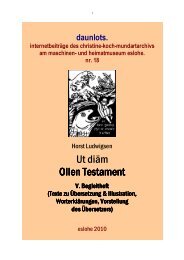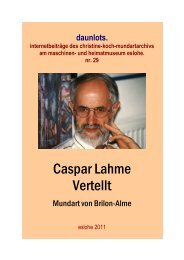I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12<br />
Sauerland und seine Bewohner“ den Freund <strong>Pape</strong> mit seiner „lorbeerumkränzten<br />
Dichterstirn“.<br />
Im Alter kommt es zu sehr unterschiedlichen Wandlungen. Während der späte<br />
<strong>Pape</strong> theologische Arbeiten in nüchterner – bisweilen, trotz der apokalyptischen<br />
Themen, auch betont rationaler – Diktion vorlegt und in großen weltgeschichtlichen<br />
Entwürfen um die zivilisatorische Bedeutung des Christentums ringt, zeigt<br />
Friedrich Wilhelm Grimme in den achtziger Jahren an „Stelle des alten kraftvollen<br />
und tiefen Katholizismus eine Religiösität, die leichte Züge einer wohl durch<br />
die Diaporasituation entstandenen Bigotterie aufweist“ (Gisela Grimme-Welsch,<br />
in: Grimme 1983, 9).<br />
3. Ein Abend im Pfarrhaus zu Calle:<br />
Das Programm einer ernsten sauerländischen<br />
Mundartdichtung wird geboren<br />
Die Entstehungsgeschichte seines einzigen plattdeutschen Buches erzählt <strong>Joseph</strong><br />
<strong>Pape</strong> in einem Vorwort zu diesem Werk: „Biu düt Bauk anfangen ies“. An einem<br />
Abend – in Frage kommt der Zeitraum zwischen 1868 und 1877 – sitzen sieben<br />
oder acht Freunde beim Wein im Pfarrhaus zu Calle beisammen. Sie sind Gäste<br />
des legendären „Lügenpastors“ Johannes Georg Schmidt († 1881), genannt<br />
„Heck“. Mit von der Partie sind ganz sicher <strong>Pape</strong> und Grimme, der überaus erfolgreiche<br />
Verfasser plattdeutscher Schwänke in sauerländischer Mundart. Die<br />
weiteren Anwesenden, alle Sauerländer und „guere Frönne van ollinges“, werden<br />
namentlich nicht vorgestellt. Es könnten Mitschüler der beiden Genannten aus<br />
der Arnsberger Gymnasialzeit gewesen sein – darunter <strong>Joseph</strong> Wormstall, Otto<br />
Tillmann, der Münstersche Universitätsprofessor Wilhelm Storck aus Genna nahe<br />
Lethmathe und Theodor Stumpf, Gymnasialoberlehrer in Koblenz, vielleicht<br />
auch weitere ehemalige Kommilitonen von Grimme und Schmidt aus der Studentenzeit<br />
in Münster (vgl. Rörig 1985).<br />
Das Gespräch wird auf die heimische Sprache gelenkt. Die einen meinen, die<br />
sauerländische Mundart wäre doch nur „füär ‘t lustige, füär Snurren un wat te<br />
lachen“ brauchbar. Die anderen bestehen aber darauf, daß das „Platte ok füär<br />
wat erensthaftiges nit te slecht wör“. Sie berufen sich auf die Weiterentwicklung<br />
– hin zum nicht mehr nur Humoristischen – bei Fritz Reuter und anderen norddeutschen<br />
Autoren „mer genten iut-tem plattduitsken Lanne, bo ’t-ter Säi tau<br />
gäit“. Dieser Diskurs ist ganz auf der Höhe der Zeit und spiegelt auch unterschiedliche<br />
Sichtweisen der Mundartautoren selbst wider. In einem Brief vom<br />
9.1.1884 an Ferdinand Krüger vertritt später z.B. der Münsteraner Franz Giese