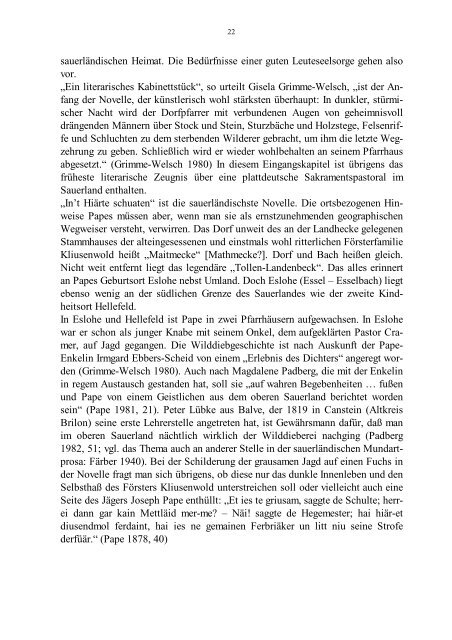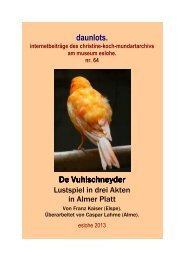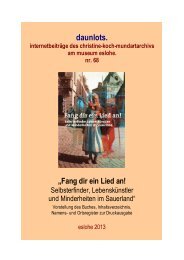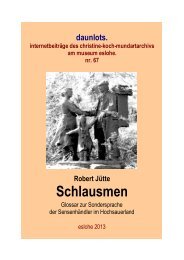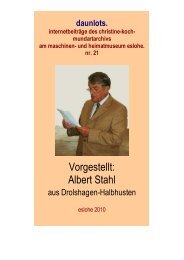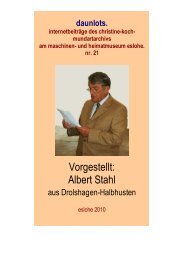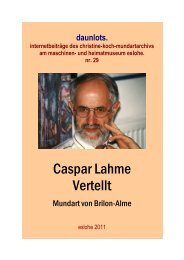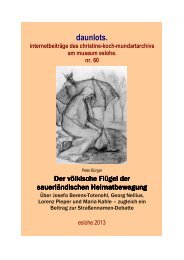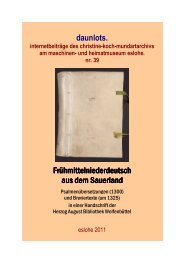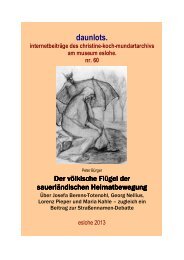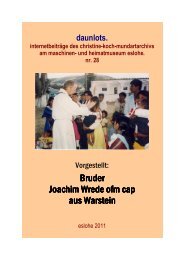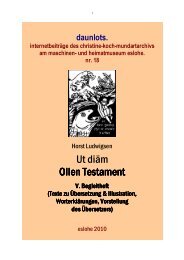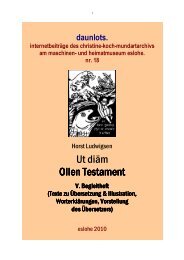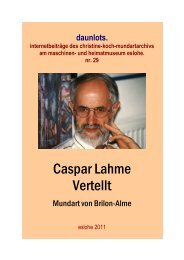I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
sauerländischen Heimat. Die Bedürfnisse einer guten Leuteseelsorge gehen also<br />
vor.<br />
„Ein literarisches Kabinettstück“, so urteilt Gisela Grimme-Welsch, „ist der Anfang<br />
der Novelle, der künstlerisch wohl stärksten überhaupt: In dunkler, stürmischer<br />
Nacht wird der Dorfpfarrer mit verbundenen Augen von geheimnisvoll<br />
drängenden Männern über Stock und Stein, Sturzbäche und Holzstege, Felsenriffe<br />
und Schluchten zu dem sterbenden Wilderer gebracht, um ihm die letzte Wegzehrung<br />
zu geben. Schließlich wird er wieder wohlbehalten an seinem Pfarrhaus<br />
abgesetzt.“ (Grimme-Welsch 1980) In diesem Eingangskapitel ist übrigens das<br />
früheste literarische Zeugnis über eine plattdeutsche Sakramentspastoral im<br />
Sauerland enthalten.<br />
„In’t Hiärte schuaten“ ist die sauerländischste Novelle. Die ortsbezogenen Hinweise<br />
<strong>Pape</strong>s müssen aber, wenn man sie als ernstzunehmenden geographischen<br />
Wegweiser versteht, verwirren. Das Dorf unweit des an der Landhecke gelegenen<br />
Stammhauses der alteingesessenen und einstmals wohl ritterlichen Försterfamilie<br />
Kliusenwold heißt „Maitmecke“ [Mathmecke?]. Dorf und Bach heißen gleich.<br />
Nicht weit entfernt liegt das legendäre „Tollen-Landenbeck“. Das alles erinnert<br />
an <strong>Pape</strong>s Geburtsort Eslohe nebst Umland. Doch Eslohe (Essel – Esselbach) liegt<br />
ebenso wenig an der südlichen Grenze des Sauerlandes wie der zweite Kindheitsort<br />
Hellefeld.<br />
In Eslohe und Hellefeld ist <strong>Pape</strong> in zwei Pfarrhäusern aufgewachsen. In Eslohe<br />
war er schon als junger Knabe mit seinem Onkel, dem aufgeklärten Pastor Cramer,<br />
auf Jagd gegangen. Die Wilddiebgeschichte ist nach Auskunft der <strong>Pape</strong>-<br />
Enkelin Irmgard Ebbers-Scheid von einem „Erlebnis des Dichters“ angeregt worden<br />
(Grimme-Welsch 1980). Auch nach Magdalene Padberg, die mit der Enkelin<br />
in regem Austausch gestanden hat, soll sie „auf wahren Begebenheiten … fußen<br />
und <strong>Pape</strong> von einem Geistlichen aus dem oberen Sauerland berichtet worden<br />
sein“ (<strong>Pape</strong> 1981, 21). Peter Lübke aus Balve, der 1819 in Canstein (Altkreis<br />
Brilon) seine erste Lehrerstelle angetreten hat, ist Gewährsmann dafür, daß man<br />
im oberen Sauerland nächtlich wirklich der Wilddieberei nachging (Padberg<br />
1982, 51; vgl. das Thema auch an anderer Stelle in der sauerländischen Mundartprosa:<br />
Färber 1940). Bei der Schilderung der grausamen Jagd auf einen Fuchs in<br />
der Novelle fragt man sich übrigens, ob diese nur das dunkle Innenleben und den<br />
Selbsthaß des Försters Kliusenwold unterstreichen soll oder vielleicht auch eine<br />
Seite des Jägers <strong>Joseph</strong> <strong>Pape</strong> enthüllt: „Et ies te griusam, saggte de Schulte; herrei<br />
dann gar kain Mettläid mer-me? – Näi! saggte de Hegemester; hai hiär-et<br />
diusendmol ferdaint, hai ies ne gemainen Ferbriäker un litt niu seine Strofe<br />
derfüär.“ (<strong>Pape</strong> 1878, 40)