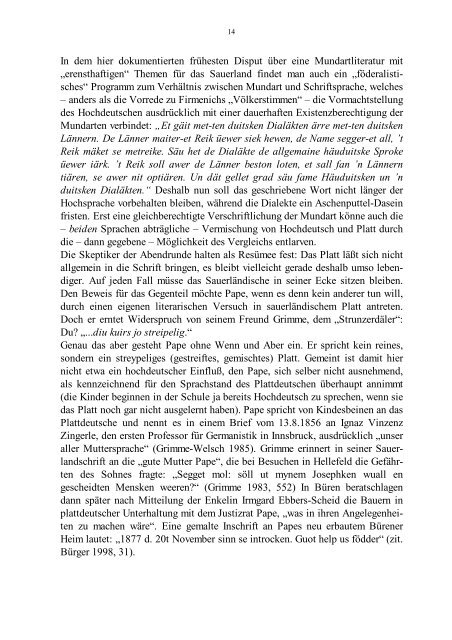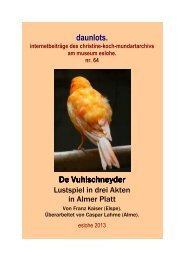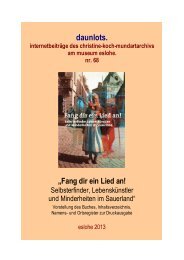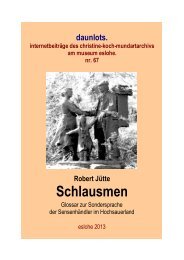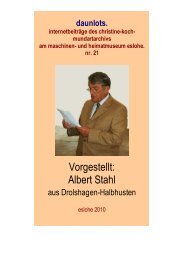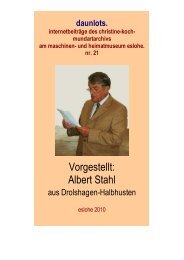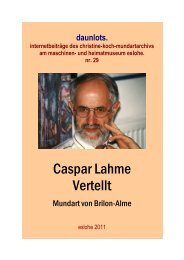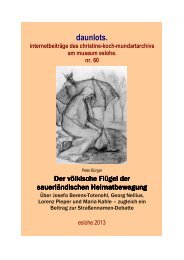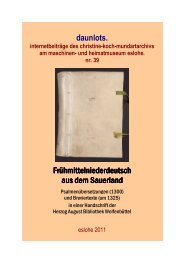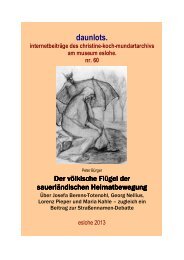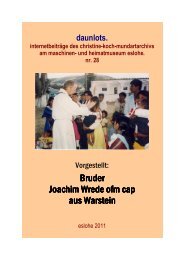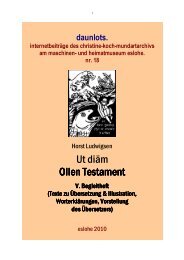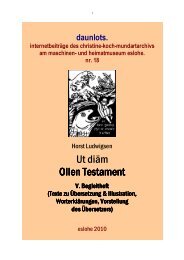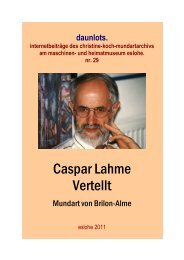I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
14<br />
In dem hier dokumentierten frühesten Disput über eine Mundartliteratur mit<br />
„erensthaftigen“ Themen für das Sauerland findet man auch ein „föderalistisches“<br />
Programm zum Verhältnis zwischen Mundart und Schriftsprache, welches<br />
– anders als die Vorrede zu Firmenichs „Völkerstimmen“ – die Vormachtstellung<br />
des Hochdeutschen ausdrücklich mit einer dauerhaften Existenzberechtigung der<br />
Mundarten verbindet: „Et gäit met-ten duitsken Dialäkten ärre met-ten duitsken<br />
Lännern. De Länner maiter-et Reik üewer siek hewen, de Name segger-et all, ’t<br />
Reik mäket se metreike. Säu het de Dialäkte de allgemaine häuduitske Sproke<br />
üewer iärk. ’t Reik soll awer de Länner beston loten, et sall fan ’n Lännern<br />
tiären, se awer nit optiären. Un dät gellet grad säu fame Häuduitsken un ’n<br />
duitsken Dialäkten.“ Deshalb nun soll das geschriebene Wort nicht länger der<br />
Hochsprache vorbehalten bleiben, während die Dialekte ein Aschenputtel-Dasein<br />
fristen. Erst eine gleichberechtigte Verschriftlichung der Mundart könne auch die<br />
– beiden Sprachen abträgliche – Vermischung von Hochdeutsch und Platt durch<br />
die – dann gegebene – Möglichkeit des Vergleichs entlarven.<br />
Die Skeptiker der Abendrunde halten als Resümee fest: Das Platt läßt sich nicht<br />
allgemein in die Schrift bringen, es bleibt vielleicht gerade deshalb umso lebendiger.<br />
Auf jeden Fall müsse das Sauerländische in seiner Ecke sitzen bleiben.<br />
Den Beweis für das Gegenteil möchte <strong>Pape</strong>, wenn es denn kein anderer tun will,<br />
durch einen eigenen literarischen Versuch in sauerländischem Platt antreten.<br />
Doch er erntet Widerspruch von seinem Freund Grimme, dem „Strunzerdäler“:<br />
Du? „...diu kuirs jo streipelig.“<br />
Genau das aber gesteht <strong>Pape</strong> ohne Wenn und Aber ein. Er spricht kein reines,<br />
sondern ein streypeliges (gestreiftes, gemischtes) Platt. Gemeint ist damit hier<br />
nicht etwa ein hochdeutscher Einfluß, den <strong>Pape</strong>, sich selber nicht ausnehmend,<br />
als kennzeichnend für den Sprachstand des Plattdeutschen überhaupt annimmt<br />
(die Kinder beginnen in der Schule ja bereits Hochdeutsch zu sprechen, wenn sie<br />
das Platt noch gar nicht ausgelernt haben). <strong>Pape</strong> spricht von Kindesbeinen an das<br />
Plattdeutsche und nennt es in einem Brief vom 13.8.1856 an Ignaz Vinzenz<br />
Zingerle, den ersten Professor für Germanistik in Innsbruck, ausdrücklich „unser<br />
aller Muttersprache“ (Grimme-Welsch 1985). Grimme erinnert in seiner Sauerlandschrift<br />
an die „gute Mutter <strong>Pape</strong>“, die bei Besuchen in Hellefeld die Gefährten<br />
des Sohnes fragte: „Segget mol: söll ut mynem <strong>Joseph</strong>ken wuall en<br />
gescheidten Mensken weeren?“ (Grimme 1983, 552) In Büren beratschlagen<br />
dann später nach Mitteilung der Enkelin Irmgard Ebbers-Scheid die Bauern in<br />
plattdeutscher Unterhaltung mit dem Justizrat <strong>Pape</strong>, „was in ihren Angelegenheiten<br />
zu machen wäre“. Eine gemalte Inschrift an <strong>Pape</strong>s neu erbautem Bürener<br />
Heim lautet: „1877 d. 20t November sinn se introcken. Guot help us födder“ (zit.<br />
Bürger 1998, 31).