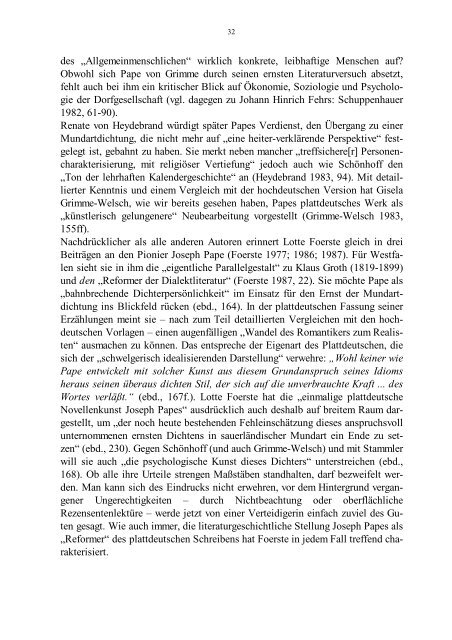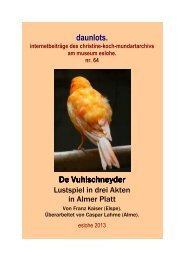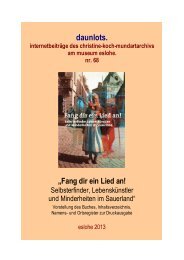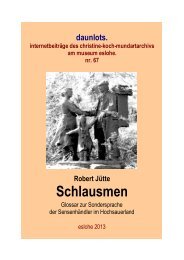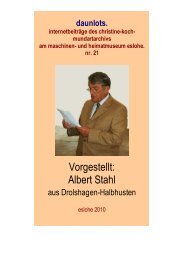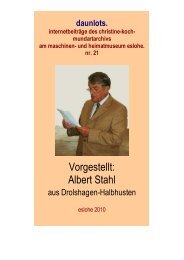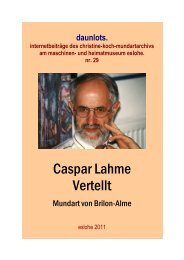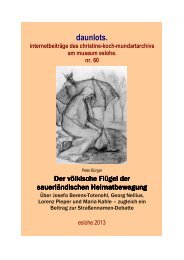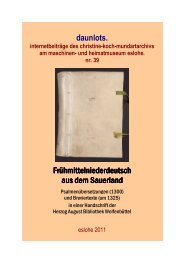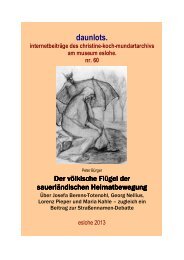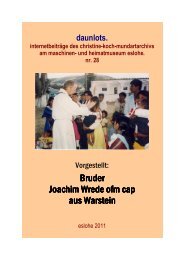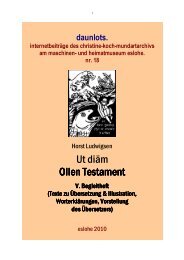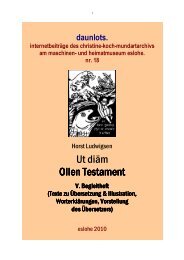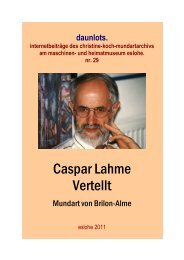I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
I. Joseph Pape - Sauerlandmundart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
32<br />
des „Allgemeinmenschlichen“ wirklich konkrete, leibhaftige Menschen auf?<br />
Obwohl sich <strong>Pape</strong> von Grimme durch seinen ernsten Literaturversuch absetzt,<br />
fehlt auch bei ihm ein kritischer Blick auf Ökonomie, Soziologie und Psychologie<br />
der Dorfgesellschaft (vgl. dagegen zu Johann Hinrich Fehrs: Schuppenhauer<br />
1982, 61-90).<br />
Renate von Heydebrand würdigt später <strong>Pape</strong>s Verdienst, den Übergang zu einer<br />
Mundartdichtung, die nicht mehr auf „eine heiter-verklärende Perspektive“ festgelegt<br />
ist, gebahnt zu haben. Sie merkt neben mancher „treffsichere[r] Personencharakterisierung,<br />
mit religiöser Vertiefung“ jedoch auch wie Schönhoff den<br />
„Ton der lehrhaften Kalendergeschichte“ an (Heydebrand 1983, 94). Mit detaillierter<br />
Kenntnis und einem Vergleich mit der hochdeutschen Version hat Gisela<br />
Grimme-Welsch, wie wir bereits gesehen haben, <strong>Pape</strong>s plattdeutsches Werk als<br />
„künstlerisch gelungenere“ Neubearbeitung vorgestellt (Grimme-Welsch 1983,<br />
155ff).<br />
Nachdrücklicher als alle anderen Autoren erinnert Lotte Foerste gleich in drei<br />
Beiträgen an den Pionier <strong>Joseph</strong> <strong>Pape</strong> (Foerste 1977; 1986; 1987). Für Westfalen<br />
sieht sie in ihm die „eigentliche Parallelgestalt“ zu Klaus Groth (1819-1899)<br />
und den „Reformer der Dialektliteratur“ (Foerste 1987, 22). Sie möchte <strong>Pape</strong> als<br />
„bahnbrechende Dichterpersönlichkeit“ im Einsatz für den Ernst der Mundartdichtung<br />
ins Blickfeld rücken (ebd., 164). In der plattdeutschen Fassung seiner<br />
Erzählungen meint sie – nach zum Teil detaillierten Vergleichen mit den hochdeutschen<br />
Vorlagen – einen augenfälligen „Wandel des Romantikers zum Realisten“<br />
ausmachen zu können. Das entspreche der Eigenart des Plattdeutschen, die<br />
sich der „schwelgerisch idealisierenden Darstellung“ verwehre: „Wohl keiner wie<br />
<strong>Pape</strong> entwickelt mit solcher Kunst aus diesem Grundanspruch seines Idioms<br />
heraus seinen überaus dichten Stil, der sich auf die unverbrauchte Kraft ... des<br />
Wortes verläßt.“ (ebd., 167f.). Lotte Foerste hat die „einmalige plattdeutsche<br />
Novellenkunst <strong>Joseph</strong> <strong>Pape</strong>s“ ausdrücklich auch deshalb auf breitem Raum dargestellt,<br />
um „der noch heute bestehenden Fehleinschätzung dieses anspruchsvoll<br />
unternommenen ernsten Dichtens in sauerländischer Mundart ein Ende zu setzen“<br />
(ebd., 230). Gegen Schönhoff (und auch Grimme-Welsch) und mit Stammler<br />
will sie auch „die psychologische Kunst dieses Dichters“ unterstreichen (ebd.,<br />
168). Ob alle ihre Urteile strengen Maßstäben standhalten, darf bezweifelt werden.<br />
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, vor dem Hintergrund vergangener<br />
Ungerechtigkeiten – durch Nichtbeachtung oder oberflächliche<br />
Rezensentenlektüre – werde jetzt von einer Verteidigerin einfach zuviel des Guten<br />
gesagt. Wie auch immer, die literaturgeschichtliche Stellung <strong>Joseph</strong> <strong>Pape</strong>s als<br />
„Reformer“ des plattdeutschen Schreibens hat Foerste in jedem Fall treffend charakterisiert.