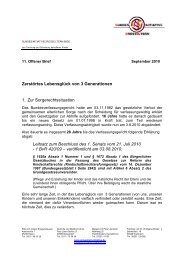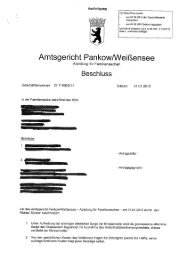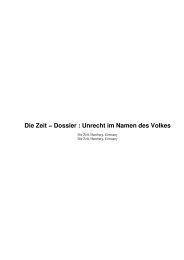Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10<br />
Position des Einzelnen in diesem System zunehmend an Bedeutung gewonnen und<br />
die klaren Hierarchien von früher abgelöst hat.<br />
Seit dem Altertum war das Binnenverhältnis von Eheleuten nicht partnerschaftlich,<br />
son<strong>der</strong>n - analog zum Vater-Kind-Verhältnis - streng hierarchisch angelegt. In Athen<br />
wie auch später in <strong>der</strong> römischen Gesellschaft war <strong>der</strong> Vater das Familienoberhaupt,<br />
wobei „Familie“ nicht nur die Blutsverwandten, son<strong>der</strong>n auch alle weiteren Haus-<br />
haltsmitglie<strong>der</strong>, wie Gesinde und Sklaven, umfasste. Diese waren dem Haushalts-<br />
vorstand gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet. In <strong>der</strong> familialen Hierarchie<br />
war daher die Mutter keine Partnerin des Ehemannes, son<strong>der</strong>n dessen Eigentum<br />
und stand auf einer Stufe mit ihren Kin<strong>der</strong>n. Sie hatte we<strong>der</strong> Entscheidungsbefugnis-<br />
se noch Weisungsberechtigung in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>erziehung. Im Falle ihres Ausscheidens<br />
aus dem Familieverband verlor sie jegliches Anrecht auf die Kin<strong>der</strong> (Reitz, 2003, S.<br />
121).<br />
Das christliche Leitbild reduzierte die Ehe im Wesentlichen auf eine Reproduktions-<br />
funktion. In nahezu allen Kulturen wurden Ehen im Hinblick auf den maximalen Nut-<br />
zen für die Gesamtfamilie ‚gestiftet’, was im ländlichen Raum in zahlreichen Natio-<br />
nen - selbst in Industriestaaten wie beispielsweise in Japan als Tradition des Miai -<br />
bis heute überdauert hat (vgl. Neuss-Kaneko, 1990). Gefühlsbeziehungen zwischen<br />
den Eheleuten zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Heirat waren ohne Belang, wurden häufig sogar<br />
als schädlich angesehen, da Leidenschaft als hin<strong>der</strong>lich für eine überdauernde Ver-<br />
bindung galt. Im Vor<strong>der</strong>grund standen wirtschaftliche o<strong>der</strong> politische Interessen. Für<br />
Frauen war materielle Absicherung ein zentrales Motiv zur Eheschließung, da sie<br />
<strong>nach</strong> einer Heirat nicht länger zur Familie ihres Vaters, son<strong>der</strong>n zu <strong>der</strong> des Eheman-<br />
nes gehörten. Im Europa des Mittelalters war es deshalb für Frauen ein erklärtes<br />
Ziel, möglichst einen älteren, wohlhabenden Mann zu heiraten, in dessen Haushalt<br />
sie sich keiner Schwiegermutter mehr unterzuordnen brauchten, wo sie - weil sie nur<br />
wenige Kin<strong>der</strong> würden gebären müssen - ein geringeres Sterberisiko erwartete und<br />
wo sie zudem auf eine frühe, gut versorgte Witwenschaft hoffen konnten (Schröter,<br />
1990; Reitz, 2003).<br />
Im Zuge des aufkommenden Humanismus verän<strong>der</strong>te sich in den abendländischen<br />
Gesellschaften das Verständnis von Ehe und Familie dann grundlegend. Seinen<br />
deutlichsten Ausdruck fand dieser Wandel in <strong>der</strong> sukzessiven Etablierung eines<br />
wachsenden Mitspracherechts <strong>der</strong> Heiratswilligen – bis hin zur selbst bestimmten,<br />
gefühlsbetonten, ‚romantischen’ Partnerwahl, gesteuert vom Wunsch <strong>nach</strong> persönli-<br />
cher Zufriedenheit und Glück (s. Schenk, 1984, 1987). Sie ersetzte ab dem ausge-<br />
henden 18. Jahrhun<strong>der</strong>t zunehmend die ‚gestiftete’ Ehe.