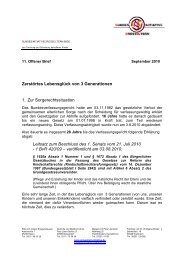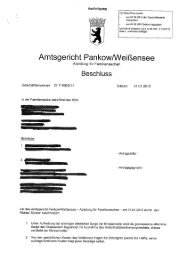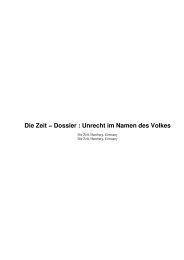Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18<br />
schließlich Objekte väterlicher Gewalt waren, über die <strong>der</strong> Vater zu seinem eigenen<br />
Nutzen weitgehend <strong>nach</strong> Belieben verfügen konnte, wuchs im Verlauf <strong>der</strong> Aufklärung<br />
zunehmend ein Verständnis von elterlichen Pflichten gegenüber dem Kind.<br />
Nachdem die Französische Revolution (und in <strong>der</strong>en Folge vor allem Rousseau) e-<br />
lementare humane Grundwerte wie Freiheit, Brü<strong>der</strong>lichkeit und Gleichheit als univer-<br />
selle Menschenrechte proklamierte, wurde Erziehung - mit dem Ziel <strong>der</strong> Vorbereitung<br />
des Kindes als ebenfalls Träger von Menschenrechten auf eine spätere Selbständig-<br />
keit und Selbstverantwortlichkeit als Bürger - zur elterlichen Pflicht. Damit wandelte<br />
sich die väterliche Gewalt zur uneigennützigen Pflicht. In <strong>der</strong> Romantik wurde diese<br />
Entwicklung allerdings durch reaktionäre Tendenzen, die Familie als einen rechts-<br />
freien, allein durch natürliche Verbindlichkeiten geregelten Privatraum zu betrachten,<br />
vorübergehend zunächst wie<strong>der</strong> abgeschwächt.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t hob das Allgemeine Preußische Landrecht (ALR) die rechtliche<br />
Stellung eines Vaters auf die Ebene eines gesetzlichen Vormunds für das Kind, wo-<br />
mit die väterliche Gewalt zum ersten Mal in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Kindheit seiner allei-<br />
nigen Bestimmungsmacht entzogen und jetzt <strong>der</strong> Kontrolle des Staates unterworfen<br />
wurde. Fortan konnte einem Vater bei groben Verstößen sein Erziehungsrecht durch<br />
das Vormundschaftsgericht aberkannt werden – ein absolutes Novum in <strong>der</strong> Rechts-<br />
geschichte (Parr, 2005, S. 51). Zugleich wurde die Stellung <strong>der</strong> Mutter aufgewertet,<br />
auch sie erhielt zumindest bis zum vierten Lebensjahr des Kindes ein faktisches Er-<br />
ziehungsrecht. Damit schuldeten Kin<strong>der</strong> jetzt beiden <strong>Eltern</strong> Ehrerbietung und Gehor-<br />
sam.<br />
In einem nächsten Schritt wurde mit <strong>der</strong> Einführung des BGB zum 1.1.1900 die ‚vä-<br />
terliche’ durch ‚elterliche’ Gewalt ersetzt. Diese elterliche Gewalt blieb allerdings zu-<br />
nächst weiter aufgeteilt in eine vorrangig ‚väterliche’ (§§ 1627 ff.) und eine ergän-<br />
zende und unterstützende ‚mütterliche’ Gewalt (§ 1634 und §§ 1684 ff.). Ihre Berech-<br />
tigung leitete die elterliche Gewalt aus <strong>der</strong> natürlichen Unselbständigkeit des Kindes<br />
ab. Dadurch hatte sie zugleich jedoch nur eine zeitlich befristete Ersatzfunktion, bis<br />
das Kind selbst in <strong>der</strong> Lage sein würde, seine Interessen eigenständig wahrzuneh-<br />
men. Folglich durfte die elterliche Gewalt nicht länger losgelöst vom Kindesinteresse<br />
ausgeübt werden, son<strong>der</strong>n hatte dies in jedem Fall zu berücksichtigen (vgl. Parr,<br />
2005, S. 23 f.).<br />
Auf diese Weise fand das Kindeswohlprinzip als bindende Leitlinie sowohl für das El-<br />
ternrecht wie auch für alle kindbezogenen gerichtlichen Entscheidungen Eingang ins<br />
Recht, wenngleich auch ohne detaillierte gesetzliche Normierung. Eine Unklarheit,<br />
die bis heute nicht beseitigt ist und insbeson<strong>der</strong>e mit den Jugendämtern immer wie-<br />
<strong>der</strong> zu erheblichen Auseinan<strong>der</strong>setzungen führt. Allerdings beruhen die Schwierig-