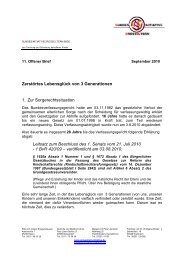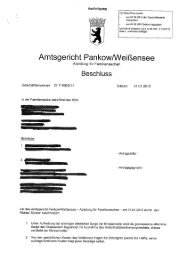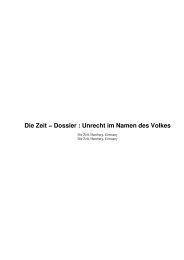Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
48<br />
mann, 1995). Die Angleichung <strong>der</strong> <strong>Eltern</strong>rollen bringt damit aus Sicht <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> mit<br />
sich, dass mit <strong>der</strong> <strong>Trennung</strong> in jedem Fall - ob Mutter o<strong>der</strong> Vater ausziehen – auch<br />
eine wichtige Bezugsperson im kindlichen Alltag verloren geht.<br />
Tab. 4: Neuzeitliche Umgangsregelung <strong>nach</strong> Fthenakis (1995)<br />
bis 6 Mon. täglich einige Stunden<br />
6 - 18 Mon. täglich bis zweitägig für einige Stunden<br />
18 – 36 Mon. 2 – 3 Mal in <strong>der</strong> Woche einige Stunden + 1 Tag am Wochenende<br />
3 – 6 J: Wochenendbesuche; zusätzlich Begegnungen in <strong>der</strong> Woche; Ferienaufenthalte<br />
von einer Woche. Über<strong>nach</strong>tungen im allgemeinen ab 3 Jahre,<br />
spätestens ab 7 Jahre<br />
6 – 10 J: Mehrere Kontakte in <strong>der</strong> Woche und am Wochenende; längere Ferienaufenthalte.<br />
Gewisse Flexibilität ab diesem Alter erfor<strong>der</strong>lich<br />
10 – 12 J: Vergleichbar wie die vorige Gruppe, aber mit zunehmenden Flexibilitätsbedürfnissen<br />
ab 12 J: zwei Kontakte für einige Stunden pro Woche und 14-tägige Besuche mit<br />
o<strong>der</strong> ohne Über<strong>nach</strong>tung<br />
Aus. Offe (2007<br />
Diese Erkenntnis, dass <strong>der</strong> Verlust des Vaters o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mutter durch Scheidung<br />
gleichrangige Traumata darstellen, fand ihren Nie<strong>der</strong>schlag zunächst in sehr verän-<br />
<strong>der</strong>ten Empfehlungen für Umgangsgestaltung, die deutlich ausgedehnte Kontakte<br />
vorsehen, damit dem Kind und seinem außerhalb lebenden <strong>Eltern</strong>teil möglichst viel<br />
Alltagsnähe und Intimität erhalten bleiben (vgl. Tab. 4). Dem trägt aber seit 1998<br />
auch das aktuelle Kindschaftsrecht Rechnung. Im Vor<strong>der</strong>grund stehen zudem die<br />
Kooperation von <strong>Eltern</strong> und <strong>der</strong> Abbau ihrer (in <strong>der</strong> Regel partnerschaftlich beding-<br />
ten) Konflikte zum Wohle ihres Kindes.<br />
Die Zentralität, die <strong>der</strong> Gesetzgeber damit dem Beziehungsleben des Kindes bei-<br />
misst, wird darin deutlich, dass einzig dieser Aspekt - Umgang des Kindes mit beiden<br />
<strong>Eltern</strong> und sein Interesse an fortbestehendem Kontakt - für den ansonsten unbe-<br />
stimmten Rechtsbegriff ‚Kindeswohl’ explizit ausformuliert wurde (§ 1626 BGB). Da-<br />
mit steht <strong>der</strong> juristische Begriff ‚Umgang’ mittlerweile – wie es <strong>der</strong> psychischen Be-<br />
dürftigkeit von Kin<strong>der</strong>n entspricht - als Name für die Zentralität und den Fortbestand<br />
eines Familienlebens aus Kin<strong>der</strong>sicht.