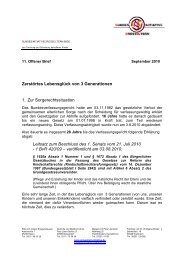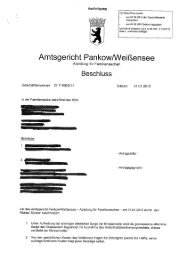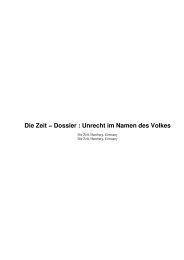Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6<br />
• Viele <strong>Trennung</strong>sfamilien können ihren gewohnten Lebensstan-<br />
dard nicht mehr halten, wodurch ihre Kin<strong>der</strong> in Armut abrutschen.<br />
Dieses Schicksal ereilt inzwischen ein Drittel (!) <strong>der</strong> überwiegen-<br />
den Mehrzahl von Kin<strong>der</strong>n, die anschließend bei ihren Müttern<br />
verbleiben (85 %).<br />
Obwohl Kin<strong>der</strong> den Grund für das Zerwürfnis ihrer <strong>Eltern</strong> zumeist nicht verstehen, ist<br />
<strong>der</strong>en <strong>Trennung</strong> regelmäßig ein Demarkationspunkt in <strong>der</strong> Kindheit, ein tiefer Ein-<br />
schnitt, <strong>der</strong> für ihr weiteres Leben nicht folgenlos bleibt (Gaier, 1988; Fassel, 1994;<br />
Figdor, 1991). Lange Zeit war die Scheidungsforschung, eine noch recht junge Dis-<br />
ziplin, in den 80er-Jahren davon ausgegangen, dass sich die von <strong>Trennung</strong> betroffe-<br />
nen Erwachsenen und Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Regel <strong>nach</strong> einer Übergangsphase von etwa<br />
drei bis fünf Jahren mit den neuen Lebensumständen arrangiert und zu einer verän-<br />
<strong>der</strong>ten Normalität zurückgefunden haben würden. (vgl. Arntzen, 1980; Fthenakis,<br />
Niesel & Kunze. 1982; Fthenakis, 1995).<br />
In weiteren Verlauf zeichnete sich jedoch ab, dass ein nicht unerheblicher Anteil von<br />
Kin<strong>der</strong>n zu keinem ungestörten Beziehungsleben mit beiden <strong>Eltern</strong> zurückfindet,<br />
son<strong>der</strong>n aus unterschiedlichen Gründen den Kontakt zum nicht betreuenden <strong>Eltern</strong>-<br />
teil, meist war dies <strong>der</strong> Vater, verlor. Die Soziologin Anneke Napp-Peters fand her-<br />
aus, dass dies bereits ein Jahr <strong>nach</strong> Scheidung gut die Hälfte <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> betraf<br />
(Napp-Peters, 1985, S. 35; 1995).<br />
Da mit <strong>der</strong> Ausbreitung <strong>der</strong> Scheidungsforschung zunehmend deutlicher wurde, wie<br />
sehr Kin<strong>der</strong> unter dem Verlust ihrer Väter leiden und wie wichtig auch sie für ihre I-<br />
dentitäts- und Persönlichkeitsentwicklung sind (Fthenakis, 1985), wurden - wenn-<br />
gleich auch erst mehr als ein Jahrzehnt später - die gesetzlichen Regelungen im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Kindschaftsrechtsreform von 1998 schließlich so verän<strong>der</strong>t, dass seit-<br />
dem vor allem die Bindungen zwischen <strong>Trennung</strong>skin<strong>der</strong>n und ihren beiden <strong>Eltern</strong><br />
beson<strong>der</strong>s geschützt sind. Bis dahin war dies nicht <strong>der</strong> Fall; nicht verheiratete Väter<br />
konnten sogar durch das Gericht vom Umgang mit ihrem Kind ausgeschlossen wer-<br />
den, sofern die Mutter diesen Kontakt ablehnte (Jopt, 1992; Peschel-Gutzeit, 1989).<br />
Erst durch die Reform än<strong>der</strong>te sich diese Haltung grundlegend. Durch die ausdrück-<br />
liche gesetzliche Verankerung <strong>der</strong> Kontinuität von Kind-<strong>Eltern</strong>-Beziehungen als zent-<br />
rale Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung des Kindes, blieb das Recht auf<br />
Kontakt zum an<strong>der</strong>en <strong>Eltern</strong>teil, das so genannte Umgangsrecht, nicht länger nur ein<br />
Recht des <strong>Eltern</strong>teils am Kind, son<strong>der</strong>n wurde nun auch explizit als eigenständiges<br />
Recht des Kindes etabliert.