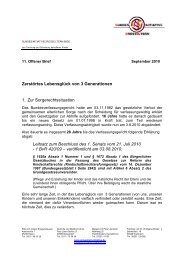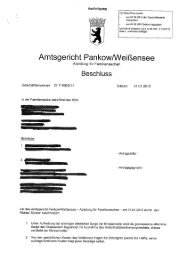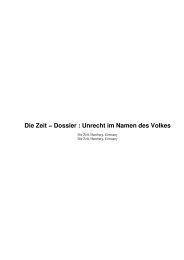Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
50<br />
son<strong>der</strong>n sie stellen sie in direkten Zusammenhang mit dem Umgang o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Person<br />
des An<strong>der</strong>en („Das Kind will nicht zu dir!“, Das Kind will nicht zu dir zurück!“). Dass<br />
sie in dieser Weise kausal attribuieren, ist Folge des aus Interpunktion und subjekti-<br />
ver Wahrheit (s. Kap. 3.) herrührenden wechselseitigen Negativbildes. Typische Re-<br />
aktion <strong>der</strong> betreuenden <strong>Eltern</strong>teile ist, daraufhin – unter Verweis auf die Symptome -<br />
den Umgang einzuschränken, „damit das Kind zur Ruhe kommt“. Durch die darauf-<br />
hin zumeist einsetzende Normalisierung <strong>der</strong> Symptome fühlen sie sich bestätigt und<br />
lehnen fortan den Umgang völlig ab, da <strong>der</strong> fürs Kind nicht gut ist. Dabei wird seitens<br />
<strong>der</strong> <strong>Eltern</strong> regelmäßig übersehen, dass es die wegfallende Konfliktspannung, nicht<br />
die Einstellung des Umgangs ist, die zur Beruhigung <strong>der</strong> Lage geführt hat. Das Kind<br />
gerät auf diese Weise rasch in die Position, bei <strong>der</strong> nächsten Abholung dem um-<br />
gangsberechtigten <strong>Eltern</strong>teil, dem Jugendamt o<strong>der</strong> auch dem Rechtsanwalt des<br />
betreuenden <strong>Eltern</strong>teils wie<strong>der</strong>holen („selbst sagen“) zu sollen, dass es nicht zum<br />
Umgang wollte. Werden die Umgangskontakte darauf hin längere Zeit unterbrochen,<br />
droht <strong>der</strong> <strong>Eltern</strong>-Kind-Beziehung zudem Entfremdung.<br />
Aus Sicht des Umgangsberechtigten, <strong>der</strong> um seine gute Beziehung zum Kind weiß<br />
(„Bei mir war alles schön, da war sie glücklich!“) sehen diese Verstörung des Kindes<br />
und die Symptome wie ein bewusstes Störmanöver des betreuenden <strong>Eltern</strong>teils aus,<br />
denn sie treten ja nur auf, wenn das Kind bei ihm ist. Er glaubt also nicht daran, dass<br />
<strong>der</strong> Umgang dem Kind schadet (womit er objektiv Recht hat, weil das Kind ja auf die<br />
Spannung zwischen seinen <strong>Eltern</strong> reagiert). Falsch liegt er allerdings zumeist mit<br />
seiner Annahme, dass <strong>der</strong> Betreuende den Umgang bewusst torpedieren will.<br />
Verän<strong>der</strong>t sich diese konfliktbelastete Atmosphäre auch über längere Zeit nicht, ge-<br />
rät das Kind in eine unausweichlichen Loyalitätskonflikt zwischen seinen beiden El-<br />
tern, die es jeden für sich liebt. Die Scheidungsforschung hat mehrfach belegt, dass<br />
eine Wechselwirkung zwischen <strong>der</strong> Konfliktstärke und Umgangskontakten besteht<br />
(Amato, 1994, 2000). Je konfliktträchtiger die <strong>Eltern</strong>beziehung und je länger dieser<br />
Zustand andauert, desto schwieriger und weniger intensiv gestalten sich die Um-<br />
gangskontakte, die Kin<strong>der</strong> reagieren deutlich belasteter (Wallerstein et al., 2002;<br />
Walper, 2005). Wird die aus Umgangskontakten im Kontext hochstrittiger <strong>Eltern</strong>kon-<br />
flikte für die Kin<strong>der</strong> resultierende Belastung ignoriert und die Umgangskontakte er-<br />
zwungen, reagieren Kin<strong>der</strong> verstärkt mit einer Ablehnung <strong>der</strong> Kontakte, die sie teils<br />
in drastischer Weise ausdrücken. Auf diese Weise versuchen sie, sich <strong>der</strong> als uner-<br />
träglich empfundenen Belastung zu entziehen.