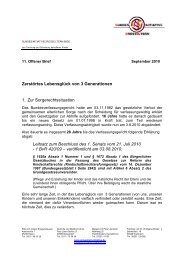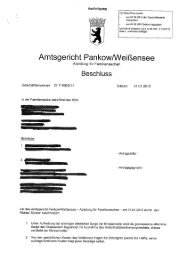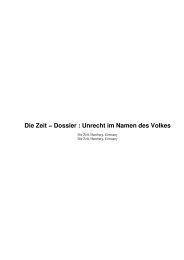Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Kindliche Kontaktverweigerung nach Trennung der Eltern - PUB ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
32<br />
2.6 Synopse: Umgang und Kindeswohl im Spannungsverhältnis<br />
Konflikte um Durchführung und Gestaltung von Umgangsregelungen waren schon zu<br />
Frühzeiten des BGB Gegenstand zahlreicher gerichtlicher Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
gewesen, die ersten Urteile datieren aus 1905. Das damals streng hierarchisch<br />
strukturierte Verständnis von Familie war moralisch geprägt. Entsprechend waren<br />
auch die Algorithmen, <strong>nach</strong> denen entschieden wurde: Ehescheidung und elterliche<br />
Gewalt waren an die Schuldfrage gekoppelt, <strong>Eltern</strong>recht kam vor Kindesinteresse.<br />
Seine eigene Perspektive fand keine Beachtung. Umgang galt allein als Pflicht des<br />
Kindes. Vor diesem Hintergrund galt Umgangsverweigerung als kindlicher Ungehor-<br />
sam (vgl. Parr, 2005).<br />
Bis in die späten 60er Jahre des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts hinein verlief die Aufweichung<br />
dieses autoritären Verständnisses von <strong>der</strong> <strong>Eltern</strong>-Kind-Beziehungen nur in kleinen,<br />
kaum merklichen Schritten, bevor 1980 mit <strong>der</strong> Einführung des Kindeswohl-Konzepts<br />
– das war zugleich <strong>der</strong> Einstieg in eine Psychologisierung des Familienrechts - das<br />
Pendel in die an<strong>der</strong>e Richtung schlug. Immer noch blieb das Kind allerdings weitge-<br />
hend Objekt gerichtlicher Entscheidungen, ihm wurde keine eigene Rechtsstellung<br />
zugebilligt.<br />
Aus dem vorherrschenden ‚Desorganisationsmodell’ zum Verständnis von Schei-<br />
dung, <strong>nach</strong> dem eine Scheidung das Ende <strong>der</strong> Familie markiert (s. dazu Fthenakis,<br />
1986, 1995), wurde abgeleitet, dass da<strong>nach</strong> vor allem ‚Ruhe’ für das Kind einkehren<br />
muss. Diese Vorstellung wurde von den damals tonangebenden Psychologen und<br />
Psychiatern für das einzig richtige Erklärungskonzept gehalten und hatte <strong>nach</strong> <strong>der</strong><br />
Scheidungsrechtsreform von 1977 geradezu den Charakter eines Dogmas (s. Gold-<br />
stein, Freud & Solnit, 1974; Lempp, 1983). Dem<strong>nach</strong> brauchen Scheidungskin<strong>der</strong> ei-<br />
ne auf Kontinuität und Dauerhaftigkeit ausgerichtete klare Zuordnung zu einem El-<br />
ternteil, damit „klare Verhältnisse“ bestehen und sie nicht durch ihre <strong>Eltern</strong> hin und<br />
her gerissen werden.<br />
Die bei je<strong>der</strong> Scheidung zwingende Übertragung des Sorgerechts auf immer nur ei-<br />
nen <strong>Eltern</strong>teil war insofern nur folgerichtig. Sie wurde erst im November 1982 durch<br />
das Verfassungsgericht für unzulässig erklärt, <strong>nach</strong>dem mehrere Richter (!) sich ge-<br />
weigert hatten, schematisch <strong>nach</strong> dieser Vorgabe auch dann einen <strong>Eltern</strong>teil recht-<br />
lich auszugrenzen, wenn beide ausdrücklich auch <strong>nach</strong> <strong>der</strong> Scheidung die Rechts-<br />
verantwortung für ihr Kind weiterhin gemeinsam tragen wollten.<br />
Bei so genannten nichtehelichen Kin<strong>der</strong>n sollte damals <strong>der</strong> Umgang ausschließlich<br />
„<strong>nach</strong> Bedarf des Kindes“ geregelt werden (Lempp, 1984). Für nicht verheiratete Vä-<br />
ter wurde damit die Beziehung zu ihrem Kind als potenzielle Störung des kindlichen<br />
Ruhebedürfnisses angesehen, sofern seine Mutter durch solche Kontakte verunsi-