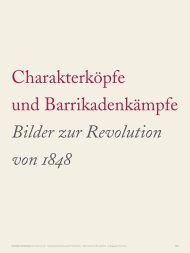Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Christine Landfried 13<br />
<strong>Demokratie</strong> und Vernunft<br />
Beim Lesen des Titels denkt man an einen Druckfehler. Was hat <strong>Demokratie</strong><br />
mit Vernunft zu tun? Ist es nicht so, dass in einer <strong>Demokratie</strong> der Wille des<br />
Volkes zählt, sei er nun vernünft ig oder nicht? Sind die Entscheidungen nicht<br />
einfach deshalb für alle verbindlich, weil sie nach demokratischen Verfahren<br />
zustande gekommen sind? Und doch erwarten die Bürger zu Recht von ihren<br />
gewählten Vertretern angemessene Diagnosen der Probleme und erfolgversprechende<br />
Konzepte für die Gestaltung der nationalen und internationalen<br />
Politik.<br />
Es ist die Hypothese meines Beitrages, dass sich die gegenwärtige Krise der<br />
repräsentativen <strong>Demokratie</strong> mit dem Misstrauen der Bürger in die Vernünftigkeit<br />
politischer Entscheidungen erklären lässt. Die Bürger sind immer seltener<br />
davon überzeugt, dass es im politischen Prozess um vernünft ige Lösungen<br />
gesellschaft licher Probleme geht. Die Mitglieder von Parlamenten und Regierungen<br />
gelten als abgehoben und vorwiegend den eigenen Interessen oder<br />
den Parteiinteressen verpfl ichtet. Die Bindungen zwischen Bürgern und ihren<br />
Repräsentanten nehmen ab. Das ist nicht nur ein Problem der nationalen Politik.<br />
In dem Maße, in dem die Bindungen der Bürger zu den Repräsentanten<br />
und den nationalen Institutionen abnehmen, werden auch die Spielräume für<br />
unpopuläre Entscheidungen in internationalen Institutionen enger. 1 Es ist daher<br />
eine gute Nachricht, dass die Bürger neue Beteiligungsmöglichkeiten 2 und<br />
Debatten fordern, in denen die Repräsentanten sich mit den Argumenten der<br />
Repräsentierten auseinandersetzen müssen.<br />
In der deliberativen <strong>Demokratie</strong>theorie spielt der vermutete Zusammenhang<br />
zwischen der Partizipation gleicher und freier Bürger einerseits und der Vernünft<br />
igkeit kollektiv verbindlicher Entscheidungen andererseits eine große<br />
Rolle. Es wird angenommen, dass mit demokratischen Verfahren besser als<br />
mit anderen Verfahren vernünft ige Lösungen gesellschaft licher Probleme zu<br />
erreichen sind. Wurde bisher kritisiert, dass dieser demokratietheoretische<br />
Ansatz sehr hohe und vielleicht zu hohe Anforderungen an die Partizipati-<br />
1 Michael Zürn, Martin Binder, Matthias Ecker-Ehrhardt, Katrin Radtke, Politische Ordnungsbildung<br />
wider Willen. In: Zeitschrift für internationale Beziehungen 14 (2007), S. 129 – 164,<br />
hier S.153, Fußnote 34.<br />
2 Dieter Rucht, Engagement im Wandel. Politische Partizipation in Deutschland, WZB Brief<br />
Zivilengagement, Mai 2010.