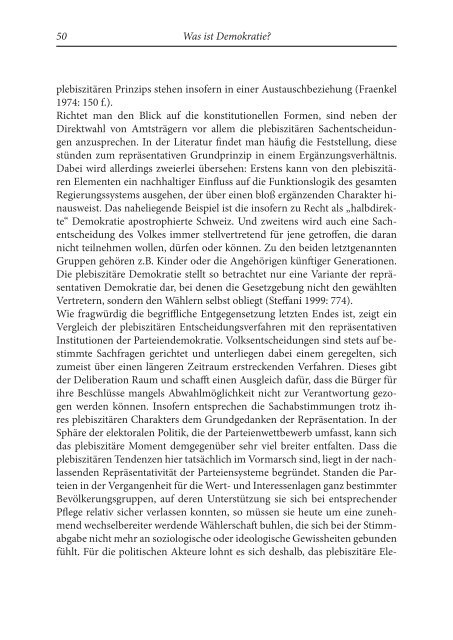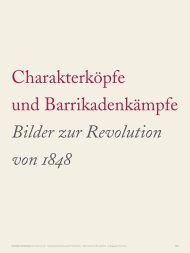Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
50<br />
Was ist <strong>Demokratie</strong>?<br />
plebiszitären Prinzips stehen insofern in einer Austauschbeziehung (Fraenkel<br />
1974: 150 f.).<br />
Richtet man den Blick auf die konstitutionellen Formen, sind neben der<br />
Direktwahl von Amtsträgern vor allem die plebiszitären Sachentscheidungen<br />
anzusprechen. In der Literatur fi ndet man häufi g die Feststellung, diese<br />
stünden zum repräsentativen Grundprinzip in einem Ergänzungsverhältnis.<br />
Dabei wird allerdings zweierlei übersehen: Erstens kann von den plebiszitären<br />
Elementen ein nachhaltiger Einfl uss auf die Funktionslogik des gesamten<br />
Regierungssystems ausgehen, der über einen bloß ergänzenden Charakter hinausweist.<br />
Das naheliegende Beispiel ist die insofern zu Recht als „halbdirekte“<br />
<strong>Demokratie</strong> apostrophierte Schweiz. Und zweitens wird auch eine Sachentscheidung<br />
des Volkes immer stellvertretend für jene getroff en, die daran<br />
nicht teilnehmen wollen, dürfen oder können. Zu den beiden letztgenannten<br />
Gruppen gehören z.B. Kinder oder die Angehörigen künft iger Generationen.<br />
Die plebiszitäre <strong>Demokratie</strong> stellt so betrachtet nur eine Variante der repräsentativen<br />
<strong>Demokratie</strong> dar, bei denen die Gesetzgebung nicht den gewählten<br />
Vertretern, sondern den Wählern selbst obliegt (Steff ani 1999: 774).<br />
Wie fragwürdig die begriffl iche Entgegensetzung letzten Endes ist, zeigt ein<br />
Vergleich der plebiszitären Entscheidungsverfahren mit den repräsentativen<br />
Institutionen der Parteiendemokratie. Volksentscheidungen sind stets auf bestimmte<br />
Sachfragen gerichtet und unterliegen dabei einem geregelten, sich<br />
zumeist über einen längeren Zeitraum erstreckenden Verfahren. Dieses gibt<br />
der Deliberation Raum und schafft einen Ausgleich dafür, dass die Bürger für<br />
ihre Beschlüsse mangels Abwahlmöglichkeit nicht zur Verantwortung gezogen<br />
werden können. Insofern entsprechen die Sachabstimmungen trotz ihres<br />
plebiszitären Charakters dem Grundgedanken der Repräsentation. In der<br />
Sphäre der elektoralen Politik, die der Parteienwettbewerb umfasst, kann sich<br />
das plebiszitäre Moment demgegenüber sehr viel breiter entfalten. Dass die<br />
plebiszitären Tendenzen hier tatsächlich im Vormarsch sind, liegt in der nachlassenden<br />
Repräsentativität der Parteiensysteme begründet. Standen die Parteien<br />
in der Vergangenheit für die Wert- und Interessenlagen ganz bestimmter<br />
Bevölkerungsgruppen, auf deren Unterstützung sie sich bei entsprechender<br />
Pfl ege relativ sicher verlassen konnten, so müssen sie heute um eine zunehmend<br />
wechselbereiter werdende Wählerschaft buhlen, die sich bei der Stimmabgabe<br />
nicht mehr an soziologische oder ideologische Gewissheiten gebunden<br />
fühlt. Für die politischen Akteure lohnt es sich deshalb, das plebiszitäre Ele-