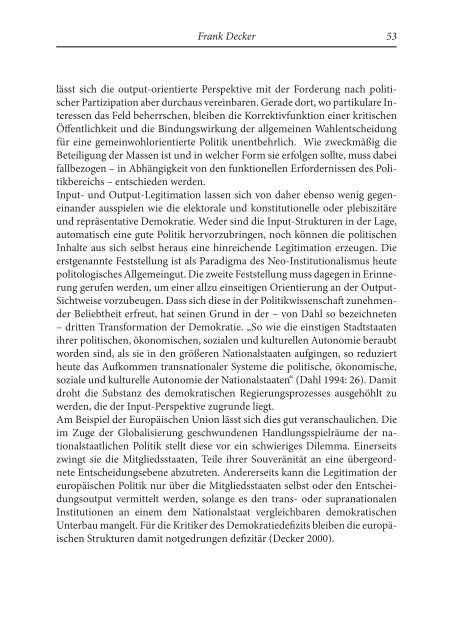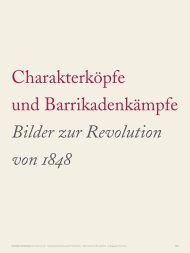Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Frank Decker 53<br />
lässt sich die output-orientierte Perspektive mit der Forderung nach politischer<br />
Partizipation aber durchaus vereinbaren. Gerade dort, wo partikulare Interessen<br />
das Feld beherrschen, bleiben die Korrektivfunktion einer kritischen<br />
Öff entlichkeit und die Bindungswirkung der allgemeinen Wahlentscheidung<br />
für eine gemeinwohlorientierte Politik unentbehrlich. Wie zweckmäßig die<br />
Beteiligung der Massen ist und in welcher Form sie erfolgen sollte, muss dabei<br />
fallbezogen – in Abhängigkeit von den funktionellen Erfordernissen des Politikbereichs<br />
– entschieden werden.<br />
Input- und Output-Legitimation lassen sich von daher ebenso wenig gegeneinander<br />
ausspielen wie die elektorale und konstitutionelle oder plebiszitäre<br />
und repräsentative <strong>Demokratie</strong>. Weder sind die Input-Strukturen in der Lage,<br />
automatisch eine gute Politik hervorzubringen, noch können die politischen<br />
Inhalte aus sich selbst heraus eine hinreichende Legitimation erzeugen. Die<br />
erstgenannte Feststellung ist als Paradigma des Neo-Institutionalismus heute<br />
politologisches Allgemeingut. Die zweite Feststellung muss dagegen in Erinnerung<br />
gerufen werden, um einer allzu einseitigen Orientierung an der Output-<br />
Sichtweise vorzubeugen. Dass sich diese in der Politikwissenschaft zunehmender<br />
Beliebtheit erfreut, hat seinen Grund in der – von Dahl so bezeichneten<br />
– dritten Transformation der <strong>Demokratie</strong>. „So wie die einstigen Stadtstaaten<br />
ihrer politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Autonomie beraubt<br />
worden sind, als sie in den größeren Nationalstaaten aufgingen, so reduziert<br />
heute das Aufk ommen transnationaler Systeme die politische, ökonomische,<br />
soziale und kulturelle Autonomie der Nationalstaaten“ (Dahl 1994: 26). Damit<br />
droht die Substanz des demokratischen Regierungsprozesses ausgehöhlt zu<br />
werden, die der Input-Perspektive zugrunde liegt.<br />
Am Beispiel der Europäischen Union lässt sich dies gut veranschaulichen. Die<br />
im Zuge der Globalisierung geschwundenen Handlungsspielräume der nationalstaatlichen<br />
Politik stellt diese vor ein schwieriges Dilemma. Einerseits<br />
zwingt sie die Mitgliedsstaaten, Teile ihrer Souveränität an eine übergeordnete<br />
Entscheidungsebene abzutreten. Andererseits kann die Legitimation der<br />
europäischen Politik nur über die Mitgliedsstaaten selbst oder den Entscheidungsoutput<br />
vermittelt werden, solange es den trans- oder supranationalen<br />
Institutionen an einem dem Nationalstaat vergleichbaren demokratischen<br />
Unterbau mangelt. Für die Kritiker des <strong>Demokratie</strong>defi zits bleiben die europäischen<br />
Strukturen damit notgedrungen defi zitär (Decker 2000).