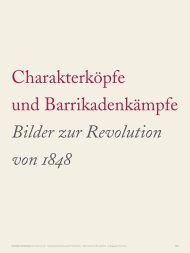Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
36<br />
Was ist <strong>Demokratie</strong>?<br />
inhaltlich enthalten bzw. angelegt ist. 1 Sartori (1992: 17) weist zu Recht darauf<br />
hin, „dass die <strong>Demokratie</strong> aus den Wechselwirkungen zwischen ihren Idealen<br />
und ihrer Wirklichkeit entsteht, aus dem Drang eines Sollens und dem Widerstand<br />
eines Seins“ (Hervorheb. im Orig.). Auch die Polyarchiemerkmale von<br />
Dahl sind letztlich nichts anderes als Konsequenzen der demokratischen Idee.<br />
So notwendig es ist, zwischen einem präskriptiven und deskriptiven Verständnis<br />
von <strong>Demokratie</strong> zu unterscheiden, so unangebracht erscheint es deshalb,<br />
den <strong>Demokratie</strong>begriff in eine ideale <strong>Demokratie</strong> und reale Polyarchie künstlich<br />
zu zerlegen.<br />
Das Festhalten an einem einheitlichen <strong>Demokratie</strong>begriff wirkt zugleich dem<br />
Missverständnis entgegen, wonach Unterschiede zwischen <strong>Demokratie</strong>n und<br />
Nicht-<strong>Demokratie</strong>n lediglich solche des Grades seien (und nicht der Qualität).<br />
Gewiss gibt es beim Übergang von der <strong>Demokratie</strong> zur Nicht-<strong>Demokratie</strong><br />
(und vice versa) Abstufungen und Grauzonen, die eine eindeutige Zuordnung<br />
erschweren. Dies heißt aber nicht, dass es sich um ein bloßes Kontinuum handelt,<br />
dessen Merkmale allein in Kategorien des Mehr oder Weniger erfassbar<br />
sind. Eine Typologie, die so verfährt, läuft Gefahr, die grundlegenden Unterschiede<br />
zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Systemen – und<br />
innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zwischen den autoritären und totalitären<br />
Systemen – zu verwischen (Maćków 2000: 1491). Um dies zu vermeiden<br />
kommt es erstens darauf an, die Unterscheidungsmerkmale zutreff end und<br />
umfassend zu defi nieren. Zweitens müssen die Merkmale empirisch handhabbar<br />
gemacht werden, indem man Indices bildet und sie entsprechend ihrer<br />
Ausprägung gewichtet. Und drittens gilt es Schwellenwerte für den Übergang<br />
vom einen in den anderen Systemzustand festzulegen. Werden Unter- oder<br />
Zwischentypen gebildet, ist auf deren Benennung besondere begriffl iche Sorgfalt<br />
zu verwenden. Hier stellt sich z.B. die Frage, ob es ausreicht, die <strong>Demokratie</strong><br />
einfach nur mit zusätzlichen Adjektiven zu versehen, die ihren Bedeutungsgehalt<br />
einschränken oder konkretisieren (s.u.).<br />
Dahls Polyarchiekonzeption schließt an die minimalistische Defi nition Joseph<br />
A. Schumpeters an. Für Schumpeter ist die <strong>Demokratie</strong> kein Wert an sich und<br />
auch keine Ordnung zur Erreichung von Gemeinwohlzielen, wie sie von der<br />
„klassischen“ <strong>Demokratie</strong>lehre postuliert werde, sondern lediglich eine Me-<br />
1 Die Herrschaft der Vielen kann auch in einer Diktatur Platz greifen, wenn man z.B. an das<br />
Prinzip der kollektiven Führung in den realsozialistischen Systemen denkt. Selbst dem nationalsozialistischen<br />
Führerstaat sind polykratische Tendenzen attestiert worden.