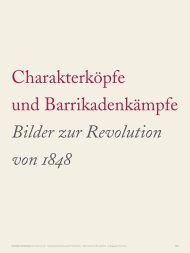Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Dialog 20.indb - Stiftung Demokratie Saarland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
52<br />
Was ist <strong>Demokratie</strong>?<br />
werbsmodell verstanden, das dem Volk die Möglichkeit gibt, die Regierenden<br />
bei Bedarf auszutauschen und ihm darüber das letzte Wort über die Regierungspolitik<br />
zuweist (Kaiser 2004).<br />
Die Output-Legitimation orientiert sich dagegen weniger am Zustandekommen,<br />
als an den Ergebnissen des politischen Prozesses. Sie gründet auf möglichst<br />
eff ektiven und effi zienten Problemlösungen, das heißt auf der Fähigkeit<br />
zum „guten Regieren“. Um dies zu gewährleisten, ist ein bestimmtes Maß an<br />
Autonomie der Regierenden unabdingbar, die sich sowohl gegenüber den<br />
Wählern als auch gegenüber den organisierten Interessen bewähren muss.<br />
Die output-orientierte <strong>Demokratie</strong>theorie folgt demnach einer „gouvernementalistischen“<br />
Sichtweise. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Steigerung der<br />
staatlichen Handlungskapazität im Interesse einer aktiven, dem Gemeinwohl<br />
verpfl ichteten Politik. Von dort aus werden die weiteren Anforderungen an die<br />
Strukturen des politischen Systems bestimmt (Scharpf 1970: 21 ff .).<br />
Während sich die Input-Legitimation an den Wahlen ausrichtet und den plebiszitären<br />
Charakter der <strong>Demokratie</strong> betont, weist die Output-Legitimation<br />
eine größere Affi nität zur verfassungsstaatlichen und repräsentativen <strong>Demokratie</strong>konzeption<br />
auf. Letzteres zeigt sich z.B. in der hohen Wertschätzung der<br />
Verfassungsgerichtsbarkeit oder in der Delegation von Entscheidungszuständigkeiten<br />
an selbständige Einrichtungen und Expertengremien. Die outputorientierte<br />
<strong>Demokratie</strong> setzt mithin auf Verfahren, in denen deliberative, also<br />
beratungsförmige Modi den Prozess der Entscheidungsfi ndung dominieren.<br />
Damit unterscheidet sie sich sowohl vom Egalitarismus der partizipatorischen<br />
<strong>Demokratie</strong>theorie als auch vom Mehrheitsdezisionismus des Wettbewerbsmodells,<br />
die die beiden Pole der Input-Perspektive ausmachen.<br />
Falsch wäre es, die Output-Legitimation mit einem einseitig elitenzentrierten<br />
<strong>Demokratie</strong>verständnis gleichzusetzen, wie es innerhalb der Input-Perspektive<br />
von den Vertretern des realistischen Ansatzes gepfl egt wird. Diese konzipieren<br />
die <strong>Demokratie</strong> als ein Regierungsmodell konkurrierender Machteliten,<br />
während für die Vertreter der partizipatorischen <strong>Demokratie</strong>theorie Eliten<br />
und Führungsminderheiten ein grundsätzliches Übel darstellen (Sartori 1992:<br />
173). Gewiss weisen die Orientierung an deliberativen Prinzipien, der Rückgriff<br />
auf Expertise und die Delegation von Entscheidungsmacht eine elitäre<br />
Schlagseite auf. Dies gilt zumal, wenn sie auf eine förmliche Entinstitutionalisierung<br />
des Regierungsprozesses hinauslaufen und die entscheidungsbefugten<br />
Agenten sich der Kontrolle ihrer Prinzipale entziehen können. Im übrigen