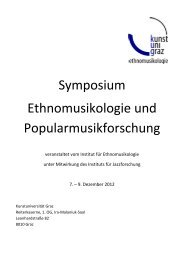Schön ist Bergmannsleben? - Institut 13: Ethnomusikologie ...
Schön ist Bergmannsleben? - Institut 13: Ethnomusikologie ...
Schön ist Bergmannsleben? - Institut 13: Ethnomusikologie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tikal-orientierte Musikauffassung, die Kunst- und Volksmusik im 17. Jahrhundert gleichermaßen<br />
durchdringt und zur Ausbildung der Herrschaft des Dur, der Akkordmelodik, Sequenztechnik<br />
und straffen Periodik führt.“ 124<br />
Die Textverteilung auf die Noten der Melodie <strong>ist</strong> bei der abeleschen Fassung keineswegs<br />
eindeutig, vor allem die Zeile „auf daß es muß erklingen“ <strong>ist</strong> unklar. Auffällig <strong>ist</strong><br />
aber, dass die Wortbetonungen bei den unstrittigen Stellen „Freut euch ihr Berckleut“<br />
und „Lobt Gott mit reichem“, ebenso die entsprechenden ersten und dritten Verse der<br />
anderen Strophen, nicht mit dem Metrum des durchgehenden 6/4-Taktes übereinstimmen,<br />
sondern vielmehr einen 3/2-Takt nahe legen. Dieser Umstand würde dafür sprechen,<br />
dass Abele keine neue Melodie komponiert hat, sondern ein präex<strong>ist</strong>entes Melodiemodell<br />
mit wechselndem Metrum in ein festes Taktschema gebracht und mit einer<br />
Generalbassstimme unterlegt hat. Ob der Cantus jedoch der von Banstingl gemeinte<br />
Ton war, <strong>ist</strong> nicht zu klären, solange nicht neue Quellen zur Melodie des verschollenen<br />
Störtziger (d.h. Sterzinger) Bergreihens auftauchen. Aus ideologieanalytischer Perspektive<br />
muss davon ausgegangen werden, dass die Entscheidung für diese spezielle Melodie<br />
keine ideologischen Implikationen hat. Durch den choralartigen Charakter scheint es<br />
eher für den kontemplativen Vortragsgebrauch geeignet, als für den aktiven als Marschoder<br />
Arbeitslied.<br />
Was <strong>ist</strong> der sozioh<strong>ist</strong>orische Kontext in welchem der Eisenerzer Bergreihen entstand?<br />
Das 16. Jahrhundert war in Eisenerz eine Zeit „voll schwerer wirtschaftlicher, politischer<br />
und religiöser Kämpfe, eine Zeit starken Aufstieges und dann unaufhaltsamen<br />
Abwärtsgleitens“ 125 . Die Eisenproduktion stieg bis in die 60er Jahre beständig an, durch<br />
die landesfürstlich reglementierten Eisenpreise, die steigenden Lebenshaltungskosten<br />
und Löhne sowie die starren Handelsregelungen konnten aber keine große Gewinne erwirtschaftet<br />
werden, die Radme<strong>ist</strong>er machten vielmehr Verluste, was mehrere Erhöhungen<br />
des Eisenpreises und der landesfürstlichen Subventionen notwendig machte. 126 Die<br />
Versorgung mit Lebensmitteln und Kohle war ein weiteres dauerhaftes Problem. 127 Der<br />
124 Hellmut Federhofer und Rudolf Flotzinger, „Musik in der Steiermark. H<strong>ist</strong>orischer Überblick“, Rudolf<br />
Flotzinger (Hg.), Musik in der Steiermark. Katalog der Landesausstellung 1980, Graz 1980: o. V., 80.<br />
125 Hans Pirchegger, „Geschichtliches“, Eduard Stepan (Hg.), Der Steirische Erzberg und seine Umgebung.<br />
Ein Heimatbuch (= Sonderheft der Zeitschrift „Deutsches Vaterland“), Bd. 1, Wien 1924: Verlag<br />
„Deutsches Vaterland“, 55.<br />
126 Vgl. Pirchegger 1924:62-63, 73.<br />
127 Vgl. Pirchegger 1924:58, 63-64.<br />
38