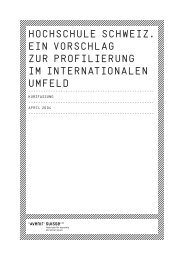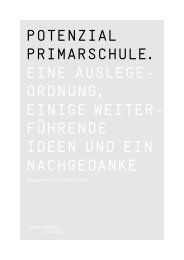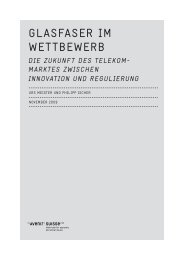Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In diesem Zusammenhang hat eine unter Experten aufgekommene Debatte<br />
an Bedeutung gewonnen. Es geht um die Frage, ob das während<br />
der Finanzkrise geschaffene unkonventionelle Instrumentarium der Zentralbanken<br />
in ihren konventionellen Werkzeugkasten überführt werden<br />
soll. Die Überlegung geht dahin, dass bei wirtschaftlichen Schocks negative<br />
nominale Leitzinsen zur Stimulierung der Nachfrage nötig wären,<br />
aber von den Zentralbanken nicht geliefert werden können. Dieses Dilemma<br />
ist <strong>als</strong> «zero-lower-bound-problem» bekannt (Mishkin 2013). Es kann<br />
auch in Zukunft wieder auftreten. Deshalb bleibt die quantitative Lockerung,<br />
die <strong>als</strong> Offenmarktpolitik seit langem verfügbar ist, ein sinnvolles<br />
geldpolitisches Instrument.<br />
Selbstverständlich müssen die Zentralbanken ihre Instrumente nach<br />
bestem Wissen und Gewissen und in operationeller Freiheit einsetzen.<br />
Wenn sie aber den Eindruck erwecken, das Aussergewöhnliche würde<br />
nun zur neuen Normalität, vermitteln sie f<strong>als</strong>che Anreize. Wenn die Finanzmärkte<br />
davon überzeugt sind, dass die Notenbanken bei grösseren<br />
Spannungen, denen im Interesse der Dramatisierung gerne das Etikett<br />
«Krise» angeheftet wird, wieder massiv in die Marktmechanismen eingreifen,<br />
werden sie höhere Risiken eingehen. Zudem verzögern sie den<br />
Strukturwandel. Verwerfungen und «schöpferische Zerstörung» gehören<br />
nämlich zur Marktwirtschaft. Wenn die Regierungen damit rechnen<br />
können, dass Zentralbanken auf den Sekundärmärkten für Staatsanleihen<br />
intervenieren und deren Risikoprämien drücken, wird ihre Budgetdisziplin<br />
untergraben. Die Politiker werden darauf drängen, dass die Noteninstitute<br />
von diesem erweiterten Instrumentarium Gebrauch machen.<br />
Daraus resultiert die Gefahr, dass der asymmetrische Grundton der Zentralbankpolitik<br />
tendenziell erhalten bleibt. Der Ausstieg aus der ultraexpansiven<br />
Geldpolitik sollte darum ohne Wenn und Aber erfolgen und<br />
der Öffentlichkeit entsprechend klar kommuniziert werden.<br />
Das gilt umso mehr, <strong>als</strong> sich die Welt mit der anhaltenden faktischen<br />
Nullzinspolitik gleichsam in einem riskanten ökonomischen Experiment<br />
befindet (Pickert 2013). Erfahrungen mit einer solchen Politik hat Japan gemacht,<br />
und diese sind alles andere <strong>als</strong> ermutigend. In einem Kapitalismus,<br />
in dem Geld nichts kostet, findet weder eine schöpferische Zerstörung<br />
noch eine Erneuerung statt. Das «Zombie-Lending» hat nach Caballero<br />
d a z u gef ü h r t , d a s s Jap a n i n Re z e s sion u nd St a g n at ion verh a r r t<br />
(Caballero 2012).<br />
William White, der frühere Chefökonom der biz, hat schon vor Ausbruch<br />
der Krise eindringlich vor der expansiven Geldpolitik der Federal<br />
Reserve nach dem Platzen der New Economy-Blase gewarnt – nur blieb<br />
seine Stimme ungehört. In einem neuen Diskussionspapier skizziert er<br />
die möglichen Folgen einer ultralockeren Geldpolitik in stilisierter Form<br />
wie folgt: sie schafft Fehlinvestitionen in der Realwirtschaft, bedroht die<br />
Gesundheit von Banken, stört die Funktionsweise der Finanzmärkte,<br />
begrenzt das «unabhängige» Streben nach Preisstabilität, verleitet die<br />
Zum Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik 45