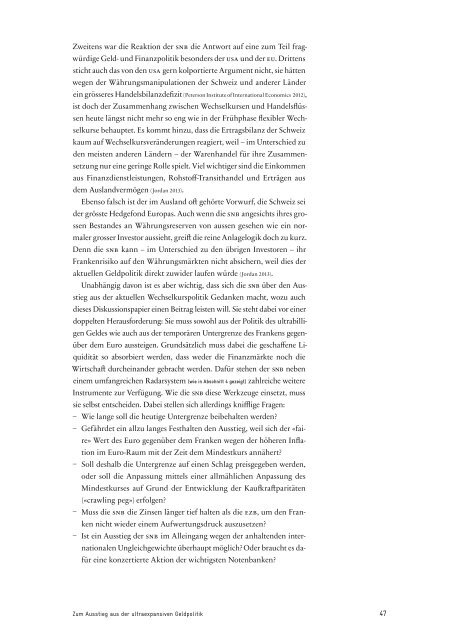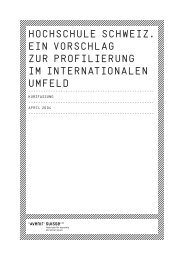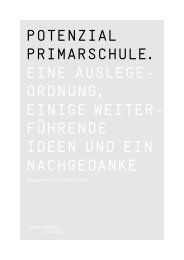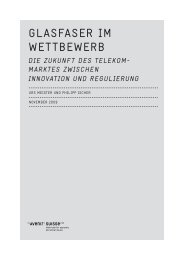Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Zentralbanker als Zauberlehrlinge? - Avenir Suisse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zweitens war die Reaktion der snb die Antwort auf eine zum Teil fragwürdige<br />
Geld- und Finanzpolitik besonders der usa und der eu. Drittens<br />
sticht auch das von den usa gern kolportierte Argument nicht, sie hätten<br />
wegen der Währungsmanipulationen der Schweiz und anderer Länder<br />
ein grösseres Handelsbilanzdefizit (Peterson Institute of International Economics 2012),<br />
ist doch der Zusammenhang zwischen Wechselkursen und Handelsflüssen<br />
heute längst nicht mehr so eng wie in der Frühphase flexibler Wechselkurse<br />
behauptet. Es kommt hinzu, dass die Ertragsbilanz der Schweiz<br />
kaum auf Wechselkursveränderungen reagiert, weil – im Unterschied zu<br />
den meisten anderen Ländern – der Warenhandel für ihre Zusammensetzung<br />
nur eine geringe Rolle spielt. Viel wichtiger sind die Einkommen<br />
aus Finanzdienstleistungen, Rohstoff-Transithandel und Erträgen aus<br />
dem Auslandvermögen (Jordan 2013).<br />
Ebenso f<strong>als</strong>ch ist der im Ausland oft gehörte Vorwurf, die Schweiz sei<br />
der grösste Hedgefond Europas. Auch wenn die snb angesichts ihres grossen<br />
Bestandes an Währungsreserven von aussen gesehen wie ein normaler<br />
grosser Investor aussieht, greift die reine Anlagelogik doch zu kurz.<br />
Denn die snb kann – im Unterschied zu den übrigen Investoren – ihr<br />
Frankenrisiko auf den Währungsmärkten nicht absichern, weil dies der<br />
aktuellen Geldpolitik direkt zuwider laufen würde (Jordan 2013).<br />
Unabhängig davon ist es aber wichtig, dass sich die snb über den Ausstieg<br />
aus der aktuellen Wechselkurspolitik Gedanken macht, wozu auch<br />
dieses Diskussionspapier einen Beitrag leisten will. Sie steht dabei vor einer<br />
doppelten Herausforderung: Sie muss sowohl aus der Politik des ultrabilligen<br />
Geldes wie auch aus der temporären Untergrenze des Frankens gegenüber<br />
dem Euro aussteigen. Grundsätzlich muss dabei die geschaffene Liquidität<br />
so absorbiert werden, dass weder die Finanzmärkte noch die<br />
Wirtschaft durcheinander gebracht werden. Dafür stehen der snb neben<br />
einem umfangreichen Radarsystem (wie in Abschnitt 4 gezeigt) zahlreiche weitere<br />
Instrumente zur Verfügung. Wie die snb diese Werkzeuge einsetzt, muss<br />
sie selbst entscheiden. Dabei stellen sich allerdings knifflige Fragen:<br />
– Wie lange soll die heutige Untergrenze beibehalten werden?<br />
– Gefährdet ein allzu langes Festhalten den Ausstieg, weil sich der «faire»<br />
Wert des Euro gegenüber dem Franken wegen der höheren Inflation<br />
im Euro-Raum mit der Zeit dem Mindestkurs annähert?<br />
– Soll deshalb die Untergrenze auf einen Schlag preisgegeben werden,<br />
oder soll die Anpassung mittels einer allmählichen Anpassung des<br />
Mindestkurses auf Grund der Entwicklung der Kaufkraftparitäten<br />
(«craw ling peg») erfolgen?<br />
– Muss die snb die Zinsen länger tief halten <strong>als</strong> die ezb, um den Franken<br />
nicht wieder einem Aufwertungsdruck auszusetzen?<br />
– Ist ein Ausstieg der snb im Alleingang wegen der anhaltenden internationalen<br />
Ungleichgewichte überhaupt möglich? Oder braucht es dafür<br />
eine konzertierte Aktion der wichtigsten Notenbanken?<br />
Zum Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik 47