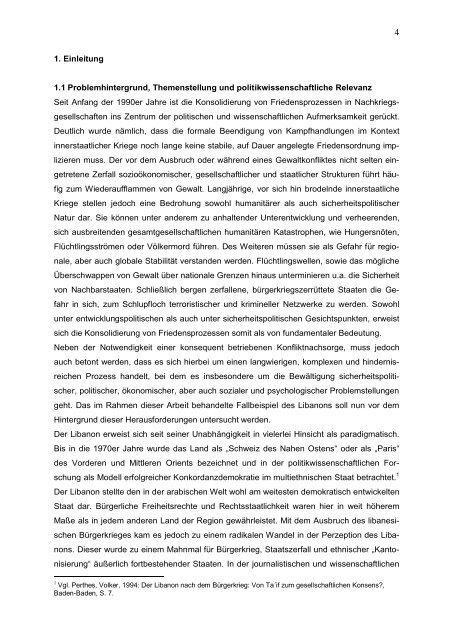Fallstudie Libanon (Nr. 51) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Libanon (Nr. 51) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Fallstudie Libanon (Nr. 51) - Geschwister-Scholl-Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4<br />
1. Einleitung<br />
1.1 Problemhintergrund, Themenstellung und politikwissenschaftliche Relevanz<br />
Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Konsolidierung von Friedensprozessen in Nachkriegsgesellschaften<br />
ins Zentrum der politischen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.<br />
Deutlich wurde nämlich, dass die formale Beendigung von Kampfhandlungen im Kontext<br />
innerstaatlicher Kriege noch lange keine stabile, auf Dauer angelegte Friedensordnung implizieren<br />
muss. Der vor dem Ausbruch oder während eines Gewaltkonfliktes nicht selten eingetretene<br />
Zerfall sozioökonomischer, gesellschaftlicher und staatlicher Strukturen führt häufig<br />
zum Wiederaufflammen von Gewalt. Langjährige, vor sich hin brodelnde innerstaatliche<br />
Kriege stellen jedoch eine Bedrohung sowohl humanitärer als auch sicherheitspolitischer<br />
Natur dar. Sie können unter anderem zu anhaltender Unterentwicklung und verheerenden,<br />
sich ausbreitenden gesamtgesellschaftlichen humanitären Katastrophen, wie Hungersnöten,<br />
Flüchtlingsströmen oder Völkermord führen. Des Weiteren müssen sie als Gefahr <strong>für</strong> regionale,<br />
aber auch globale Stabilität verstanden werden. Flüchtlingswellen, sowie das mögliche<br />
Überschwappen von Gewalt über nationale Grenzen hinaus unterminieren u.a. die Sicherheit<br />
von Nachbarstaaten. Schließlich bergen zerfallene, bürgerkriegszerrüttete Staaten die Gefahr<br />
in sich, zum Schlupfloch terroristischer und krimineller Netzwerke zu werden. Sowohl<br />
unter entwicklungspolitischen als auch unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten, erweist<br />
sich die Konsolidierung von Friedensprozessen somit als von fundamentaler Bedeutung.<br />
Neben der Notwendigkeit einer konsequent betriebenen Konfliktnachsorge, muss jedoch<br />
auch betont werden, dass es sich hierbei um einen langwierigen, komplexen und hindernisreichen<br />
Prozess handelt, bei dem es insbesondere um die Bewältigung sicherheitspolitischer,<br />
politischer, ökonomischer, aber auch sozialer und psychologischer Problemstellungen<br />
geht. Das im Rahmen dieser Arbeit behandelte Fallbeispiel des <strong>Libanon</strong>s soll nun vor dem<br />
Hintergrund dieser Herausforderungen untersucht werden.<br />
Der <strong>Libanon</strong> erweist sich seit seiner Unabhängigkeit in vielerlei Hinsicht als paradigmatisch.<br />
Bis in die 1970er Jahre wurde das Land als „Schweiz des Nahen Ostens“oder als „Paris“<br />
des Vorderen und Mittleren Orients bezeichnet und in der politikwissenschaftlichen Forschung<br />
als Modell erfolgreicher Konkordanzdemokratie im multiethnischen Staat betrachtet. 1<br />
Der <strong>Libanon</strong> stellte den in der arabischen Welt wohl am weitesten demokratisch entwickelten<br />
Staat dar. Bürgerliche Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit waren hier in weit höherem<br />
Maße als in jedem anderen Land der Region gewährleistet. Mit dem Ausbruch des libanesischen<br />
Bürgerkrieges kam es jedoch zu einem radikalen Wandel in der Perzeption des <strong>Libanon</strong>s.<br />
Dieser wurde zu einem Mahnmal <strong>für</strong> Bürgerkrieg, Staatszerfall und ethnischer „Kantonisierung“äußerlich<br />
fortbestehender Staaten. In der journalistischen und wissenschaftlichen<br />
1 Vgl. Perthes, Volker, 1994: Der <strong>Libanon</strong> nach dem Bürgerkrieg: Von Ta´if zum gesellschaftlichen Konsens?,<br />
Baden-Baden, S. 7.