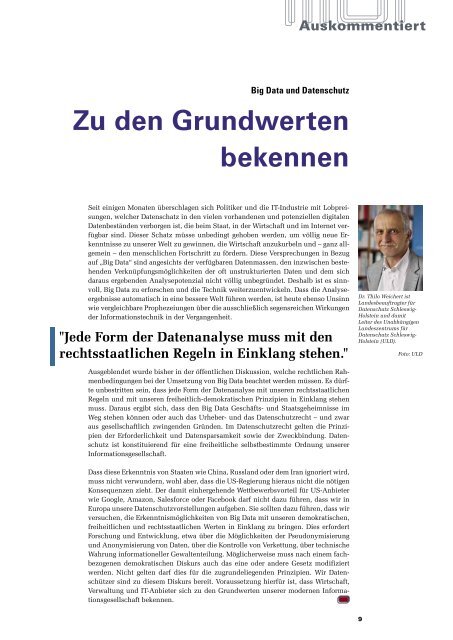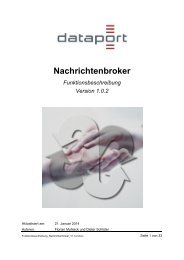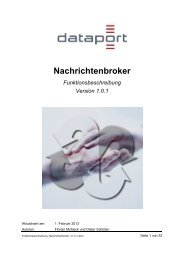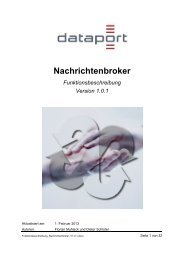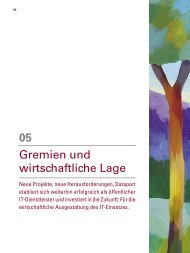Datareport 2/2013 - Dataport
Datareport 2/2013 - Dataport
Datareport 2/2013 - Dataport
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auskommentiert<br />
Big Data und Datenschutz<br />
Zu den Grundwerten<br />
bekennen<br />
Seit einigen Monaten überschlagen sich Politiker und die IT-Industrie mit Lobpreisungen,<br />
welcher Datenschatz in den vielen vorhandenen und potenziellen digitalen<br />
Datenbeständen verborgen ist, die beim Staat, in der Wirtschaft und im Internet verfügbar<br />
sind. Dieser Schatz müsse unbedingt gehoben werden, um völlig neue Erkenntnisse<br />
zu unserer Welt zu gewinnen, die Wirtschaft anzukurbeln und – ganz allgemein<br />
– den menschlichen Fortschritt zu fördern. Diese Versprechungen in Bezug<br />
auf „Big Data“ sind angesichts der verfügbaren Datenmassen, den inzwischen bestehenden<br />
Verknüpfungsmöglichkeiten der oft unstrukturierten Daten und dem sich<br />
daraus ergebenden Analysepotenzial nicht völlig unbegründet. Deshalb ist es sinnvoll,<br />
Big Data zu erforschen und die Technik weiterzuentwickeln. Dass die Analyseergebnisse<br />
automatisch in eine bessere Welt führen werden, ist heute ebenso Unsinn<br />
wie vergleichbare Prophezeiungen über die ausschließlich segensreichen Wirkungen<br />
der Informationstechnik in der Vergangenheit.<br />
"Jede Form der Datenanalyse muss mit den<br />
rechtsstaatlichen Regeln in Einklang stehen."<br />
Dr. Thilo Weichert ist<br />
Landesbeauftragter für<br />
Datenschutz Schleswig-<br />
Holstein und damit<br />
Leiter des Unabhängigen<br />
Landeszentrums für<br />
Datenschutz Schleswig-<br />
Holstein (ULD).<br />
Foto: ULD<br />
Ausgeblendet wurde bisher in der öffentlichen Diskussion, welche rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
bei der Umsetzung von Big Data beachtet werden müssen. Es dürfte<br />
unbestritten sein, dass jede Form der Datenanalyse mit unseren rechtsstaatlichen<br />
Regeln und mit unseren freiheitlich-demokratischen Prinzipien in Einklang stehen<br />
muss. Daraus ergibt sich, dass den Big Data Geschäfts- und Staatsgeheimnisse im<br />
Weg stehen können oder auch das Urheber- und das Datenschutzrecht – und zwar<br />
aus gesellschaftlich zwingenden Gründen. Im Datenschutzrecht gelten die Prinzipien<br />
der Erforderlichkeit und Datensparsamkeit sowie der Zweckbindung. Datenschutz<br />
ist konstituierend für eine freiheitliche selbstbestimmte Ordnung unserer<br />
Informationsgesellschaft.<br />
Dass diese Erkenntnis von Staaten wie China, Russland oder dem Iran ignoriert wird,<br />
muss nicht verwundern, wohl aber, dass die US-Regierung hieraus nicht die nötigen<br />
Konsequenzen zieht. Der damit einhergehende Wettbewerbsvorteil für US-Anbieter<br />
wie Google, Amazon, Salesforce oder Facebook darf nicht dazu führen, dass wir in<br />
Europa unsere Datenschutzvorstellungen aufgeben. Sie sollten dazu führen, dass wir<br />
versuchen, die Erkenntnismöglichkeiten von Big Data mit unseren demokratischen,<br />
freiheitlichen und rechtsstaatlichen Werten in Einklang zu bringen. Dies erfordert<br />
Forschung und Entwicklung, etwa über die Möglichkeiten der Pseudonymisierung<br />
und Anonymisierung von Daten, über die Kontrolle von Verkettung, über technische<br />
Wahrung informationeller Gewaltenteilung. Möglicherweise muss nach einem fachbezogenen<br />
demokratischen Diskurs auch das eine oder andere Gesetz modifiziert<br />
werden. Nicht gelten darf dies für die zugrundeliegenden Prinzipien. Wir Datenschützer<br />
sind zu diesem Diskurs bereit. Voraussetzung hierfür ist, dass Wirtschaft,<br />
Verwaltung und IT-Anbieter sich zu den Grundwerten unserer modernen Informationsgesellschaft<br />
bekennen.<br />
9