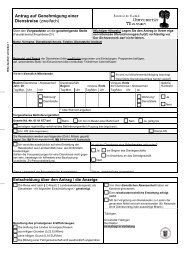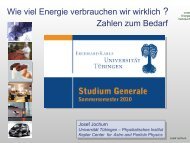Physikalisches Praktikum f¨ur Physiker - Physikalisches Institut
Physikalisches Praktikum f¨ur Physiker - Physikalisches Institut
Physikalisches Praktikum f¨ur Physiker - Physikalisches Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Messungen<br />
NR<br />
NR<br />
Natürliche Radioaktivität<br />
NaI-Kristall (thalliumaktiviert)<br />
a<br />
b<br />
PMT<br />
Impulse<br />
Verstärker<br />
grob fein<br />
grob fein<br />
grob fein<br />
a<br />
b<br />
- +<br />
Speicher<br />
CPU<br />
ADC<br />
PMT<br />
NaI<br />
Verstärker<br />
Hochspannung<br />
Hochspannung<br />
Abbildung NR.1: Schema eines Sekundärelektronenvervielfachers (Photomultiplier)<br />
5.1. Einschalten der Apparatur<br />
Im Allgemeinen sind Hochspannungsversorgung und Verstärker bereits eingeschaltet und<br />
eingestellt, verständigen Sie sich also mit dem Assistenten, bevor Sie etwas einschalten<br />
oder verändern. Nur falls Sie ausdrücklich dazu aufgefordert werden:<br />
• Vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet und auf 0<br />
gestellt ist! Die Verstärkung sollte auf ein Minimum eingestellt sein (d.h. Coarse auf<br />
10 und Fine auf 0.5)<br />
• Netzspannungen einschalten<br />
• Hochspannung HV an: Dazu Feststellknopf lösen, Schalter auf ”<br />
ein“, oberen Drehschalter<br />
auf 500 V drehen, anschließend am mittleren Drehschalter auf 700 V hochschalten,<br />
dazu Anzeige am Spannungverteiler beobachten.<br />
• Selbstständig Computer einschalten, Linux booten. Das Programm zur Aufnahme<br />
der Spektren wird mit dem Befehl histuegram auf der Kommandozeile oder durch<br />
Drücken des zugehörigen Icons gestartet. Hinweise zur Bedienung des Programms<br />
finden sich in Abschnitt 8.<br />
5.2. Liste der Messproben<br />
1. Ein Becher mit Kaliumchlorid: KCl, m = 300 g<br />
2. Eine Probe mit 22 Na-haltiger NaCl-Lösung<br />
127<br />
Abbildung NR.2: Versuchsaufbau: anschaulich (oben) und schematisch (unten)<br />
3. Ein Glühstrumpf für Propangaslampen<br />
4. ein kleines Stück Pechblende<br />
5. verschiedene Steine aus dem Schwarzwald<br />
6. Ein uranhaltiges Glas (sog. Annaglas)<br />
7. verschiedene Uhren mit radiumhaltigen Leuchtziffern<br />
8. Sand aus der Region Gomel (Weißrussland, 2004)<br />
5.3. Aufgaben<br />
Die folgenden Messungen können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden, da insbesondere<br />
die Kalibrierungsproben KCl und NaCl nur jeweils einmal vorhanden sind. Die<br />
Messzeiten können variabel gewählt werden, empfohlen werden 20 min für die KCl-Probe,<br />
10 min für den Untergrund, für die stärkeren Proben genügen meist 5 min. Die unterschiedlichen<br />
Messzeiten müssen bei der Subtraktion des Untergrunds berücksichtigt werden.<br />
1. Führen Sie die Kalibrierung durch Messung einer KCl-Probe durch, bei der Sie den<br />
Vollabsorptionspeak (1460.1 keV) und den β + –Vernichtungspeak (511 keV) im Spektrum<br />
zuordnen können. Alternativ können Sie die Kalibrierung mit der 22 Na-Probe<br />
durchführen. 22 Na ist ein β + -Strahler. Sie finden neben dem β + –Vernichtungspeak<br />
auch eine γ-Linie bei 1275 keV. In allen Fällen finden Sie auch deutlich die Emission<br />
charakterischer Röntgenstrahlung aus der Bleiabschirmung, prominent ist die K α -<br />
Linie bei 77 keV.<br />
128