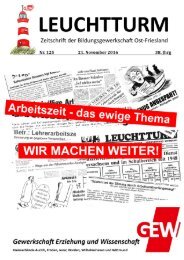LEUCHTTURM
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem:<br />
Barrieren, Widerstände und<br />
bildungspolitische Perspektiven<br />
Ich werde zunächst den<br />
schulischen Inklusionsbegriff<br />
kurz klären, danach die Widerstände<br />
und Barrieren auf dem<br />
Weg zu einem inklusiven<br />
Schulsystem darstellen und<br />
abschließend mutmachende Perspektiven<br />
ansprechen.<br />
I. Zur Klärung des<br />
Inklusionsbegriffs<br />
Wenn die UN-BRK die<br />
Entwicklung eines inklusiven<br />
Schulsystems fordert, dann greift<br />
sie zurück auf die Erklärung von<br />
Salamanca, die auf der Weltkonferenz<br />
der UNESCO 1994 in<br />
Spanien zusammen mit dem<br />
„Aktionsrahmen zur Pädagogik<br />
für besondere Bedürfnisse“ verabschiedet<br />
wurde. Dort wurden<br />
die Leitgedanken für ein<br />
inklusives Schulsystem wie folgt<br />
zusammengefasst:<br />
Alle Kinder haben das Recht<br />
auf Bildung. Alle Schulen<br />
nehmen alle Kinder in ihrem<br />
Umfeld auf, auch Kinder mit<br />
besonderen Bedürfnissen. Alle<br />
Schulen passen sich der Vielfalt<br />
der Kinder an und entwickeln<br />
eine kindzentrierte Pädagogik.<br />
Die gemeinsame Lern- und<br />
Beziehungskultur ist die Basis<br />
für die Potentialentfaltung aller<br />
Kinder.<br />
Nach Salamanca hat die<br />
UNESCO auf vielfältige Weise<br />
das Konzept der inklusiven<br />
Bildung international verbreitet.<br />
In ihrer Broschüre von 2009<br />
liest man u. a.: „Um inklusive<br />
Bildung zu ermöglichen, müssen<br />
Bildungssysteme alle Kinder<br />
erreichen und nach ihren<br />
individuellen Möglichkeiten optimal<br />
fördern. Die Systeme<br />
müssen dabei von der frühkindlichen<br />
Bildung an so gestaltet<br />
werden, dass sie sich den<br />
verschiedenen Bedürfnissen flexibel<br />
anpassen können. Allen<br />
Kindern soll ermöglicht werden,<br />
in einem gemeinsamen Unterricht<br />
voll am schulischen Leben<br />
teilzuhaben. Erst wenn Bildungssysteme<br />
dies für alle<br />
Kinder leisten, können wir von<br />
umfassender Bildungsgerechtigkeit<br />
sprechen.“ (Inklusion: Leitlinien<br />
für die Bildungspolitik,<br />
Deutsche UNESCO - Kommission<br />
2009)<br />
II. Barrieren und<br />
Widerstände auf dem<br />
Weg zur Inklusion<br />
1. These:<br />
Nicht die Existenz des<br />
gegliederten Schulsystems<br />
ist die eigentliche Barriere<br />
für ein inklusives Schulsystem,<br />
sondern der fehlende<br />
politische Wille, das bestehende<br />
System als Barriere<br />
zu identifizieren, die Gesellschaft<br />
darüber aufzuklären<br />
und das Hindernis<br />
politisch aus dem Weg zu<br />
räumen.<br />
Wo ein Wille ist, da ist ein<br />
Weg. Der Allgemeinplatz stimmt<br />
auch bezogen auf die Politik<br />
politisch. Jedes System lässt sich<br />
ändern, wenn der politische<br />
Wille dafür da ist. Man denke<br />
nur an die Wiedervereinigung<br />
oder die Energiewende.<br />
Was müsste die Bildungspolitik<br />
denn tun, um bewusstseinsbildend<br />
und verändernd im<br />
Sinne der Inklusion zu wirken?<br />
Sie müsste klar machen, dass<br />
inklusive Bildung ein unteilbares<br />
Menschenrecht ist. Davon ist<br />
jedoch nicht die Rede. Stattdessen<br />
verengt sie den Inklusionsanspruch<br />
auf Kinder mit<br />
Behinderungen. Und stellt selbst<br />
für diese Gruppe fest, dass es<br />
immer Ausnahmen geben wird,<br />
für die Inklusion nicht in Frage<br />
kommt und verwirklicht werden<br />
kann. Folglich werde es immer<br />
auch Förderschulen geben müssen.<br />
Die Politik müsste sich zu<br />
ihrer menschenrechtlichen Verpflichtung<br />
bekennen, die äußeren<br />
Schulstrukturen, die innere<br />
Lernorganisation und die Pädagogik<br />
an dem Recht aller<br />
Kinder auf gemeinsames Lernen<br />
auf der Basis von Diskriminierungsfreiheit<br />
und Chancengleichheit<br />
auszurichten und<br />
grundlegend zu verändern: von<br />
der Selektion zur Inklusion, von<br />
der Defizitorientierung zur<br />
Potentialentfaltung! Stattdessen<br />
arbeitet die Politik an der<br />
Reparatur bzw. an der Modernisierung<br />
des alten gegliederten<br />
selektiven Systems und statt die<br />
Selektionsmechanismen abzubauen,<br />
verfeinert sie diese. Dazu<br />
passt, dass sie in der Regel nur<br />
von inklusiven Schulen und<br />
inklusiven Angeboten spricht<br />
und den Begriff „inklusives<br />
Schulsystem“ vermeidet (s. Niedersachsen).<br />
Die Bildungspolitik müsste<br />
deutlich machen, dass Inklusion<br />
ein Menschenrecht für alle<br />
Kinder ist, auch für die Gruppe<br />
der heutigen Gymnasiasten.<br />
Auch sie haben ein Recht darauf,<br />
mit Kindern aus allen sozialen<br />
Milieus zu lernen und die<br />
Gemeinschaft der Kinder mit<br />
Behinderungen zu erfahren. Nur<br />
so können sie als Menschen in<br />
zukünftigen Führungspositionen<br />
den nötigen demokratischen<br />
Gemeinsinn entwickeln und<br />
Verständnis und Empathie für<br />
Menschen in schwierigen Lebenslagen<br />
aufbringen. Wenn<br />
überhaupt bildungspolitisch<br />
von einem erweiterten Inklusionsbegriff<br />
gesprochen wird,<br />
dann werden nur Migranten und<br />
benachteiligte Randgruppen einbezogen.<br />
Es erscheint ganz<br />
normal, dass Inklusion mit dem<br />
Gymnasium und den dort<br />
Lernenden nichts zu tun hat.<br />
Was müsste die Politik tun?<br />
Dr. Brigitte<br />
Schumann<br />
Vortrag gehalten<br />
auf dem Tag der<br />
Inklusion in<br />
Wittmund