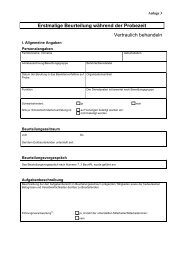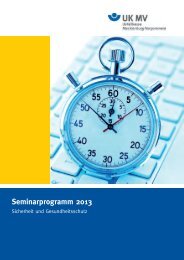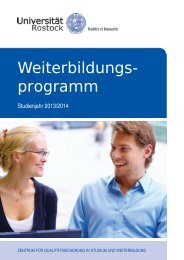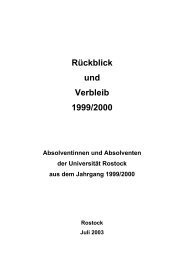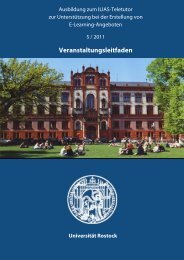Aktuelles Sonderheft: Speicher des Wissens - Universität Rostock
Aktuelles Sonderheft: Speicher des Wissens - Universität Rostock
Aktuelles Sonderheft: Speicher des Wissens - Universität Rostock
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Orte, Räume, Pläne<br />
Foto mit eingezeichnetem<br />
Bücherturm von<br />
der Blutstraße<br />
(heute Kröpeliner<br />
Straße) aus,<br />
1930<br />
im Raum aufgestellt, die drei Gebäudegeschosse<br />
wurden durch gusseiserne<br />
Zwischendecken in sechs Magazingeschosse<br />
aufgeteilt.<br />
Trotz der technischen Innovation der<br />
Magazinbibliothek war der Einzug der<br />
Bibliothek in das Hauptgebäude der <strong>Universität</strong><br />
organisatorisch eigentlich nicht<br />
mehr zeitgemäß, da sie angesichts <strong>des</strong><br />
schon damals absehbaren Wachstums<br />
der Bestände keine ausreichenden Erweiterungsmöglichkeiten<br />
zuließ. Bereits<br />
wenige Jahre später setzte sich das<br />
Prinzip durch, für die Bibliotheken eigenständige<br />
Funktionsbauten zu erstellen –<br />
dafür stehen der Neubau in Halle (1874)<br />
oder die Bauten von Martin Gropius und<br />
Heino Schmieden in Greifswald (1875)<br />
und Kiel (1881 – 1884).<br />
Magazinbibliothek im<br />
<strong>Universität</strong>shauptgebäude<br />
Der Bau <strong>des</strong> <strong>Universität</strong>shauptgebäu<strong>des</strong><br />
ermöglichte einen Neuanfang: 1866<br />
genehmigte der Großherzog Friedrich<br />
Franz II. den Beginn der Bauarbeiten<br />
eines neuen <strong>Universität</strong>shauptgebäu<strong>des</strong>.<br />
Hofbaurat Hermann Willebrand<br />
(1816 – 1899) wurde mit der Planung eines<br />
repräsentativen Neubaus an der Stelle<br />
<strong>des</strong> Weißen Kollegs beauftragt. Für die<br />
Bibliothek bedeutete dies eine erhebliche<br />
logistische Herausforderung: Für drei<br />
Jahre mussten die Bibliotheksbestände<br />
provisorisch in der Kirche <strong>des</strong> Klosters<br />
Zum Heiligen Kreuz aufgestellt werden.<br />
Diese war zu dieser Zeit noch nicht <strong>Universität</strong>skirche,<br />
jedoch unterstand die<br />
Verwaltung <strong>des</strong> Klosters zwei <strong>Universität</strong>sprofessoren.<br />
Für die Aufstellung der<br />
Bände wurde mit dem Abriss <strong>des</strong> mittelalterlichen<br />
Nonnenchors erheblich in die<br />
Bausubstanz der Kirche eingegriffen.<br />
Der nördliche Flügel <strong>des</strong> Gebäu<strong>des</strong><br />
war der Bibliotheksflügel: Im Erdgeschoss<br />
wurde das <strong>Universität</strong>sarchiv<br />
untergebracht, in den drei darüber liegenden<br />
Geschossen die mittlerweile<br />
auf 140.000 Bände angewachsene<br />
<strong>Universität</strong>sbibliothek. Architektonisch<br />
war das Gebäude trotz seiner historistischen<br />
Fassade sehr innovativ. Hermann<br />
Willebrand übernahm nämlich bei der<br />
Konstruktion der Bibliothek die neuesten<br />
Ansätze der berühmten Pariser Bibliotheksbauten<br />
<strong>des</strong> 19. Jahrhunderts, die<br />
er auf einer Studienreise kennengelernt<br />
hatte. In Abkehr von dem traditionellen<br />
Prinzip der Saalbibliothek wurde so in<br />
Deutschland erstmals das Prinzip der<br />
dreigeteilten Bibliothek verwirklicht:<br />
Der Bibliotheksraum wurde in einen<br />
öffentlichen Benutzerbereich, einen internen<br />
Verwaltungsbereich und einen<br />
Magazinbereich zur Aufbewahrung der<br />
Bücher gegliedert. Um Platz zu sparen,<br />
wurden die Bücherregale erstmals quer<br />
Erste Neubaupläne<br />
In <strong>Rostock</strong> wurde dies nach einer Generation<br />
akut: Seit 1895 wiesen die<br />
<strong>Rostock</strong>er Bibliothekare in zunehmend<br />
dramatischen Denkschriften auf den<br />
dringenden Erweiterungsbedarf für die<br />
Bibliothek hin. Die Notwendigkeit eines<br />
eigenen Bibliotheksgebäu<strong>des</strong> wurde<br />
immer offensichtlicher. In den ersten<br />
Jahrzehnten <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts gab<br />
es daher verschiedene Konzepte und<br />
Entwürfe für einen Neubau am <strong>Universität</strong>splatz.<br />
Als Bauplätze wurden unter<br />
anderem der Hof <strong>des</strong> Klosters zum Heiligen<br />
Kreuz und die Errichtung eines Bücherturms<br />
an der Stelle <strong>des</strong> Bolzendahlschen<br />
Hauses in der Kröpeliner Straße<br />
erwogen. Doch der Erste Weltkrieg und<br />
der chronische Geldmangel der <strong>Universität</strong><br />
in den Jahren der Weimarer Republik<br />
machten die mit großer Energie betriebenen<br />
Pläne stets zunichte. ■<br />
Kontaktbox Robert Zepf, vgl. S. 7<br />
32<br />
Traditio et Innovatio – Sonderausgabe 2013