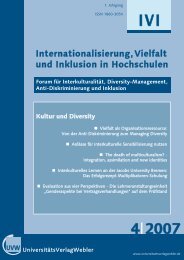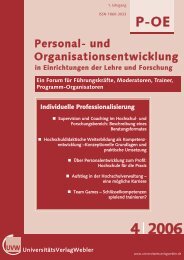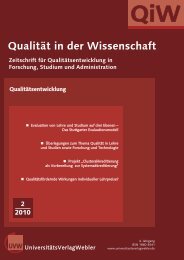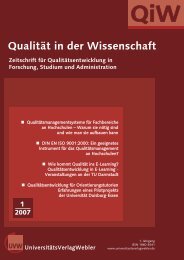Fo - UniversitätsVerlagWebler
Fo - UniversitätsVerlagWebler
Fo - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fo</strong>rschungsgespräche<br />
<strong>Fo</strong><br />
allermeisten Anträge in englischer Sprache. Langfristig wird<br />
sich die internationale Begutachtung wohl noch weiter<br />
durchsetzen. Auch in der Förderinitiative „Deutsch plus“<br />
haben wir auf Vorschlag des Antragstellers schon einen auf<br />
Englisch abgefassten Antrag entgegengenommen, weil es<br />
sich um ein Kooperationsprojekt zwischen England und<br />
Deutschland gehandelt hat. Ein englischsprachiger Antrag<br />
in dieser Förderinitiative ist also kein Widerspruch in sich.<br />
Dennoch muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob das<br />
Prüfverfahren wirklich nur auf Englisch stattfinden kann<br />
oder ob es nicht auch Alternativen gibt.<br />
<strong>Fo</strong>: Es wird in Deutschland seit längerem gefordert, dass<br />
Europa ein mehrsprachiges System der Zitationsindizes aufbaut,<br />
das europäische, also auch deutschsprachige Zeitschriften<br />
und andere Publikationskontexte sowie Lehrbücher,<br />
mit erfasst. Kann die VW-Stiftung hier nicht gezielt<br />
(evtl. zusammen mit anderen Förderern) die entsprechende<br />
Entwicklung anregen und fördern, z.B. zu Einzelprojekten<br />
einladen oder die Förderinitiative um eine solche Förderlinie<br />
ergänzen?<br />
TB: Das Thema ist wichtig, fällt aber nicht in den genuinen<br />
Förderbereich der VolkswagenStiftung, die Infrastrukturprojekte<br />
dieser Größenordnung nicht finanziell tragen, sondern<br />
allenfalls Anstöße liefern kann. Vertreter der Stiftung<br />
bringen sich aber durchaus wirksam in Diskussionen zu diesem<br />
Thema ein.<br />
<strong>Fo</strong>: Wir haben den Eindruck, dass viele Akteure mehr das<br />
bloße Phänomen des Rückgangs sehen und dieses entweder<br />
für einen unwiderstehlichen Vorgang wie eine Naturgewalt<br />
halten oder zwar aufhalten wollen, aber nur eine<br />
höchst unvollständige Ursachenanalyse stattfindet. Manchmal<br />
wird der Rückgang auf die <strong>Fo</strong>lgen des 2. Weltkrieges<br />
zurückgeführt, in deren Kontext viele glänzende deutsche<br />
Wissenschaftler jüdischer Herkunft vertrieben oder umgebracht<br />
wurden und die deutsche Wissenschaft oder sogar<br />
alles Deutsche moralisch verurteilt wurde. Viele Länder, die<br />
vorher aufmerksam die (wissenschaftlichen) Entwicklungen<br />
in Deutschland verfolgt hatten, wandten sich der Entwicklung<br />
in den USA zu. Das geschah aber nicht von alleine<br />
oder weil die USA plötzlich als einzige auf der Welt wissenschaftlich<br />
faszinieren konnten. Das geschah auch durch ein<br />
Bündel von Strategien, u.a. Publikationsstrategien. Mit<br />
ihnen sind bestimmte Zeitschriften zu den führenden Zeitschriften<br />
ihrer Disziplinen aufgestiegen, mit ihnen sind Systeme<br />
wie die Wirkungsanalysen (Impactfaktoren) errichtet<br />
worden. Und die Wissenschaftler in aller Welt haben sich<br />
freiwillig diesen Vorgaben gebeugt.<br />
Wäre von einer Politik zur Stärkung des Deutschen als Wissenschaftssprache<br />
(neben anderen Sprachen) nicht zu erwarten,<br />
dass hier Gegenstrategien entwickelt und umgesetzt<br />
werden, die diese Trends stoppen und umkehren?<br />
Und als zweite Frage in diesem Block: Wäre es der VW-Stiftung<br />
nicht möglich gewesen, der Entwicklung von aussichtsreichen<br />
Gegenstrategien eine weitere Förderkomponente<br />
zu widmen?<br />
TB: Die von Ihnen wiedergegebene Analyse des Phänomens<br />
des „Rückgangs“ des Deutschen als Wissenschaftssprache<br />
halte ich für durchaus zutreffend. Sicher hat dieser Rückgang<br />
viel mit dem Bild zu tun, das die Deutschen mit dem<br />
Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg von sich in der<br />
Welt hinterlassen haben. Zum Teil ist die Abwertung des<br />
Deutschen in der Welt damit sicher auch selbst verschuldet.<br />
Umso mehr stellt sich die Frage, ob „Gegenstrategien“,<br />
so wie Sie sie sich vorstellen, hier angebracht sind. Warum<br />
abermals diese Kriegsmetaphorik? Gibt es gerade vor diesem<br />
Hintergrund nicht leisere, angemessenere Wege, auf<br />
sich aufmerksam zu machen und für die eigene Sprache und<br />
Kultur und natürlich die eigene Wissenschaft zu werben als<br />
mit groß angelegten „Gegenstrategien“? Eine Förderinitiative<br />
zur Stärkung des Deutschen als Wissenschaftssprache<br />
gehört meines Erachtens wohl wie keine andere in die<br />
Hände eines impulsgebenden Förderers.<br />
Bei all dem darf man auch nicht vergessen, dass die Internationalisierung<br />
der Wissenschaft auch Vorteile mit sich gebracht<br />
hat. Die Verwendung einer Sprache, die möglichst<br />
viele verstehen, erhöht die Verständlichkeit – zumindest<br />
quantitativ. Die Idee einer weltweit verständlichen Wissenschaft<br />
über die Grenzen der Länder und Köpfe hinweg hat<br />
von daher etwas Bestechendes, für das es sich einzusetzen<br />
lohnt. Nationalisierungstendenzen sind auch Abschottungsprozess.<br />
Solche Entwicklungen kann und will die<br />
VolkswagenStiftung nicht fördern. Schließlich ist unser Leitgedanke<br />
auch nicht die bloße Propagierung des Deutschen,<br />
sondern die Idee der wissenschaftlichen Mehrsprachigkeit!<br />
<strong>Fo</strong>: Na ja, der Begriff „Förderstrategie" ist mir wohl vertraut.<br />
Ich spreche nicht in „Kriegsmetaphorik”; der Strategiebegriff<br />
ist längst ganz zivil in die Wirtschaftswissenschaften<br />
in vielen Kombinationen eingegangen (Unternehmenstrategie)<br />
oder in die Psychologie (Werbestrategie, Lernstrategie)<br />
und findet sich in Konkurrenzverhältnissen (z.B.<br />
Erfolgsstrategie), mit denen wir es hier vielfach zu tun<br />
haben. Immerhin, es gibt Vorgänge in diesem Zusammenhang,<br />
die hier nicht ausgebreitet werden können, die aber<br />
wenig mit edlem Ideenwettbewerb zu tun haben. Das Instrumentarium<br />
ist auch von außen, von Interessenträgern,<br />
für eigene Interessen instrumentalisiert worden. Auch ohne<br />
alle Verschwörungstheorien und Verdächtigungen des wissenschaftlichen<br />
Imperialismus passen die von den USA ausgehenden<br />
Strategien und Einzelmaßnahmen erstaunlich gut<br />
zusammen und passen auch gut zu der Debatte um brain<br />
gain, der dann doch in die Nähe eines wissenschaftlichen<br />
Imperialismus gerückt wird. Halten wir uns nicht mit der<br />
Erörterung von vermuteter Absicht auf, sondern konzentrieren<br />
uns auf die <strong>Fo</strong>lgen. Diese <strong>Fo</strong>lgen sind nicht im deutschen<br />
Interesse, weder kulturell, wissenschaftlich noch<br />
wirtschaftlich, also müssten Gegenstrategien entwickelt<br />
werden, um den Trend wieder umzukehren. Damit ist nicht<br />
gemeint, Deutsch nun seinerseits zur lingua franca der Wissenschaft<br />
zu machen (was ohnehin vergeblich wäre). Aber<br />
ihr den ihr gebührenden Platz nach Quantität und vor allem<br />
Qualität im deutschsprachigen Raum erzielter wissenschaftlicher<br />
Ergebnisse zu verschaffen, wäre ein plausibles Ziel.<br />
TB: Mir ist nicht ganz klar, was die Pfründe sind, die Sie hier<br />
sichern wollen. Natürlich ist die Qualität deutscher Wissenschaft<br />
ganz entscheidend für deren internationale Bedeutung.<br />
Das ist aber noch lange kein Grund dafür, dass sie<br />
110<br />
<strong>Fo</strong> 3+4/2009